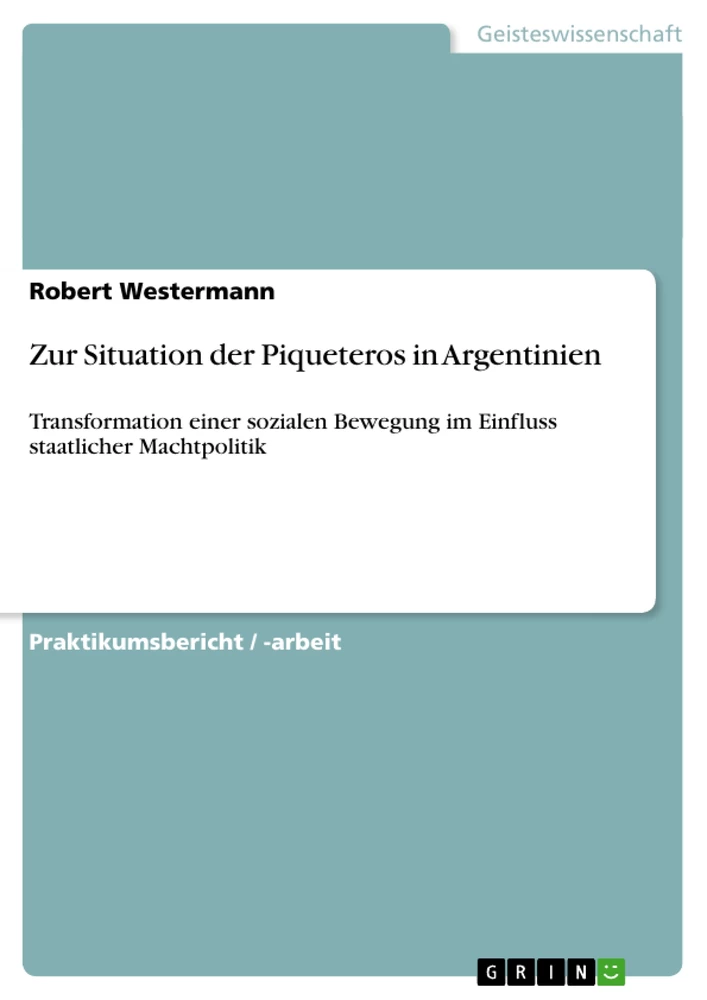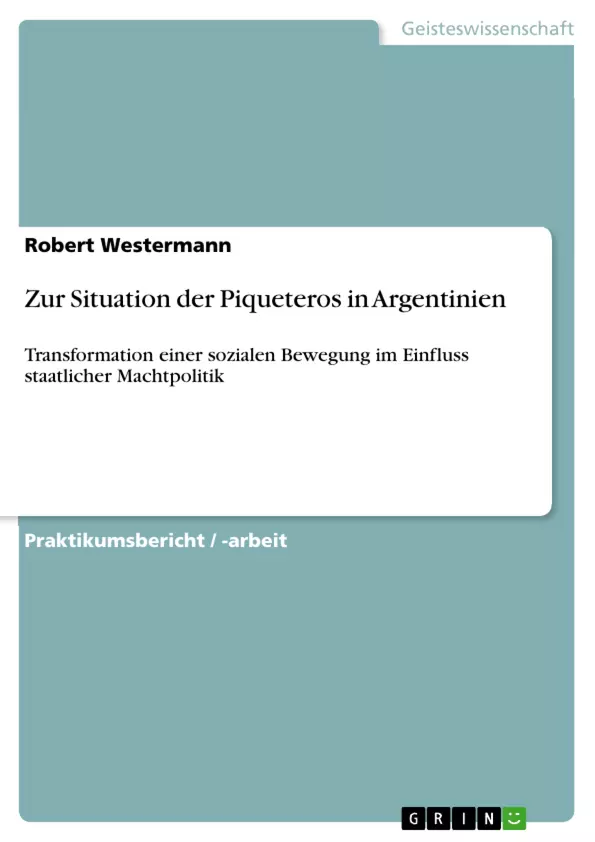Seit den Massendemonstrationen im Dezember 2001 und dem
darauffolgenden Wechsel von vier argentinischen Präsidenten in wenigen
Tagen, gingen Berichte über neu entstandene soziale Bewegungen um die
Welt. Die neue Formen des Protestes, Stadtteilversammlungen und
Tauschringe zogen das Interesse der europäischen und nordamerikanischen
Forschung nach deren soziologischer Dynamik auf sich.
Doch was ist heute, dreieinhalb Jahre nach dem Amtsantritt des als links
geltenden Präsidenten Néstor Kirchner 2003 und im Vorfeld der nächsten
Präsidentschaftswahlen im Jahr 2007, aus den sozialen Kämpfen geworden?
Der Bericht verfolgt auf Grundlage theoretischer Erkenntnisse über die
Institutionalisierung von politischem Protest den Wandel der Piquetero-
Organisationen von spontan entstandenen Zusammenschlüssen Arbeitsloser in
der argentinischen Provinz, hin zu instrumentalisierten „Werkzeugen“
politischer Macht, vornehmlich im Großraum Buenos Aires.
Es wird angenommen, dass besonders die klientelistische Politik der Regierung
Kirchner diese Tendenz unterstützt und auf spezifische Weise zwar soziale
Konflikte oberflächlich abgebaut werden, unterschwellig jedoch eine
Fragmentierung und Polarisierung der Gesellschaft fördert.
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
A. PROTESTFORSCHUNG
1. Forschungsbereich Neue Soziale Bewegungen
2. Institutionalisierung von Protestverhalten
B. SOZIALE MOBILISIERUNG IN ARGENTIENIEN
1. „Der Peronismus ist unsere Identität“
2. Von Desempleados (Arbeitslosen) zu Piqueteros: Die 90er Jahre
3. Die Argentinienkrise 2001/
a) "Piquete y cacerola - la lucha es una sola"
b) Transformation der Piquetero- Bewegung
4. Der Estilo K seit
C. PIQUETEROS HEUTE: Parteistoßtrupp und Einschüchterungswerkzeug
1. Instrumentalisierung der Planes Sociales
2. Staatlich initiierte Demonstrationen
3. Ausblick: Der „Diskurs der Unsicherheit“ in Wahlkampfzeiten
LITERATUR
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A. PROTESTFORSCHUNG
Forschungsbereich Neue Soziale Bewegungen
Theoretische Grundlagen für die Fragestellung nach dem Zusammenhang von Konfliktregelung und Institutionalisierung bietet explizit die Forschung zu den Neuen Sozialen Bewegungen. Ausgerichtet war sie zunächst auf die neuen sozialpolitischen Ansprüche an den Staat im “postindustriellen” Westeuropa und fokussierte sich auf politische Systemkrisen, die man in Hinblick auf politisches Kollektivverhalten oder die Mobilisierung von Protest untersuchte.1 Die Analyse politischen Konflikts führte zur Differenzierung von Ansprüchen sog. “citizen groups” und den etablierten “decision-making authorities”.2
Besonders anknüpfungswert sind die Konzepte und Ergebnisse der NSB- Forschung, wenn es um die institutionalisierte Konfliktregelung im Prozess demokratischer Transformation und Konsolidierung geht. Die jüngsten Studien der deutschen NSB-Forschung haben sich insbesondere auf Schlussfolgerungen aus entsprechenden Lehren der Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa konzentriert.3
Institutionalisierung von Protestverhalten
Bereits mit der Studie von Sidney Tarrows zu Protest und Politik in Italien 1965-1975 hatte sich in der NSB-Forschung eine verallgemeinerte Begriffssystematik zwischen Institutionalisierung und politischem Konfliktverhalten herausgestellt. “Institutionalisierung” gilt hier logisch als direkter Gegensatzbegriff zu “Protestdynamik”, die von Tarrow durch fünf Merkmale bestimmt wird:
“First, protests are direct, not representative, collective actions whose authors reject institutional mediation.
Second, protests aim primarily at disruption and not specifically at violence. Though violence is the ultimate form of disruption, protesters more frequently attempt to disrupt economic processes, government business, and the routines of everyday life than to take lives or destroy property [...].
Third, protests are expressive. By this I do not mean that they cannot raise instrumental demands, but only that these demands are often couched in symbolically charged and no-negotiable terms [...].
Forth, however expressive they are, protests involve claims that impinge on other groups or on political and economic elites.
Fifth, though they use unconventional actions in expressive ways, protesters are strategic in their choice of issues, targets, and goals. As in political and economic decisions, the choice to participate in collective action is the result of the incentives, probable risks, and perceived cost.”4
Für eine politische Institutionalisierung gelten diese Kriterien in umgekehrter Ausprägung und statt Konflikt und Widerspruch werden Integration und Vermittlung zu den bestimmenden Fluchtpunkten. Im Fall von Institutionalisierung erfolgt die Artikulierung von Ansprüchen und von Konflikt nicht positional und konfrontativ, sondern durch Inklusion, d.h. durch die geregelte Aufnahme von Kritik in das kritisierte System selbst, und insbesondere nicht in der Form, dass anderen Gruppen oder den herrschenden Eliten etwas abgerungen werden soll.
Die Frage des Grads an Institutionalisiertheit in der Aktivität sozialer Bewegungen beantwortet die NSB-Forschung durch ein Stufenmodell:
(1) Die Keimzelle bilden Organisationskerne, die entscheidende soziale Anlaufstellen werden.
(2) Strikte Problemorientierung, um die herum sich kritische Professionalität bildet.
(3) Integrationsleitungen von Netzwerken zwischen verschiedenen Handlungsarenen.
(4) Aggregierte Projekte, die zur Bildung eines politischen Organisationskerns und in der Folge zu eigenständiger Akteursidentität im Geflecht der schon etablierten “Institutionen” führen können.
(5) Die Herausbildung eines gemeinsamen spezifischen Aktionsrepertoires.
(6) Eine vermittelnde Umwelt, die regelmäßige Kontakte zwischen der neu institutionalisierten Institution und den bestehenden ermöglicht.
(7) Zeitgebundenheit und Stablisierung durch Kontinuität der Institutionalisierung. Eine “kritische” Soziale Bewegungsforschung geht davon aus, dass diese immer aus dauernder De- und Rekonstruktion besteht.5
“Institutionalisierung” bezeichnet für Roland Roth den Vorgang der Einbettung von außerinstitutionellem Verhalten in die bestehenden Institutionen, insbesondere die in ihnen formalisierten Wege der Artikulation von Widerspruch, Ansprüchen und Bedürfnissen. Der Leitmechanismus ist Akteursinklusion, die Aufnahme der Akteure und ihrer Ansprüche in die gegebene, sich dadurch Veränderungsdruck anpassenden Formalinstitutionen des Regierungssystems.6 Endscheidend ist somit, inwieweit von den Mitgliedern der Protestbewegung institutionelle politische Rollen angenommen werden.
Ebenfalls trägt “Institutionalisierung als Konfliktverregelung” deutliche organisationssoziologische Züge: Institutionalisierung als Zuwachs an Organisiertheit und Routinisierung, Wechsel von Konfrontations- zu Verhandlungsverhalten und funktionale Spezialisierung. Entscheidend ist die Feststellung, dass sowohl die Funktionsfähigkeit formaler Institutionen des Regierungssystems als auch die Institutionalisierung von Protest mitbestimmt werden durch die jeweilige politische Kultur und die sich aus ihr ergebenen Stile von Konfliktaustragung.7
Eine Einordnung des Institutionalisierungsgrades der Piquetero - Bewegung muss somit in Verbindung von der gegenwärtigen politischen Kultur in Argentinien hergeleitet werden. Das Vorgehen des Regierungschefs Nestor Kirchner steht dabei im Mittelpunkt der Untersuchung.
B. SOZIALE MOBILISIERUNG IN ARGENTINIEN
„Der Peronismus ist unsere Identität“8
Wie das Zitat von Louis D’Elía beispielhaft belegt, versteht sich ein großer Teil der Piquetero- Bewegung als Vertreter peronistischen Gedankenguts. Es wird daher kurz die Entwicklung und der Einfluss des Peronismus in Argentinien erläutert. Grob lässt sich seine Entwicklungsgeschichte in die vier Stadien des Alt-, Post-, Pseudo-, und Neoperonismus einteilen.9
Die politische Karriere des Juán Domingo Peron begann in den 40er Jahren. 1946 wurde er vor allem durch die Unterstützung der Arbeiter zum Präsidenten gewählt. Perón regierte mit diktatorischen Vollmachten und fokussierte sich auf die Beseitigung der Oligarchie, die Verstaatlichung der Wirtschaft und eine ausgleichende Sozialgesetzgebung. Diese politische Richtung, die er als “dritten” Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus bezeichnete und mit maßgeblichem Einfluss seiner Frau Eva Maria Perón gestaltete, wird noch heute von den Kandidaten des Partido Justicialista, 1946 von Perón gegründet, auf eine ähnliche Weise ‚zelebriert’.10
Sowohl das Parteiensystem als auch die erstmals legalisierten Gewerkschaften wurden in der Regierungszeit Peróns von 1946 bis 1955 nachhaltig beeinflusst. In Form eines staatlichen Verordnungs- und Gesetzeswesen wurden Arbeitern immer mehr soziale Rechte und politische Partizipationsmöglichkeiten eingeräumt. Die Beteiligung an der organisierten Gewerkschaftsbewegung stieg daraufhin sprunghaft an. Lag die Zahl 1943 noch bei 350.000, waren es 1948 beinahe vier Millionen Arbeiter.11 Die populistische Politik Peróns war geprägt von einer starken antiimperialistischen, das breite Volk ansprechenden Rhetorik, sowie dem Aufbau starker, aber populistisch-korporativistischer Gewerkschaften und anderer peronistischer Verbände, welche eng an den Staat und den PJ gebunden waren.12
Im Jahr 1955 gerät Perón in Folge einer anhaltende Hyperinflation immer mehr unter Druck und wird im September durch einen Militärputsch aus dem Amt gedrängt. Er flüchtet zunächst nach Nicaragua und 1958 nach Spanien ins Exil.
Die Zeit des Post-Peronismus beginnt 1972. Perón kehrt in einer politischen Krisensituation zurück nach Argentinien und wird im September 1973 zum Präsidenten vereidigt. Die Erwartungen nach sozialen Reformen können jedoch auch aufgrund des zeitigen Todes Peróns am 1. Juli 1974 nicht erfüllt werden. Seine Frau Isabel Perón übernimmt wenig erfolgreich die Regierungsführung bis sie im März 1976 durch die Junta des Generals Jorge Videla gestürzt wird.
[...]
1 Vgl. Klaus Eder: Die Institutionalisierung kollektiven Handelns. Eine neue theoretische Problematik in der Bewegungsforschung?, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 7, 1994, Nr. 2, S.40-52.
2 Sidney Tarrow: The Europeanisation of Conflict: Reflections from a Social Movement Perspective, in: West European Politics 18,1995, S. 223-251.
3 Vgl. Karl Werner Brand: Institutionalisierung demokratischer Strukturen in post-sozialistischen Gesellschaften, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 6, 1993, Nr. 2, S.106-109; Helmut Fehr: Soziale Bewegungen im Übergang zu politischen Parteien in Ost-Mitteleuropa: Polen, die Tschechische Republik, Slowakei und Ungarn, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 6, 1993, Nr. 2, S.25-40.
4 Sidney Tarrow: Democracy and Disorder. Protest and Politics in Italy 1965-1975, Oxford 1989, p.14.
5 Roland Roth: Demokratie von unten. Neue soziale Bewegungen auf dem Weg zur politischen Institution, Köln 1994, S.190-197.
6 Vgl. ebd., S.135.
7 Tarrow: Democracy, p.310f.
8 Louis D’Elía (Vorsitzender der FTV, eine der größten regierungstreuen Piquetero- Organisationen), zitiert nach: Rainer Luyken: „Und ewig lockt Evita“ – www.zeit,de/2003/21/Argentinien
9 Vgl. Lutz Herden: Die vier Jahreszeiten des Peronismus, in: Freitag: Die Ost-West- Wochenzeitung, Nr.28, 07.07.06. http://www.freitag.de/2006/28/06280802.php
10 Vgl. Luyken: „Und ewig ...“
11 Vgl. Birle, Peter: „Gewerkschaften, Unternehmerverbände und Staat: Der schwierige Abschied vom Klassenkampf durch Mittelsmann“ , in: Bodemer; Pagni; Waldmann (Hrsg.): Argentinien heute, Bibliotheca Ibero-Americana B d.88, Frankfurt am Main 2002, S. 154.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es handelt sich um OCR-Daten aus einem Verlag, die ausschließlich für akademische Zwecke zur Analyse von Themen verwendet werden sollen.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen sind Protestforschung, soziale Mobilisierung in Argentinien und die Rolle der Piqueteros heute, einschließlich ihrer Instrumentalisierung und der staatlich initiierten Demonstrationen.
Was sind die Schwerpunkte der Protestforschung?
Die Protestforschung konzentriert sich auf das Forschungsfeld Neue Soziale Bewegungen und die Institutionalisierung von Protestverhalten. Sie untersucht die Beziehung zwischen Konfliktregelung und Institutionalisierung.
Was wird unter sozialer Mobilisierung in Argentinien verstanden?
Die soziale Mobilisierung in Argentinien wird anhand des Peronismus, der Entwicklung der Piquetero-Bewegung in den 90er Jahren und der Argentinienkrise von 2001/2002 analysiert. Auch der "Estilo K" (Kirchner-Stil) seitdem wird betrachtet.
Wer sind die Piqueteros und welche Rolle spielen sie heute?
Die Piqueteros werden als Parteistoßtrupp und Einschüchterungswerkzeug betrachtet. Ihre Rolle wird im Zusammenhang mit der Instrumentalisierung der Planes Sociales (Sozialpläne) und staatlich initiierten Demonstrationen untersucht.
Was wird im Ausblick erwähnt?
Der Ausblick behandelt den „Diskurs der Unsicherheit“ in Wahlkampfzeiten.
Was wird unter Institutionalisierung von Protestverhalten verstanden?
Institutionalisierung von Protestverhalten bezieht sich auf den Prozess, bei dem außerinstitutionelles Verhalten in die bestehenden Institutionen eingebettet wird, insbesondere in die formalisierten Wege der Artikulation von Widerspruch, Ansprüchen und Bedürfnissen.
Welche Rolle spielt der Peronismus in Argentinien?
Der Peronismus wird als ein wichtiger Faktor für die Identität und soziale Mobilisierung in Argentinien betrachtet. Die Entwicklung des Peronismus wird in die Stadien Alt-, Post-, Pseudo- und Neoperonismus unterteilt.
- Quote paper
- Robert Westermann (Author), 2006, Zur Situation der Piqueteros in Argentinien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111880