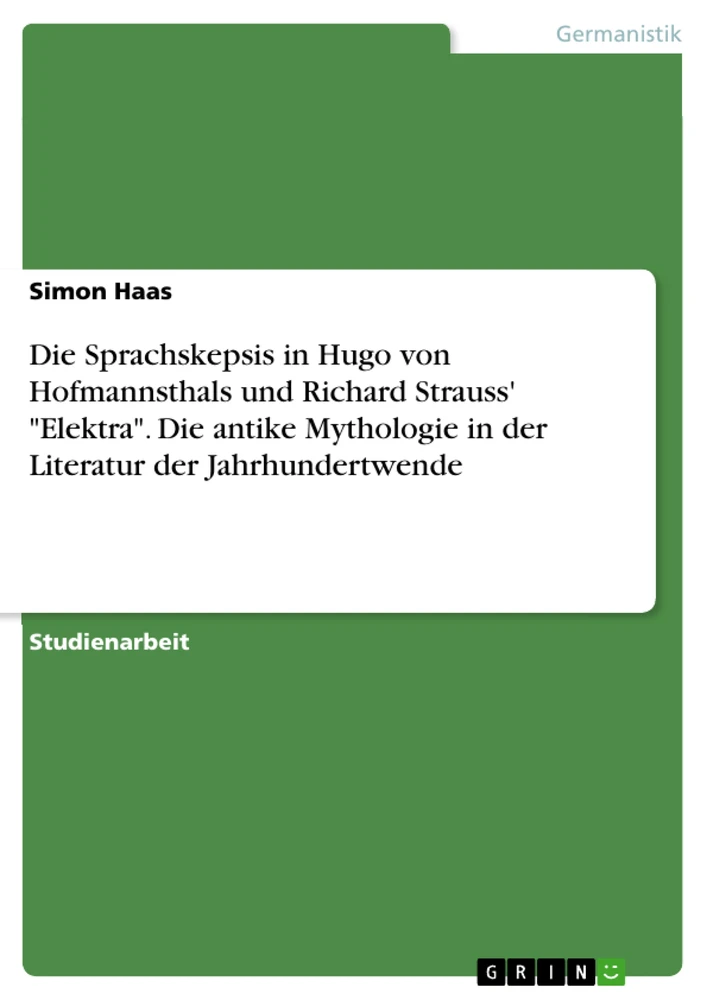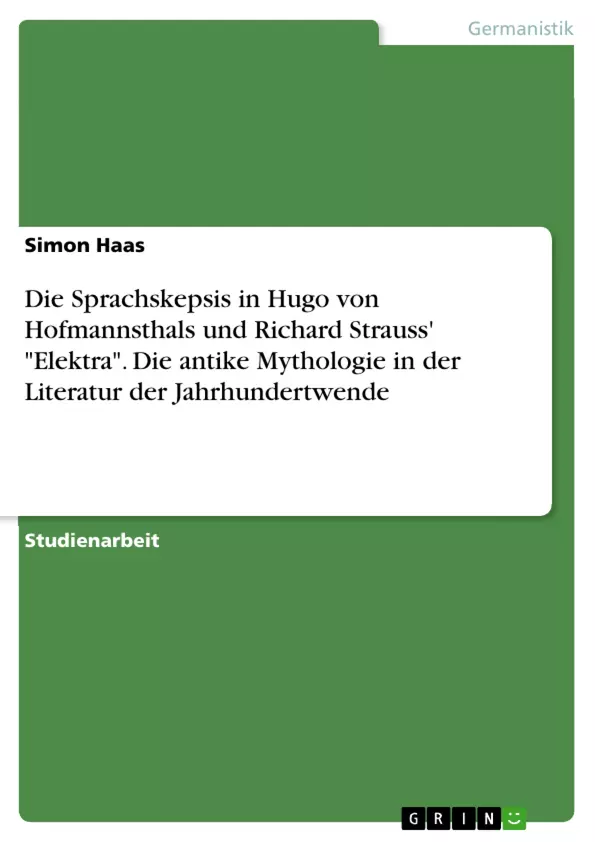Als Hypothese dieser Seminararbeit gilt die Annahme, dass Hofmannsthals und Strauss‘ Elektra als sprachskeptisches Werk anzusehen ist. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf einer auf Close-Reading basierenden Analyse des Librettos Hofmannsthals unter Einbeziehung des Tragödientexts. Darüber hinaus wird einschlägige Fachliteratur zur Untermauerung der aufgestellten These herangezogen und um den Kontext zu skizzieren, in welchem das Werk entstand.
Die Literatur des Fin de Siècle griff häufig auf Stoffe der antiken Mythologie zurück. In enger Verbindung mit diesem Antike-Diskurs steht auch die Zusammenarbeit von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss. In den meisten der insgesamt sechs Operndichtungen, die aus jener Kooperation entstanden, stehen Bezüge zu antiken Mythen im Mittelpunkt. So auch bei der Oper Elektra, welche im Januar 1909 im königlichen Opernhaus Dresden uraufgeführt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Kontext
- 2.1 Wiener Moderne
- 2.2 Sprachskepsis um die Jahrhundertwende
- 3 Sprachskepsis in Elektra
- 3.1 Hysterie und Sprachskepsis
- 3.2 Sprache und Tat
- 4 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Darstellung von Sprachskepsis in Hugo von Hofmannsthals und Richard Strauss' Oper "Elektra". Die Arbeit analysiert das Werk im Kontext der Wiener Moderne und der zeitgenössischen Diskurse, die um die Jahrhundertwende prägend waren. Ziel ist es, die Einbettung der Sprachskepsis in die psychoanalytischen, literarischen und philosophischen Diskurse des Fin de Siècle aufzuzeigen.
- Die Rolle der Sprachskepsis in der Wiener Moderne
- Die Verbindung von Sprachskepsis und Hysterie in Elektra
- Die Auseinandersetzung mit Sprache und Tat in Hofmannsthals Libretto
- Die Einbettung der Oper in die Rezeption von antiken Mythen
- Der Einfluss der Psychoanalyse auf Hofmannsthals Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik der Sprachskepsis in Hofmannsthals und Strauss' Elektra. Es skizziert die Rezeption des antiken Mythos und die Entmythologisierung im Kontext der modernen Diskurse. Außerdem wird die Verbindung zur Psychoanalyse Freuds und die Bedeutung der Figur der Elektra im Hinblick auf die Hysterie thematisiert.
- Kapitel 2: Kontext Dieses Kapitel beleuchtet den Kontext des Werkes, insbesondere die Wiener Moderne, mit ihren künstlerischen und gesellschaftlichen Strömungen. Es beleuchtet die literaturgeschichtliche Einordnung der Oper sowie die Rezeptionsgeschichte von Hofmannsthals Elektra. Darüber hinaus wird Hofmannsthals Ein Brief betrachtet, der die Tradition der Sprachkritik in der Moderne beleuchtet.
- Kapitel 3: Sprachskepsis in Elektra Dieses Kapitel analysiert die Verbindung von Sprachskepsis und der Darstellung von Hysterie in Elektra. Es arbeitet mit dem Text, um die Sprachskepsis in den Dialogen und Handlungen der Figuren zu beleuchten und bezieht wissenschaftliche Fachliteratur zum Vergleich ein.
- Kapitel 4: Resümee Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Punkte der Seminararbeit zusammen und bietet eine abschließende Reflexion über die Darstellung von Sprachskepsis in Hofmannsthals und Strauss' Elektra.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit behandelt Themen wie Sprachskepsis, Wiener Moderne, Hysterie, Psychoanalyse, Antike, Mythen, Opernlibretto, Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss, Elektra.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Sprachskepsis im Kontext der Oper „Elektra“?
Sprachskepsis bezeichnet das Misstrauen gegenüber der Fähigkeit der Sprache, die Wirklichkeit oder innerpsychische Zustände adäquat auszudrücken, ein zentrales Thema der Wiener Moderne.
Wie hängen Hysterie und Sprachskepsis in Hofmannsthals Libretto zusammen?
Die Figur der Elektra zeigt hysterische Züge, bei denen die Sprache oft versagt oder durch körperliche Handlungen und Musik ersetzt wird, was die Unzulänglichkeit des Wortes betont.
Welchen Einfluss hatte die Psychoanalyse auf das Werk?
Hofmannsthal war von den Theorien Freuds geprägt, was sich in der Darstellung der psychischen Abgründe und der traumatischen Fixierung der Charaktere widerspiegelt.
Wie wird das Verhältnis von „Sprache und Tat“ thematisiert?
In Elektra steht das endlose Reden über die Rache im Kontrast zur Unfähigkeit, die Tat selbst auszuführen, bis die Sprache schließlich in der finalen Katastrophe untergeht.
Was ist die Bedeutung von Hofmannsthals „Ein Brief“ (Chandos-Brief) für diese Arbeit?
Der „Chandos-Brief“ gilt als das Schlüsselzeugnis für die Sprachkrise der Moderne und liefert den theoretischen Hintergrund für die Analyse der Sprachskepsis in seinen dramatischen Werken.
- Quote paper
- Simon Haas (Author), 2020, Die Sprachskepsis in Hugo von Hofmannsthals und Richard Strauss' "Elektra". Die antike Mythologie in der Literatur der Jahrhundertwende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119235