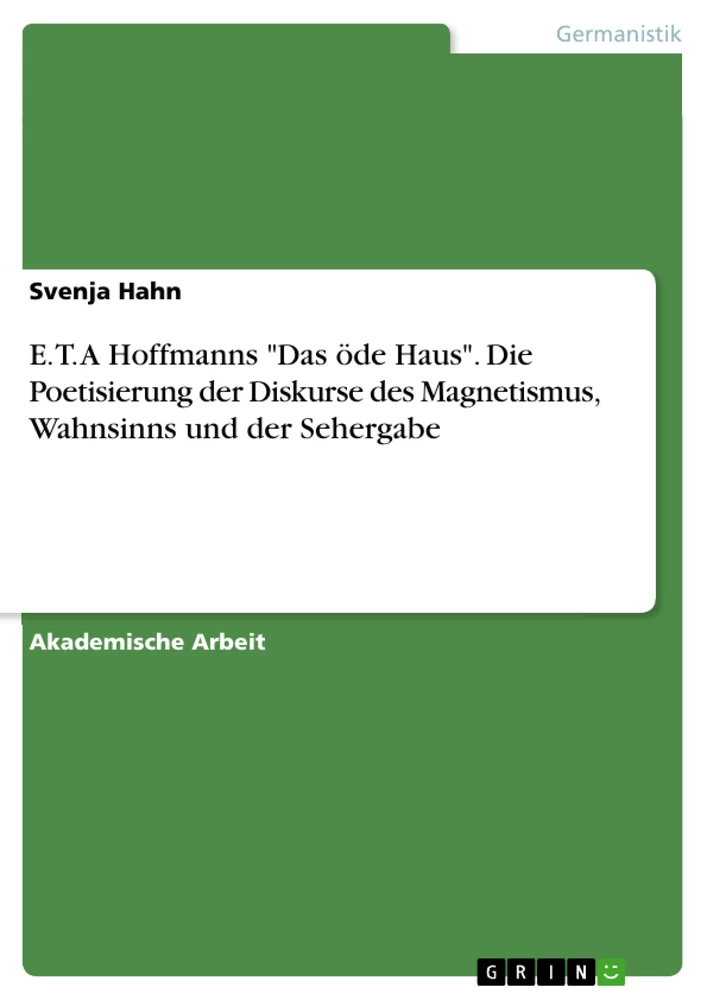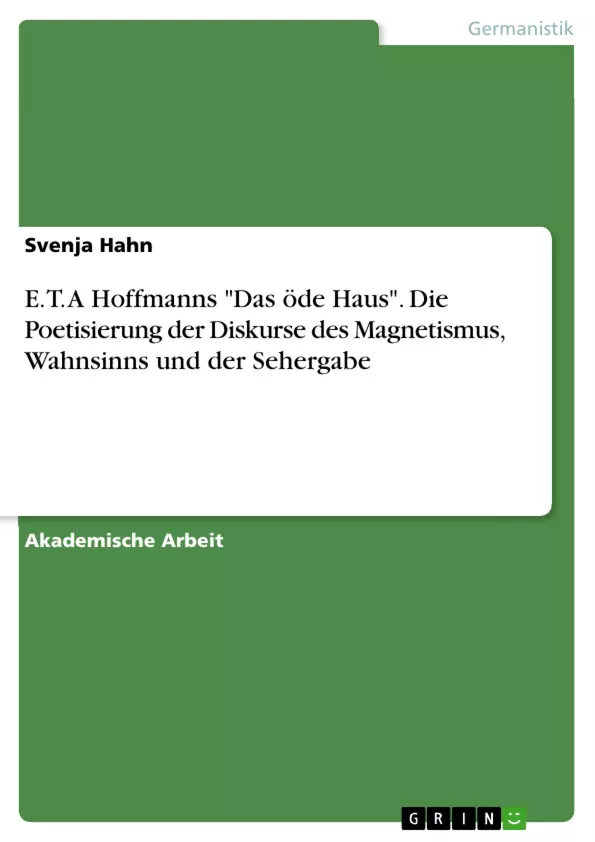In dieser Arbeit sollen die Diskurse Magnetismus, Wahnsinn und Sehergabe historisch skizziert und in der Erzählung "Das öde Haus" verortet werden. Als E.T.A Hoffmann zwischen Herbst 1816 und Frühjahr 1817 den zweiten Teil der Nachtstücke veröffentlichte, befanden sich sowohl die Naturwissenschaften als auch die Künste in einer erkenntnistheoretischen Krise.
Ende des achtzehnten Jahrhunderts gelangte man zu der Einsicht, dass die epistemischen Mittel der Aufklärung keine adäquate Beschreibung der Wirklichkeit darstellten und es stattdessen einer Rückbesinnung auf die subjektive Bedingtheit der Wahrnehmung bedarf.
Die Tatsache, dass das von Hoffmann veröffentlichte Nachtstück "Das öde Haus" symptomatisch für diese Dynamik in den Künsten und Wissenschaften um 1800 ist, zeigen die dort verarbeiteten Diskurse.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Einblick in die zeitgenössischen Diskurse: Magnetismus, Wahnsinn und Sehergabe
- Der animalische Magnetismus nach Mesmer
- Von Geisteszerrüttungen und fixen Ideen
- Das öde Haus als Poetisierung der Diskurse
- Theodor als Spalanzanische Fledermaus
- Zwischen magnetischem Rapport und somnambulen Zustand
- Theodors fixe Idee
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert E.T.A. Hoffmanns „Das öde Haus“ im Kontext der romantischen Wissenspoetik und erforscht die darin verarbeiteten Diskurse um Magnetismus, Wahnsinn und Sehergabe. Dabei wird untersucht, wie Hoffmanns Poetisierung dieser Diskurse eine neue Perspektive und Ausrichtung auf die Bereiche Medizin und Wahrnehmungstheorie eröffnet.
- Die romantische Wissenspoetik und ihre Ausweitung der Erkenntniskanäle durch Phantasie und Einbildungskraft.
- Der Einfluss der Naturphilosophie auf die Entwicklung alternativer Sichtweisen auf Krankheit und Gesundheit.
- Die Rolle des Mesmerismus und der "fixen Idee" in der romantischen Medizin.
- Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft durch die Poetisierung zeitgenössischer Diskurse.
- Die literarische Verhandlung der Grenzen und Potenziale der menschlichen Wahrnehmung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung stellt den historischen und erkenntnistheoretischen Kontext von Hoffmanns „Das öde Haus“ vor. Sie beleuchtet die Krise der Aufklärungsphilosophie und den Aufstieg der romantischen Wissenspoetik, die Phantasie und Einbildungskraft als gleichwertige Erkenntniskanäle einbezog. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der romantischen Medizin und ihren Diskursen um Wahnsinn und Mesmerismus geschenkt.
- Einblick in die zeitgenössischen Diskurse: Dieses Kapitel erläutert die historischen Grundlagen des animalischen Magnetismus nach Mesmer und Reils Theorie der "fixen Idee". Der Fokus liegt auf der Beschreibung der magnetischen Therapie, den zentralen Elementen des Somnambulismus und dem Konzept des "sechsten Sinnes", welches durch Spallanzanis Experimente mit Fledermäusen inspiriert wurde.
- Das öde Haus als Poetisierung der Diskurse: Dieses Kapitel analysiert die literarische Verhandlung der Diskurse um Magnetismus, Wahnsinn und Sehergabe in Hoffmanns "Das öde Haus". Dabei werden die Erfahrungen des Protagonisten Theodor in den Kontext der "Spalanzanischen Fledermaus", des magnetischen Rapports und der "fixen Idee" gesetzt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe des Textes umfassen die romantische Wissenspoetik, die Diskurse um Magnetismus, Wahnsinn und Sehergabe, der Mesmerismus, die "fixe Idee", der Somnambulismus, der "sechste Sinn" und die Poetisierung wissenschaftlicher Diskurse in der Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentralen Diskurse werden in Hoffmanns „Das öde Haus“ analysiert?
Die Arbeit untersucht die Diskurse des animalischen Magnetismus (Mesmerismus), des Wahnsinns und der Sehergabe im Kontext der Erzählung.
Was versteht man unter der romantischen Wissenspoetik?
Es handelt sich um einen Ansatz, der Phantasie und Einbildungskraft als gleichwertige Erkenntniskanäle neben der rationalen Wissenschaft betrachtet, um die Wirklichkeit adäquater zu beschreiben.
Welche Rolle spielt der animalische Magnetismus in der Erzählung?
Der Magnetismus wird als Bindeglied zwischen Medizin und Literatur verstanden, wobei Konzepte wie der „magnetische Rapport“ und der Somnambulismus die Wahrnehmung des Protagonisten Theodor prägen.
Was ist die „fixe Idee“ im Kontext der romantischen Medizin?
Die „fixe Idee“ bezieht sich auf Theorien von Reil und beschreibt eine Form der Geistesstörung, die im Text als psychologischer Zustand des Protagonisten Theodor analysiert wird.
Wie wird die Verbindung von Kunst und Wissenschaft im Text dargestellt?
Durch die Poetisierung wissenschaftlicher Diskurse schafft Hoffmann eine literarische Verhandlung der Grenzen menschlicher Wahrnehmung und medizinischer Theorien um 1800.
- Quote paper
- Svenja Hahn (Author), 2020, E. T. A Hoffmanns "Das öde Haus". Die Poetisierung der Diskurse des Magnetismus, Wahnsinns und der Sehergabe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119242