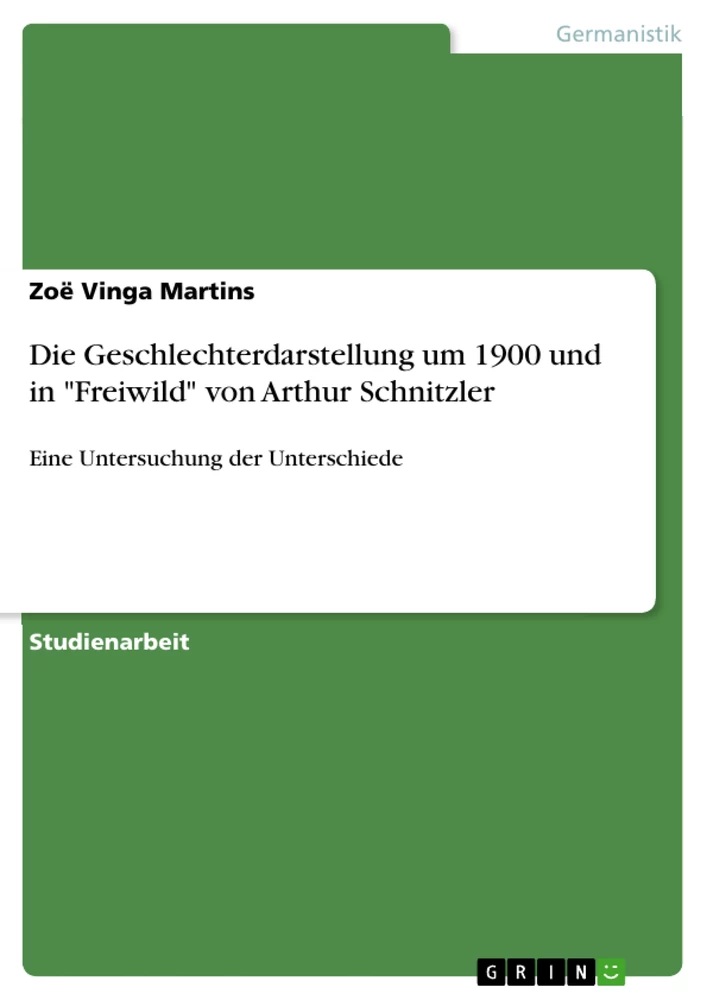Die Arbeit vergleicht Arthur Schnitzlers Geschlechterdarstellungen in „Freiwild“ mit den Geschlechtervorstellungen seiner Zeit. Inwiefern unterscheidet sich Schnitzlers Darstellung von den damaligen Vorstellungen?
Das folgende Kapitel dieser Arbeit stellt fragmentarisch die Geschlechtervorstellungen um 1900 dar. Neben einem Unterkapitel zu den allgemeinen Geschlechtervorstellungen in der Gesellschaft beinhaltet es ein Unterkapitel zu den Geschlechtervorstellungen in der Literatur, um die Strömung dieser Zeit zu erfassen. Ein weiteres Unterkapitel skizziert die Geschlechtervorstellungen speziell im Theater, da dieses den Schauplatz in „Freiwild“ darstellt. Nach dem die Grundlage der Arbeit gebildet ist, skizziert sie zunächst allgemein die literarische Arbeit Schnitzlers. Im Anschluss stellt das Kapitel exemplarisch die Geschlechterdarstellungen in „Freiwild“ vor und setzt sie in einen Zusammenhang mit den Ergebnissen aus dem zweiten Kapitel.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschlechtervorstellungen um 1900.
- 2.1 Geschlechtervorstellungen in der Gesellschaft
- 2.2 Geschlechtervorstellungen in der Literatur.
- 2.3 Geschlechtervorstellungen im Theater
- 3. „Freiwild“ als Spiegel zeitgenössischer Geschlechtervorstellungen
- 3.1 Schnitzlers Werke als kritische Analyse seiner Zeit
- 3.2 Geschlechterdarstellung in Schnitzlers „Freiwild“.
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Geschlechtervorstellungen zur Zeit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert und setzt sie in Beziehung zu Arthur Schnitzlers Dramenwerk „Freiwild“. Sie zielt darauf ab, die Darstellung von Mann und Frau in Schnitzlers Werk mit den vorherrschenden Geschlechtervorstellungen seiner Zeit zu vergleichen.
- Geschlechterrollen und -vorstellungen um 1900
- Männlichkeit und Weiblichkeit als soziale Konstrukte
- Kritik an traditionellen Geschlechterrollen in der Literatur
- Die Darstellung von Geschlechterverhältnissen im Theater
- Arthur Schnitzlers Werk „Freiwild“ als Spiegel seiner Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Bedeutung der Auseinandersetzung mit Geschlechtervorstellungen im Laufe der Menschheitsgeschichte dar. Die Arbeit verwendet Arthur Schnitzlers „Freiwild“ als Medium, um den Geist der Jahrhundertwende zu erfassen.
Kapitel 2 widmet sich den Geschlechtervorstellungen um 1900. Es beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung von Mann und Frau und erörtert, wie diese in der Literatur und im Theater zum Ausdruck kamen.
Kapitel 3 analysiert die Geschlechterdarstellung in Schnitzlers „Freiwild“ und setzt diese in den Kontext der im zweiten Kapitel vorgestellten Geschlechtervorstellungen.
Schlüsselwörter
Geschlechtervorstellungen, Jahrhundertwende, fin de siècle, Dekadentismus, Arthur Schnitzler, „Freiwild“, Theater, Literatur, Gesellschaft, Mann, Frau, Rollenbilder, soziale Konstrukte, Kritik, Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Schwerpunkt setzt die Arbeit zu Arthur Schnitzlers „Freiwild“?
Die Arbeit vergleicht Schnitzlers Darstellung von Geschlechterrollen in seinem Drama „Freiwild“ mit den realen gesellschaftlichen Vorstellungen um das Jahr 1900.
Wie war die Geschlechterdarstellung im Theater um 1900 geprägt?
Das Theater diente als Schauplatz für zeitgenössische Geschlechtervorstellungen, die in der Arbeit fragmentarisch skizziert werden, um die Strömungen des Fin de Siècle zu erfassen.
Wird Schnitzlers Werk als Kritik an seiner Zeit verstanden?
Ja, die Analyse untersucht, inwiefern Schnitzlers Werke als kritische Analyse der sozialen Konstrukte von Männlichkeit und Weiblichkeit seiner Zeit fungieren.
Welche Rolle spielen soziale Konstrukte in dieser Analyse?
Männlichkeit und Weiblichkeit werden als soziale Konstrukte betrachtet, die durch literarische und theatrale Darstellungen gefestigt oder hinterfragt wurden.
Welche Schlüsselbegriffe sind für die Arbeit zentral?
Zentrale Begriffe sind Jahrhundertwende, Fin de Siècle, Dekadentismus, Rollenbilder und Arthur Schnitzler.
- Citar trabajo
- Zoë Vinga Martins (Autor), 2019, Die Geschlechterdarstellung um 1900 und in "Freiwild" von Arthur Schnitzler, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119768