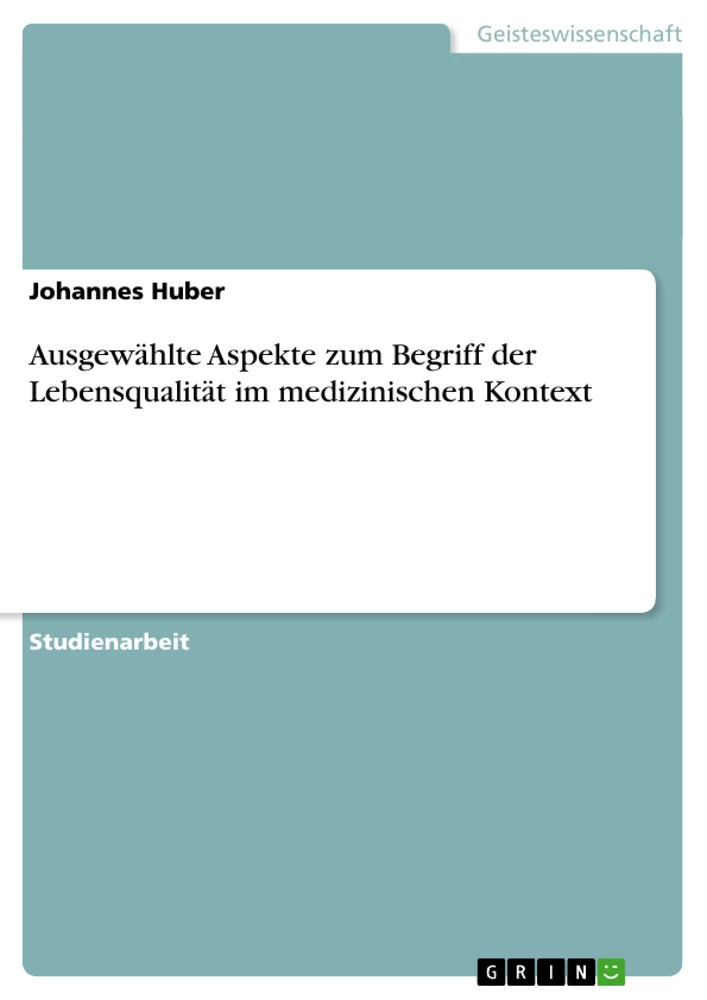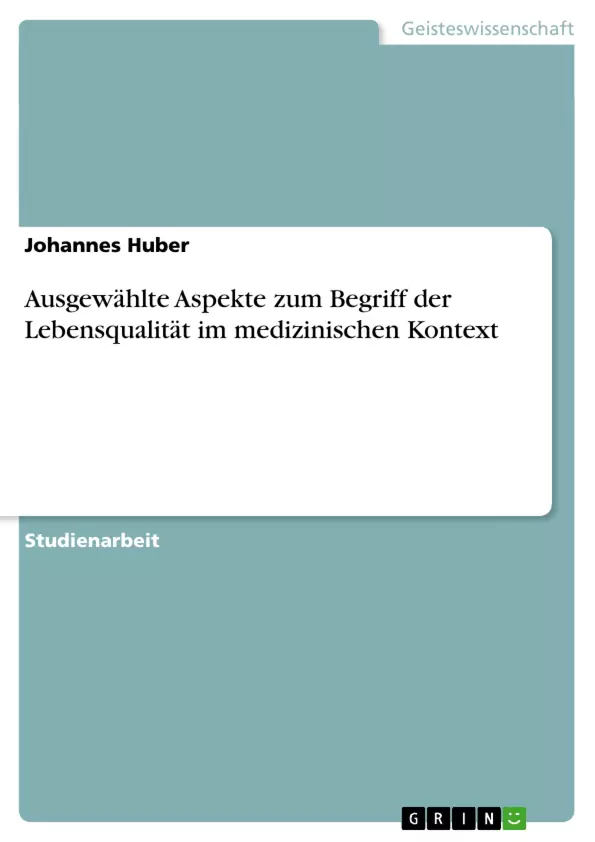Die subjektive Beurteilung der eigenen Lage durch den Patienten und das Wohlbefinden – nicht nur im Bezug auf die Symptome seiner Erkrankung – haben in der medizinischen Versorgung während der letzten Jahre deutlich an Bedeutung zugenommen. Zwar waren sie schon immer Richtwerte ärztlichen Handelns, aber erst in jüngerer Zeit wurden diese Parameter explizit als Zielkriterium definiert und in Abhängigkeit von verschiedenen Therapieoptionen evaluiert. Gefördert wurde diese Entwicklung sicherlich durch die Etablierung der „Evidence-based Medicine“, da dieser Ansatz objektivierbare Therapieergebnisse fordert.
Eine prägnante und allgemeingültige Definition muss an der begriffsimmanenten Subjektivität von ‚Lebensqualität‘ scheitern. Dieses Konstrukt ist nur ganz individuell beschreib- und messbar; abhängig ist es unter anderem von gegenwärtigen Lebensgewohnheiten, bisherigen Erfahrungen, Hoffnungen, Träumen und Wünschen. Ein möglicher Ansatz zur Messung dieser komplexen Entität besteht darin, die Differenz zwischen Hoffnungen und Erwartungen einer Person und dem momentanen Erleben zu bestimmen. Jedoch auch diese Konzeption kann keine generelle Gültigkeit besitzen.
Inhaltsverzeichnis
A. Etablierung der Palliativmedizin als Indikator für die gestiegene Bedeutung des Konstruktes Lebensqualität
B. Lebensqualität im medizinischen Kontext:
1 Kontextabhängigkeit von Lebensqualität – Annäherung an einen multidimensionalen Begriff
1.1 Subjektive und objektive Aspekte
1.2 Begriffsstruktur und Messbarkeit
2 Bedeutung von Spiritualität in der medizinischen Lebensqualitätsforschung
2.1 Definition von Spiritualität im Kontext der Onkologie
2.2 Argumente für die Relevanz des Faktors Spiritualität
3 Kritische Bewertung und Ausblick
C. Implikationen für die ärztliche Praxis
Literaturverzeichnis
„ Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit: Auch Patienten mit einigen Gebrechen können sich beträchtlicher Gesundheit erfreuen.“[1]
A. Etablierung der Palliativmedizin als Indikator für die gestiegene Bedeutung des Konstruktes Lebensqualität
Die Konfrontation mit einer schweren zum Tode führenden Erkrankung stellt für den betroffenen Patienten eine ungeheuere Belastung dar. Aber auch der behandelnden Arzt sieht sich mit einem überwältigenden und lähmenden Gefühl der Ohnmacht konfrontiert sobald keine kurative Therapie mehr möglich scheint. In dieser Situation herrschte lange Zeit zumindest implizit die Auffassung vor man könne „nichts mehr tun“ außer vielleicht die Schmerzen und andere belastende Symptome zu lindern.
Da eine Heilung nicht mehr herbeizuführen ist, muss für ein konstruktives ärztliches Handeln eine messbare Zielgröße definiert werden, die inhaltlich über reine Symptomkontrolle hinausgeht und den verschiedenen Bedürfnissen Schwerstkranker gerecht wird. Das mehrdimensionale Konstrukt der Lebensqualität hat sich hierbei bewährt und bildet deshalb das Kernelement in der WHO-Definition der Palliativen Medizin: „Palliativmedizin dient der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind. Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung von Leiden mittels frühzeitiger Erkennung, tadelloser Beurteilung und Behandlung von Schmerzen und anderen Problemen physischer, psychosozialer und spiritueller Natur.“[2]
Die zunehmende Etablierung und Institutionalisierung der Palliativmedizin während der letzten Jahre kann somit als Indikator für die zunehmende Akzeptanz der Lebensqualitätsforschung innerhalb der Medizin gelten und bekräftigt auch im Hinblick auf die klinische Tätigkeit die Notwendigkeit einer eingehenden Beschäftigung mit diesem Konzept.
B. Lebensqualität im medizinischen Kontext
Die subjektive Beurteilung der eigenen Lage durch den Patienten und das Wohlbefinden – nicht nur im Bezug auf die Symptome seiner Erkrankung – haben in der medizinischen Versorgung während der letzten Jahre deutlich an Bedeutung zugenommen. Zwar waren sie schon immer Richtwerte ärztlichen Handelns, aber erst in jüngerer Zeit wurden diese Parameter explizit als Zielkriterium definiert und in Abhängigkeit von verschiedenen Therapieoptionen evaluiert. Gefördert wurde diese Entwicklung sicherlich durch die Etablierung der „Evidence-based Medicine“[3], da dieser Ansatz objektivierbare Therapieergebnisse fordert.
Eine prägnante und allgemeingültige Definition muss an der begriffsimmanenten Subjektivität von ‚Lebensqualität‘ scheitern. Dieses Konstrukt ist nur ganz individuell beschreib- und messbar; abhängig ist es unter anderem von gegenwärtigen Lebensgewohnheiten, bisherigen Erfahrungen, Hoffnungen, Träumen und Wünschen. Ein möglicher Ansatz zur Messung dieser komplexen Entität besteht darin, die Differenz zwischen Hoffnungen und Erwartungen einer Person und dem momentanen Erleben zu bestimmen.[4] Der Unterschied zwischen Hoffnung und Realität kann als guter Indikator für Lebensqualität dienen; dieser Ansatz besitzt aber keine generelle Gültigkeit[5], wie sich im Folgenden zeigen wird.
1 Kontextabhängigkeit von Lebensqualität – Annäherung an einen multidimensionalen Begriff
Die erste Intuition lässt bei Patienten mit infauster Prognose und vielen offensichtlich erkennbaren krankheitsbedingten Einschränkungen fast zwingend eine starke Einschränkung der Lebensqualität vermuten; es würde also eine große Kluft zwischen Hoffnung und erlebter Wirklichkeit bestehen.
Diese teilweise immer noch weitverbreitete Auffassung konnte die Lebensqualitätsforschung jedoch eindrucksvoll mit der Beschreibung des Zufriedenheitsparadoxes widerlegen. Es ist in der medizinischen Lebensqualitätsforschung definiert als das kontraintuitive Phänomen, „dass sich objektiv negative Lebensumstände bzw. Gesundheitsaspekte in viel geringerem Ausmaß in der subjektiven Bewertung des eigenen Lebens widerspiegeln (...) als es der Außenstehende einschätzen würde.“[6] Darunter versteht man also die empirische Erkenntnis, dass die subjektive Selbsteinschätzung des psychologischen Konstruktes Lebensqualität nur zu einem unerwartet kleinen Teil von objektiven Faktoren beeinflusst zu sein scheint. Paradox ist diese Beobachtung, da sie der Intuition widerspricht.
Für die Palliative Medizin stellt dieses Phänomen jedoch einen sehr hilfreichen Umstand dar, denn es ist eine wesentliche Voraussetzung für das Erreichen einer guten Lebensqualität bei schwerkranken Menschen; pointiert könnte man es wohl als Bedingung der Möglichkeit einer wirklich erfolgreichen palliativen Therapie charakterisieren. Zugleich verdeutlicht es in eindrucksvoller Weise die starke Kontextabhängigkeit von Lebensqualität: Durch eine Veränderung äußerer Umstände wird das Bezugssystem für die Bewertung der subjektiven Lebensqualität deutlich verschoben. Deshalb muss an die Stelle eines statischen Verständnisses von Lebensqualität eine jeweils angepasste Variation desselben weit gefassten Grundkonzeptes treten.
1.1 Subjektive und objektive Aspekte
Die Unterscheidung einer subjektiven von einer objektiven Lebensqualität wird diesem Umstand gerecht. Dan Brock identifiziert in theoretischen Voraussetzungen und in der praktischen Umsetzung Bereiche, in denen diese Abgrenzung von besonderer Bedeutung ist und schafft damit zugleich eine weitere inhaltliche Annäherung an den Begriff der Lebensqualität:
Die Notwendigkeit einer Differenzierung zeigt sich bereits bei den drei großen philosophischen Theorien, die einen Zugang zu der komplexen Frage nach dem „guten Leben“ versuchen. Subjektiv orientiert sind der Hedonismus und Ansätze, welche die Lebensqualität nach der Befriedigung individueller Bedürfnisse bemessen. Denn das werthafte, bewusste Glückserleben ist genau so subjektiv, wie die selbstgewählten Präferenzen. Eine höhere Gewichtung der objektiven Perspektive vertritt hingegen die idealistische Theorie; in dieser sind bestimmte vom Subjekt unabhängige Werte wesentlich bedeutsamer für das „gute Leben“ als individuelle Wünsche.[7] Ein Teil der Lebensqualität ließe sich demnach nur anhand der Realisierung spezifischer, normativer Ideale bemessen.
Wie bedeutsam die Unterscheidung subjektiver und objektiver Aspekte ist zeigt sich auch daran, dass sie bei konkreten Fragestellungen aus anderen Bereichen der Medizinethik thematisiert wird. Ist ein Patient beispielsweise nicht mehr fähig, selbst für sich zu entscheiden, und ist keine gültige Patientenverfügung vorhanden, so existieren grundsätzlich zwei Prinzipien der Entscheidungsfindung: Ein Handeln im vermuteten Sinne des Patienten würde den subjektiven Überzeugungen der Person Rechnung tragen. Ein Vorgehen, das den Interessen des Patienten am besten nützt, ohne die subjektiven Wünsche und Vorstellungen mit einzubeziehen, setzt gültige objektive Kriterien voraus.
[...]
[1] Breslow: From disease prevention to health promotion, S.1030
[2] Johnston: The WHO objectives for palliative care
[3] Berger et al.: Evidence-based Medicine. Eine Medizin auf rationaler Grundlage
[4] Calman: Quality of life in cancer patients – an hypothesis, S.124f.
[5] Cribb: Quality of life - A response to K. C. Calman, S.143
[6] Herschbach: Das „Zufriedenheitsparadox“ in der Lebensqualitätsforschung, S.148
[7] Brock: Quality of life measures in health care and medical ethics, S.97
- Quote paper
- Johannes Huber (Author), 2004, Ausgewählte Aspekte zum Begriff der Lebensqualität im medizinischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111980