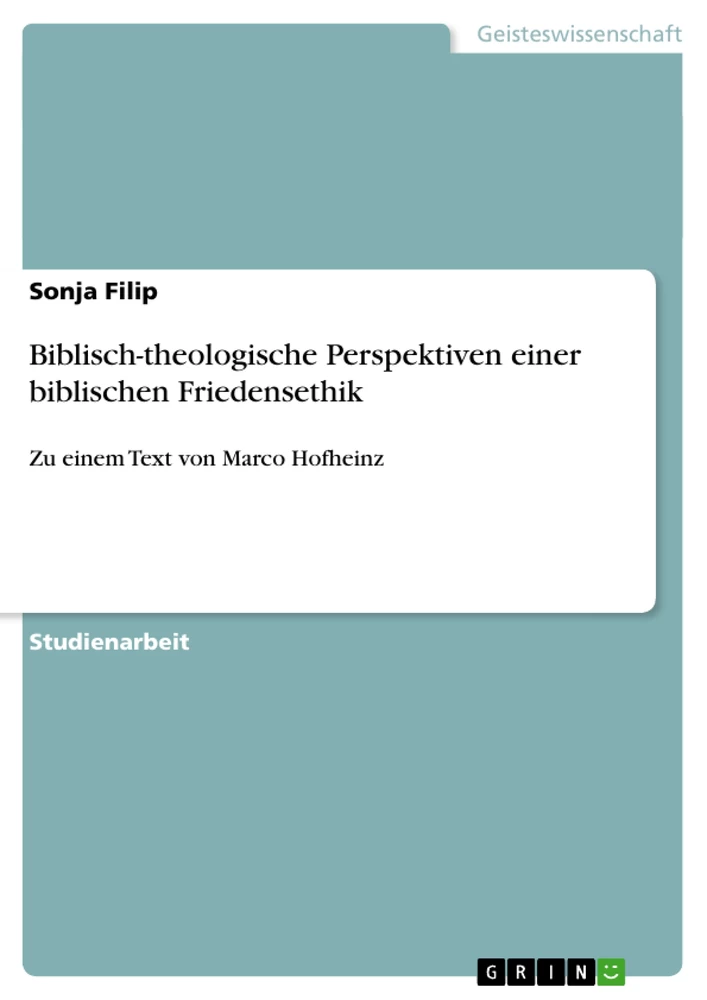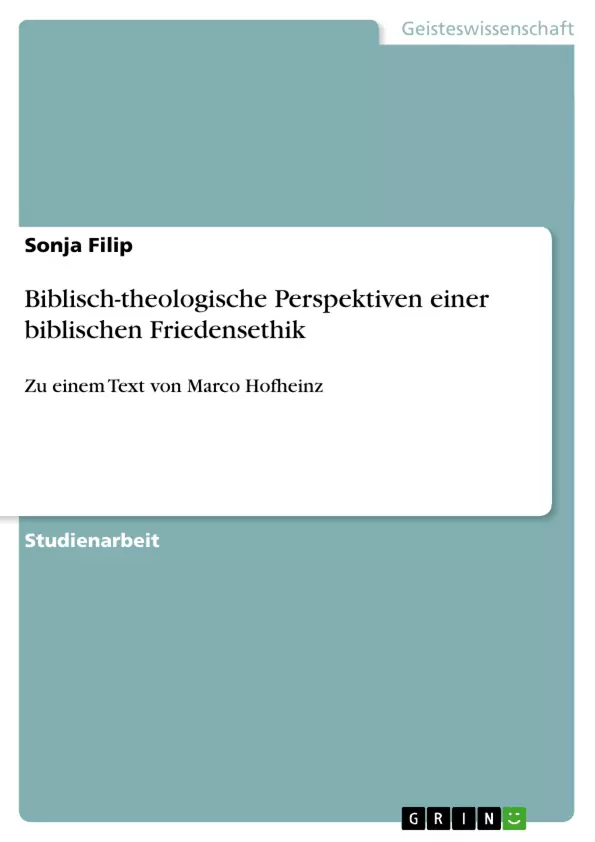Die zentrale Frage, der Marco Hofheinz in seinem Text nachgehen will, ist die folgende: „Friedenstiften – wie macht man das?“ (378)1 Hiermit weist er hin auf die Ohnmachtstellung der Christen in der heutigen Zeit, die nicht die politische Macht(postition) haben, um in einem größeren, nationalen oder internationalen Rahmen Friedenspolitik betreiben zu können, sondern in ihren Gemeinden und in ihrem unmittelbaren Alltag „effektiven Friedensdienst“ (378) leisten wollen. Hofheinz weist darauf hin, dass hierbei keine Hilfe durch Predigten zu erwarten sei, da diese die konkreten Mittel zum Friedenstiften vermissen lassen.
Da er die Meinung vertritt, dass eine Entfaltung der Friedensethik nicht ohne Rückgriff auf die hierzu relevanten Bibelstellen denkbar ist, da ein christlicher Mensch in der Gemeinde ein vom Hören des Wortes Gottes geprägtes Leben führt, so möchte er diesen Bezug zu Bibeltexten herstellen. Hierbei beschränkt er sich auf das Neue Testament, jedoch nicht ohne Hinweis auf die hermeneutische Prämisse, dass die christliche Lebensform einer Gemeinde unmittelbar mit ihrem Ort in der Gottesgeschichte verknüpft sei und die Lebensform einer Gemeinde ohne diese Geschichte nicht gewonnen werden könne.
Er verortet die Friedensethik explizit im Rahmen einer kirchlichen Ethik, denn „die Kirche [hat] keine Sozialethik; die Kirche ‚ist‘ eine Sozialethik“2, ist also nicht nur Reflexion und Begründung, sondern Ausprägung einer Lebensform. Die herausragende Rolle des Begriffs des Friedens zeigt sich auch an der 92fachen Verwendung dieses Begriffs im Neuen Testament, vor allem in den Evangelien, was auf eine enge Verbindung des Begriffs mit dem Werk und Leben Jesu Christi hinweist.
Die Zielsetzung seines Textes ist einerseits die Entfaltung biblischer Impulse zum Friedensstiften durch Betrachtung dreier biblischen Textpassagen, die helfen sollen, die sich in der Gegenwart bietenden Verhaltensoptionen in biblische Perspektiven zu rücken und dadurch einen Gewinn für ethisches Handeln heute zu erzielen (jedoch ohne auf konkrete Handlungsmöglichkeiten zu verweisen). Andererseits will er die Praxis des Bibellesens als integralen Bestandteil der Ethik, also nicht als meta- oder vorethisch, darstellen.
Inhaltsverzeichnis
1 Vor- und Überblicksbemerkungen
1.2 Untersuchung dreier Bibelstellen
2.1 Kol 1, 20 – Gottes Frieden gelten lassen
2.2 Mt 5,9 – Friedenskirche sein
2.3 Jak 3,18 – Zusammenhang von Frieden und Gerechtigkeit
3 Friedensethische Relevanz des gemeinsamen Bibellesens
4 Literaturverzeichnis
4.1 Primärtext
4.2 Weitere Quellen
1 Vor- und Überblicksbemerkungen
Die zentrale Frage, der Marco Hofheinz in seinem Text nachgehen will, ist die folgende: „Friedenstiften – wie macht man das?“ (378)[1] Hiermit weist er hin auf die Ohnmachtstellung der Christen in der heutigen Zeit, die nicht die politische Macht(postition) haben, um in einem größeren, nationalen oder internationalen Rahmen Friedenspolitik betreiben zu können, sondern in ihren Gemeinden und in ihrem unmittelbaren Alltag „effektiven Friedensdienst“ (378) leisten wollen. Hofheinz weist darauf hin, dass hierbei keine Hilfe durch Predigten zu erwarten sei, da diese die konkreten Mittel zum Friedenstiften vermissen lassen.
Da er die Meinung vertritt, dass eine Entfaltung der Friedensethik nicht ohne Rückgriff auf die hierzu relevanten Bibelstellen denkbar ist, da ein christlicher Mensch in der Gemeinde ein vom Hören des Wortes Gottes geprägtes Leben führt, so möchte er diesen Bezug zu Bibeltexten herstellen. Hierbei beschränkt er sich auf das Neue Testament, jedoch nicht ohne Hinweis auf die hermeneutische Prämisse, dass die christliche Lebensform einer Gemeinde unmittelbar mit ihrem Ort in der Gottesgeschichte verknüpft sei und die Lebensform einer Gemeinde ohne diese Geschichte nicht gewonnen werden könne.
Er verortet die Friedensethik explizit im Rahmen einer kirchlichen Ethik, denn „die Kirche [hat] keine Sozialethik; die Kirche ‚ist‘ eine Sozialethik“[2], ist also nicht nur Reflexion und Begründung, sondern Ausprägung einer Lebensform. Die herausragende Rolle des Begriffs des Friedens zeigt sich auch an der 92fachen Verwendung dieses Begriffs im Neuen Testament, vor allem in den Evangelien, was auf eine enge Verbindung des Begriffs mit dem Werk und Leben Jesu Christi hinweist.
Die Zielsetzung seines Textes ist einerseits die Entfaltung biblischer Impulse zum Friedensstiften durch Betrachtung dreier biblischen Textpassagen, die helfen sollen, die sich in der Gegenwart bietenden Verhaltensoptionen in biblische Perspektiven zu rücken und dadurch einen Gewinn für ethisches Handeln heute zu erzielen (jedoch ohne auf konkrete Handlungsmöglichkeiten zu verweisen). Andererseits will er die Praxis des Bibellesens als integralen Bestandteil der Ethik, also nicht als meta- oder vorethisch, darstellen.
2 Untersuchung dreier Bibelstellen
2.1 Kol 1, 20 – Gottes Frieden gelten lassen
18 Und er [Jesus Christus] ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. 19 Denn es gefiel Gott, daß in ihm alle Fülle wohnen sollte 20 und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst (dadurch daß er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes) durch ihn, sowohl was im Himmel, als auch was auf Erden ist. [3]
Der Kolosserhymnus kann als Lobgesang auf Christus als Versöhner der gesamten Schöpfung gelten, der den vorherigen Bruch zwischen Himmel und Erde aufgehoben hat und somit durch sein Handeln die Einheit der himmlischen und der irdischen Welt wiederhergestellt hat. Durch diese Einheit wird die Universalität des Friedens Gottes betont – dementsprechend zieht die Versöhnung mit Gott die Versöhnung der Menschen untereinander nach sich.
Interessant ist, wie der Vorgang der Versöhnung dargestellt wird, nämlich als bereits abgeschlossen („dadurch, daß er Frieden machte“), der gestiftete Frieden ist also nichts Zukünftiges, sondern er ist vielmehr schon in Kraft. „Frieden stiften heißt also: Gottes Frieden gelten lassen.“ (384)
Betrachtet man diese Untersuchung der Bibelstelle kritisch, so könnte man Marco Hofheinz zwei Fragen stellen. Die erste Anfrage wäre, ob das bloße Geltenlassen des Friedens Gottes wirklich eine aktive und nicht vielmehr eine passive Handlung ist. Hofheinz spricht hier vom „aktive[n] Sich-in-Gottes-Friedenshandeln-hineinziehen-Lassen“ (385), doch widersprechen sich hier die Begriffe „aktiv“ und „ziehen-lassen“ nicht?
Die zweite Frage wäre die auch von Hofheinz angesprochene Frage der Theodizee, denn es ist leider tagtäglich zu erleben, dass der Streit des Menschen wider den Menschen keinesfalls in Frieden aufgelöst wurde. Dies ist allerdings laut Hofheinz ein Widerspruch des Menschen, denn „[d]er Mensch ist Mensch im Widerspruch“ (384) und das Verhalten des Menschen steht im Gegensatz zum Heilshandeln Gottes. Dementsprechend sei die Theodizee-Frage in Wirklichkeit die Frage nach der Anthropodizee.[4] Kann diese Erklärung den kritischen Leser wirklich überzeugen?
[...]
[1] Die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich auf Marco Hofheinz, Biblisch-theologische Perspektiven einer kirchlichen Friedensethik in: Pastoraltheologie. Monatsschrift für Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft, Jg. 94, Göttingen 2005, S. 378-395.
[2] Zitiert nach Marco Hofheinz aus Stanley Hauerwas, Selig sind die Friedfertigen. Ein Entwurf christlicher Ethik, Neukirchen-Vluyn 1995, S. 159.
[3] Alle Bibelzitate nach der Genfer Studienbibel mit dem Text von Franz Eugen Schlachter, Genf 1951.
[4] Vgl. Hofheinz, S. 385.
- Quote paper
- Sonja Filip (Author), 2008, Biblisch-theologische Perspektiven einer biblischen Friedensethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111985