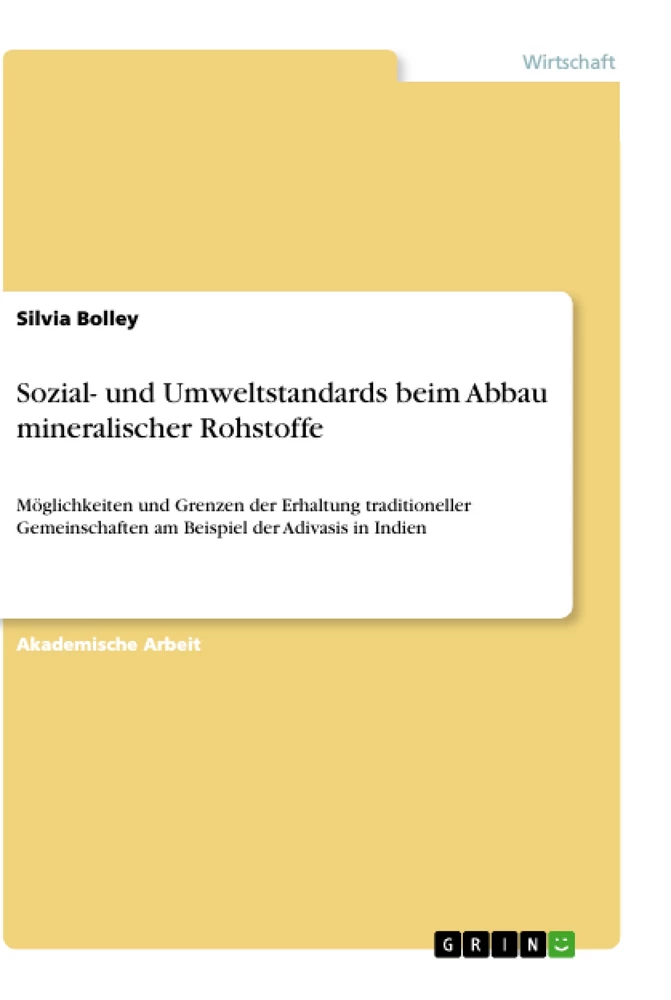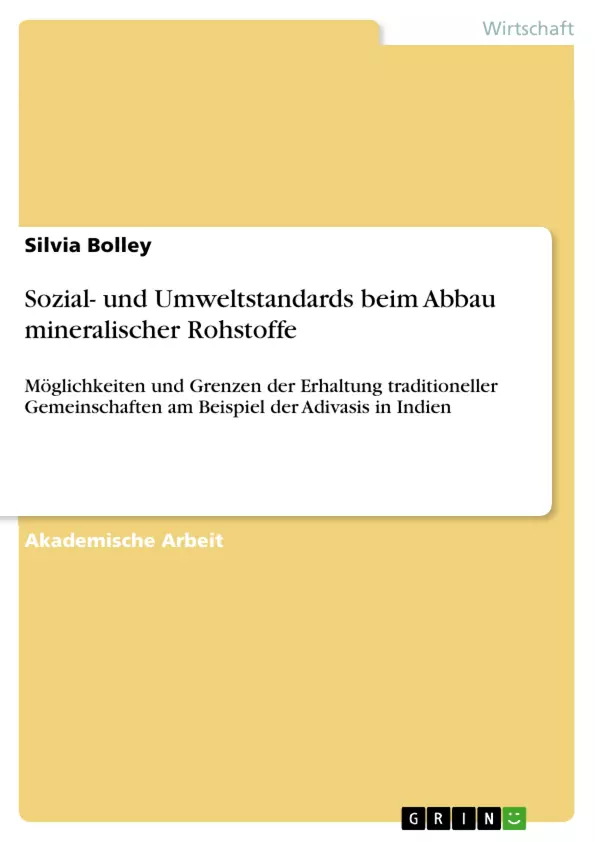Oft kommt es zu gewaltsamen Konflikten zwischen Regierung und Konzernen einerseits und verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf der anderen Seite. So hat sich der Begriff Ressourcenfluch in den letzten Jahren etabliert, um auszudrücken, dass Rohstoffreichtum einem Land nicht unbedingt zu Wohlstand und friedlichem Zusammenleben verhilft.
In dieser Arbeit möchte ich die oben geschilderte Entwicklung am Beispiel der Indigenen Indiens, den Adivasis, die im rohstoffreichen, sogenannten „Tribal Belt“ leben, darstellen. Es stellt sich die Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die mannigfaltigen Menschenrechtsverletzungen und die negativen ökologischen Auswirkungen des Rohstoffabbaus in Indien zu mindern. Ist die Anwendung von Sozial- und Umweltstandards ein geeignetes Instrument dafür, und wo sind dessen Grenzen zu verorten? Zunächst befasse ich mich mit den Merkmalen verschiedener Standards. Es folgt eine Beschreibung der Lebenswelt und besonderen Problematik der Adivasis und anschließend gehe ich den Fragen nach, wie und ob vorhandene Standards den genannten Zielen dienen können. Abschließend beleuchte ich die Rolle der Europäischen Union und Deutschlands in dieser Frage.
1. Einleitung
2. Sozial - und Umweltstandards als LenkungsinstrumentwirtschaftlicherAktivitäten
2.1 Funktionen von Standards
2.2 Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte
2.3 Internationale Sozial- und Umweltstandards
3. Beschreibung der Lebenswelt derAdivasis
3.1 Historische Entwicklung
3.2 Adivasi: geographische Verbreitung und Mineralienvorkommen
3.3 Rechtliche Situation derAdivasis
3.4 Ressourcenabbau, Landvertreibung und Nutzungskonflikte
4. Möglichkeiten und Grenzen derAnwendung von Standards zur Erhaltung der Lebenswelten derAdivasis
4.1 Aufbau zertifizierter Handelsketten
4.2 Möglichkeiten der Einflussnahme der deutschen Bundesregierung und der Europäischen Union (EU)
5. Fazit
Möglichkeiten und Grenzen der Erhaltung traditioneller Gemeinschaften durch Anwendung von Sozial- und Umweltstandards beim Abbau von mi- neralischen Rohstoffen am Beispiel derAdivasis in Indien
Abgabedatum: 27.3.17
Möglichkeiten und Grenzen der Erhaltung traditioneller Gemeinschaften durch Anwendung von Sozial- und Umweltstandards beim Abbau von mineralischen Rohstoffen am Beispiel derAdivasis in Indien
1. Einleitung
Mineralische Rohstoffe sind nicht unbegrenzt verfügbar. Sie sind nicht abzubauen ohne erhebliche Eingriffe in die Umwelt. Bei vielen Rohstoffen erhöhte sich die Angabe der statischen Reichweite in den letzten Jahren. Aber auch die Nachfrage ist gestiegen. So werden in Mobiltelephonen über 40, in einem Computer rund 60 verschiedene Rohstoffe verbaut.1 Seit 2003 bis 2008 kam es zu hohen Preissteigerungsraten an den Rohstoffmärkten.2 Trotzdem diese Entwicklung rückläufig ist, sind die Preise für Rohstoffe, die in Wachstumsindustrien eingesetzt werden, ansteigend, da Länderwie China und Indien zum „Motor globalen Wirtschaftswachstums“3 geworden sind. Viele Länder des globalen Südens setzen deshalb verstärkt auf die Ausbeutung ihrer mineralischen Ressourcen. Neue Regionen werden für den Abbau erschlossen sowie zusätzliche Abbaulizenzen vergeben. Damit gehen oft Menschenrechtsverletzungen sowie massive Umweltschäden einher. Die Menschen vor Ort erleben zu oft eine massive Verschlechterung ihrerökologischen und ökonomischen Situation. In vielen Ländern wächst deshalb der Widerstand gegen den Bergbau. Oft kommt es zu gewaltsamen Konflikten zwischen Regierung und Konzernen einerseits und verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf der anderen Seite.4 So hat sich der Begriff Ressourcenfluch in den letzten Jahren etabliert um auszudrücken, dass Rohstoffreichtum einem Land nicht unbedingt zu Wohlstand und friedlichem Zusammenleben verhilft.
In dieserArbeit möchte ich die oben geschilderte Entwicklung am Beispiel der Indigenen Indiens, den Adivasis, die im rohstoffreichen, sogenannten „Tribal Belt“ leben, darstellen. Es stellt sich die Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die mannigfaltigen Menschenrechtsverletzungen und die negativen ökologischen Auswirkungen des Rohstoffabbaus in Indien zu mindern. Ist die Anwendung von Sozial- und Umweltstandards ein geeignetes Instrument dafür, und wo sind dessen Grenzen zu verorten? Zunächst befasse ich mich mit den Merkmalen verschiedener Standards. Es folgt eine Beschreibung der Lebenswelt und besonderen Problematik derAdivasis und anschließend gehe ich den Fragen nach, wie und ob vorhandene Standards den genannten Zielen dienen können.
Abschließend beleuchte ich die Rolle der Europäischen Union und Deutschlands in dieser Frage.
2. Sozial - und Umweltstandards als Lenkungsinstrumentwirtschaftlicher Aktivitäten
Sozial- und Umweltstandards sind ein Instrument, mit dem wirtschaftliche Unternehmungen in Richtung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit gelenkt werden können und sollen. Der Begriff standard wird auf vielfältige Weise angewandt und bezieht sich auf verschiedene Situationen. Er ist eine auf ein bestimmtes Ziel bezogene Richt- und Messgröße und enthält eine Aufforderung zieladäquaten Handelns an bestimmte Akteure sowie die Mittel, den Zielerreichungsgrad zu messen.5
Zudem haben Sozial- und Umweltstandards eine sehr wichtige Signalfunktion. Sie sollen zu Produktion und Kauf nachhaltiger Produkte motivieren und Lernprozesse in Gang setzen.
Ein Standard kommt durch einen Konsens zustande, dervon einer anerkannten Institution angenommen werden muss. Offen sind in diesem Prozess, wer die Akteure sind, wie sie organisiert sind und auch welcherArt die anerkannte Instanz ist. Der Begriff kann Handlungsformen, Produkte oder Prozesse beschreiben. Sowohl eine qualitative oder eine quantitative Auslegung ist möglich. Man kann unterscheiden zwischen koordinativen Standards, die vor allem Betriebsabläufe sicherstellen oder regulativen Standards, die unternehmerisches Handeln auf bestimmte gesellschaftliche Ziele hin konkretisieren und das Ausmaß negativerexterner Effekte minimieren sollen. Meist erfolgt die Einhaltung eines Standards freiwillig. Allerdings soll er eine normative Funktion erfüllen. Dafür muss er bestimmten Bedingungen genügen: a) Die Bezugsgröße. Es muss klar sein, wer zu einem bestimmten Handeln aufgefordert wird. Ebenso muss beschrieben sein, um welche Produkte oder Prozesse es geht, sollte es sich um einen Produktstandard bzw. Prozessstandard handeln, b) Die Norm. Notwendig ist eine definierte, in nachvollziehbare Schritte unterteilte Beschreibung der Norm bzw. des angestrebten Verhaltens, Ablaufs oder Produktes, c) Der Geltungszeitraum. Je nach Ziel des Standards kann der angestrebte Geltungszeitraum variieren. Daher muss er klar festgelegt werden, d) Die Konformitätsprüfung. Wenn ein Standard beschrieben wird, sollte damit auch das Prüfverfahren geklärt werden. Hier bestehen verschiedene Möglichkeiten. Zunächst ist es möglich eine Eigenprüfung vorzunehmen. Allerdings verspricht die Prüfung durch unabhängige Instanzen die größte Glaubwürdigkeit, e) Die Akkreditierung der Prüfer. Es muss klar sein, welche Zulassung der Zertifizierungsstelle vorliegt. Es gibt internationale Agenturen wie auch Institute auf nationaler Ebene.6 Akteure von Standardisierungsprozessen können Unternehmen, Unternehmensverbände, nationale und auch internationale Nichtregierungsorganisationen, staatliche Instanzen ebenso wie supra- und internationale Organisationen sein. Oft arbeiten verschiedene Akteure mit individueller Zielsetzung zusammen.
2.1 Funktionen von Standards
Schon 1944 hat die International Labour Organisation (ILO) in der berühmten „Philadelphia Erklärung“ auf den besonderen Wert von Arbeit hingewiesen. Es gilt, die Gefahr zu bannen, dass der arbeitende Mensch seine Würde verliert. Der ProduktionsfaktorArbeit ist einerseits effektiv einzusetzen und andererseits darf nie vergessen werden, dass der arbeitende Mensch in seiner Würde nicht zu verletzen ist. Arbeitsverhältnisse, Arbeitsmärkte, Arbeitgeber und Arbeitnehmer stehen permanent vor dieser Herausforderung. Ein sich selbst überlassenerArbeitsmarkt trägt die Gefahr einer Lohnspirale nach unten in sich, da esje nach Arbeitssektor ein Überangebot an Arbeitsuchenden geben kann. Die Organisation des Arbeitsmarktes soll diesen Prozess verhindern. Die Einführung eines Mindestlohnes kann z.B. eine solche Entwicklung steuern. Ebenso kann man generelle Arbeitsbedingungen durch einen Mindeststandard absichern und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen unterbinden. Arbeitsrechtliche und sozialpolitische Mindeststandards helfen dabei. Die humanitär-sozialethische Funktion der internationalen Sozialstandards soll die schlimmsten Auswüchse der Ausbeutung von Arbeitskräften verhindern.7
Durch die Signalfunktion des Standards, dass bestimmte Bedingungen in Produktion und Produkt bzw. Dienstleistung genau definiert sind, erhöht sich die Marktransparenz. Die Kunden können ihre Kaufentscheidung besserfürsich begründen. Allerdings ist diese Transparenz durch die Vielzahl von Labels eingeschränkt. Zudem kann ein umweltfreundliches Produkt auf umweltschädliche Weise hergestellt worden sein. Ein Ökosiegel für diese Ware könnte in einem solchen Fall ein falsches Signal für den Herstellungsprozess sein. Da der Kunde auf die Einhaltung der im Label beschriebenen Bedingungen vertraut, kann das Label nur insofern seine Signalfunktion ausfüllen, als die Pflicht zur Konformitätsprüfung ernst genommen wird und der Verbraucher dadurch in seinem Vertrauen zum Label bestätigt wird.
Sollte ein Unternehmen durch die Einführung eines Standards Erfolg haben, motiviert dies natürlich zur Nachahmung. Unternehmerisches Wertemanagement und ein gemeinsames Leitbild erhöhen die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Nicht zu unterschätzen ist die Lernfunktion eines Standards, wenn z.B. ein Unternehmen die Energiegewinnung umrüstet oder den Betriebsablauf ändert.
2.2. Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte
Für meine Fragestellung ist vor allem die Haltung von Entwicklungs- und Schwellenländern gegenüber Sozial- und Umweltstandards relevant. Dies sind oft die Exportlän- derfür Rohstoffe, die unter schweren Umwelt- und Sozialfolgen abgebaut werden. Durch diese negativen externen Effekte entstehen hohe Kosten, die über die privatwirtschaftlichen Kosten der Güterproduktion hinausgehen. Ein geeigneter Umwelt - oder Sozialstandard soll nun die Internalisierung dieser Kosten veranlassen (z.B. durch den Bau von Filteranlagen, Übernahme von Kosten für Bodenerosion und Wiederaufforstung o.ä.). Da zwar die privaten Kosten höher werden und die Exporte zurückgehen, die sozialen und ökologischen Kosten aber nicht mehr von der Gesellschaft oder einigen betroffenen Gruppen getragen werden müssen, führte ein solcher Standard zur Wohlfahrtsverbesserung (z.B. bessere Luft, bessere Lebensbedingungen...). Allerdings befürchten die Entwicklungsländer Handelshemmnisse, wenn die Industrieländerdie Einhaltung solcher Standards verlangen. Demgemäß wurde in Artikel 12 des „Übereinkommens über technische Handelshemmnisse“ von 2008festgehalten, dass Entwicklungsländer internationale Normen nicht als Grundlage ihrer technischen Vorschriften oder Normen einschließlich Prüfmethoden nehmen müssen.8
2.3 Internationale Sozial- und Umweltstandards
Im folgenden beschreibe ich kurzvierderwichtigsten Standards. Im Bereich internationaler Sozialstandards ist die International Labour Organisation (ILO) der Hauptakteur. Sie ist eine der ältesten internationalen Organisationen und wurde im Verlaufe derVer- saillerVertragsverhandlungen 1919 gegründet. Schon damals strebten die Gewerkschaftsbewegungen der Gründungsstaaten der ILO eine Mindestharmonisierung arbeitsmarktpolitischer und sozialer Standards an.9
Für die Verabschiedung der Standards, die in Empfehlungs- und Übereinkommensstandards unterschieden sind, ist die Internationale Arbeitskonferenz zuständig, die einmal im Jahr in Genf tagt. 187 Mitgliedsländer entsenden je eine vierköpfige Delegation, bestehend aus 2 Regierungsmitgliedern und je einem Vertreter derArbeitgeber- verbände und derGewerkschaften. Die 187 Konventionen, die bisher verabschiedet wurden, sind zur Ratifizierung in den Mitgliedsländern vorgesehen. Die 204 Empfehlungen hingegen sollen konkrete Umsetzungshilfen sein. Viele der Konventionen wurden nurvon wenigen Mitgliedsstaaten ratifiziert. Daher wurde 1998 eine „Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work“ beschlossen, die sich auf einige wenige Standards konzentriert und einen universalen Gültigkeitsanspruch hat. Vor allem das Recht aufVereinigungsfreiheit, das Recht auf Kollektivverhandlungen, die Beseitigung von Zwangs- und Pflichtarbeit sowie von Kinderarbeit gehören zu den wichtigsten Festlegungen. Die Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, die Konventionen in nationales Recht zu integrieren. Die ILO kontrolliert mittels dreier Instrumente die Umsetzung der Standards. Das Überwachungsverfahren, das Klageverfahren und das Beschwerdeverfahren stehen dafürzurVerfügung. Die beschriebenen Verfahren führen zu einer hohen Legitimität der Sozialstandards der ILO.10 Dass die Konventionen 138 und 182, die sich gegen die schlimmsten Formen von Kinderarbeit richten, bishervon Indien nicht unterzeichnet wurden, macht deutlich, wie groß die Hindernisse sind, auf die die Umsetzung dieser Standards stößt.11
Weitere Standards sind der Global Compact (GC), der 1999 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vom Vertreter der United Nations Organisation (UNO) Kofi Anan initiiert wurde und sich auf Menschenrechte, Arbeitsbeziehungen und Umwelt bezieht. Teilnehmende Unternehmen verpflichten sich aufdie Einhaltung von 10 Prinzipien, so u.a. den Schutz und die Förderung international erklärter Menschenrechte sowie die effektive Beendigung der Kinderarbeit. Es besteht ein Handbuch zur Implementierung des GC, sowie Konformitätskontrollen und die Verpflichtung zur regelmäßigen Berichterstattung. Auch die Möglichkeit der Beschwerdeführung ist gegeben.12
Aus der Initiative einer amerikanischen Verbraucherorganisation ging der Standard „Social Accountability 8000“ (SAI) hervor. Der Schutz der Menschenrechte und die Förderung ethisch verantwortlicher Geschäftspolitik sind das Ziel dieser Organisation. Die Einhaltung nationaler Gesetze und Sozialstandards wie auch die gültigen SA 8000 Prinzipien sind Grundlage derVerpflichtungen. Teilnehmende Unternehmen durchlaufen ein Prüfverfahren mittels einer akkreditierten Zertifizierungsagentur und werden so als SA-8000 konform anerkannt. Unter den zertifizierten Unternehmen befindet sich u.a. auch der indische Konzern Tata Steel.13
Auch die Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) hat Leitsätze für multinationale Unternehmen herausgegeben, die Empfehlungen für verantwortliches unternehmerisches Handeln im globalen Kontext beinhalten.14
3. Beschreibung der Lebenswelt derAdivasis
Im Jahr2015 lebten lautWeltbankbericht 1,311 Milliarden Menschen in Indien.15 Davon zählen rund 90 Millionen zu den 698 als „Scheduled Tribes“ registrierten Volksgruppen. Jedoch ist der Hindi/Sanskrit Begriff „Adivasi“ (ursprünglicher Bewohner) die Selbstbezeichnung dieser Bevölkerungsgruppen.16
3.1 Historische Entwicklung
„Die niedrigen Tafelberge im Süden Orissas sind die Heimat der Dongria Kondh gewesen, lange bevor es ein Land namens Indien oder einen Staat namens Orissa gab“.17
Adivasis sind die Nachfahren indischer Ureinwohner, die schon vor der Invasion indogermanischer Hirtenvölker im 2. Jahrtausend vor Christus unterschiedliche Gebiete des heutigen Indien besiedelten. Eine Beschreibung der historischen Entwicklung kann hier nur bruchstückhaft und im groben Überblick geleistet werden. Ab etwa 1500 vor Christus drangen die sich Arya (die Edlen) nennenden Völker aus Zentralasien über den Khyer Pass von Afghanistan in die nordindische Flussebene vor. Ihre von Pferden gezogenen Streitwagen machten sie militärisch überlegen. Im Laufe derJahrhunderte besiedelten sie Gebiete bis zum Golfvon Bengalen. In dieserZeit entstanden die Veden, die ältesten heiligen Hinduschriften, die von zahlreichen Kämpfen mit dunklen Waldbewohnern berichten. Die überlegenen Arya sollen die Waldbewohner versklavt und für niedere Arbeiten eingesetzt haben, sie an den Rändern der Dörfer in Ghettos angesiedelt und durch rituelle Tabus als Unberührbare und niedere Kasten in die herr- sehende Gesellschaftsordnung integriert haben. Sie sind die heutigen Dalits, staatlicherseits als „Scheduled Castes“ registriert. Anderen Gruppen gelang der Rückzug in die Waldgebiete und Gebirge, wo sie bis in die heutige Zeit relativ autonom leben konnten. Diese Gruppen sind die heute als „Scheduled Tribes“ gelisteten Adivasis. Sie können dort autarkAckerbau und Viehzucht betreiben, leben mit starkem Bezug zu Naturgottheiten und betrachten Landbesitz als Kollektivgut. Ihre Wirtschaftsweise ist der Umwelt angepasst. Ziel ist die Befriedigung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse, weshalb Überschüsse mit der Gemeinschaft geteilt und nicht angehäuft werden. Früher waren die Stämme oft matrilinearorganisiert. Es gab auch aristokratische Königreiche wie z.B. bei den Gond. Man kann aber nicht sagen, inwieweit ihre Stammesgemein- schaften wirklich staatlich verfasst waren und welche Macht den „Königen“ zukam. Lebensraum und Lebensweise dieserVolksgruppen ist durch die Industrialisierung Indiens heute stark bedroht. Die „Scheduled Tribes“ aus dem Nordosten hingegen gehören der mongoliden Völkerfamilie an. Sie betrachten sich nicht als Adivasis.18
Mit Kolonialisierung und Industrialisierung begann der Bau von Bergwerken, Staudämmen und Industrieanlagen. Im Zuge dieser Entwicklung wurden nach einer Hochrechnung des Sozialforschers Walter Fernandes von 1951 bis im Jahr2000 circa 15 bis 20 Millionen Adivasi und andere „Scheduled Tribes“ vertrieben.19 Durch diese oft sehr gewaltsamen Vertreibungen verloren allein zwischen 2002 und 2004 etwa 300.000 Menschen ihre Existenzgrundlage, Häuserwurden niedergebrannt und Ernten vernichtet. Wie viele Menschen ihr Leben verloren, ist nicht bekannt.20
3.2 Adivasis: Geographische Verbreitung und Mineralienvorkommen
Rund 75 % Adivasis leben vor allem im sogenannten „Tribal Belt“ Zentralindiens, der hauptsächlich aus den Bundesstaaten Guajarat im Westen, Madhya Pradesh, Chattis- garh, Odisha, Jharkand bis nach Assam im Osten besteht. Im Nordosten, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur und Nagaland sind sogar circa 90% der Bevölkerung Indigene. Aberauch Bundesstaaten im Süden sind Siedlungsgebiete. Sie beherbergen Adivasis allerdings in weit geringererZahl. In diesen Territorien leben die unterschiedlichen Ethnien ausnahmslos in rohstoff- und wasserreichen Gebieten.21 Schon nach dem Einfall indogermanischer Hirtenvölker waren diese Regionen das Rückzugsgebiet derAdivasi. Auch zur Kolonialzeit waren sie teilweise von einer direkten britischen Verwaltung ausgenommen.22 Abbildung 1 im Anhang zeigt die Siedlungsgebiete anschaulich.
Die Santhal, Bhil, Gond, Naikida, Oraon, Sagalis, Munda, Koli, Naga und Khond sind mit einer Bevölkerung von bis zu mehreren Millionen Menschen die größten der Stam- mesvölker. Auch Gemeinschaften mit nur einigen Tausend Menschen gibt es unter der Vielzahl der Stämme.
Die am häufigsten vorkommenden metallischen Rohstoffe (Bauxit, Blei, Chrom, Eisenerze, Mangan, Titan und Zink) liegen hauptsächlich im sogenannten „Tribal Belt“.23 Indien verfügt mit der Uranerzlagerstätte in Andhra Pradesh über die möglicherweise weltweit größten Uranvorkommen. Allerdings handelt es sich um Uran minderer Qualität.24
3.3 Rechtliche Situation derAdivasis
Indien ist ein demokratischer Staat, geprägt von Diversität auf vielen Ebenen. Er ist säkular organisiert und hat vielfältige Regeln und Schutzmechanismen festgelegt, um benachteiligte Gruppen zu schützen. Das Prinzip der Chancengleichheit wurde im Artikel 15 der 1950 im nachkolonialen, demokratischen und sozialistisch orientierten Indien in Kraft getretenen Verfassung festgeschrieben. Zudem untersagt die indische Verfassung Diskriminierung aufgrund von Religion, Rasse, Kaste, Geschlecht oder Geburtsort im Artikel 46. Scheduled Tribes und Tribal Areas werden in der Indischen Verfassung im Artikel 244 behandelt. Im 5th Schedule sind die Verwaltungsvorschriften der Scheduled Areas niedergeschrieben. So wurde schon zu Zeiten der Unabhängigkeitsbewegung erkannt, welcher Missstand die fortwährende Unterdrückung und Diskriminierung der indigenen Völker bedeutet und man schuf Quotenregelungen, die z.B. die Anzahl der Parlamentsmandate oderAusbildungs- und Arbeitsplätze in Bezug aufden Bevölkerungsanteil festschrieben. Im 6th Schedule werden die administrativen Vorschriften fürTribal Areas geregelt.25 Die sonst gültigen Verwaltungsrichtlinien wurden in diesen Gebieten ausgesetzt und es sollten Regelungen gemäß der Selbstverwaltung der Stämme gelten. Dies hatte durch die Gouverneure der Bundesstaaten zu erfolgen. Allerdings passierte lange Zeit nichts.
[...]
1 Vgl. Bleischwitz, R.; Pfeil, F (Hrsg.) (2009): Globale Rohstoffpolitik; Herausforderungen für Sicherheit, Entwicklung und Umwelt. Baden-Baden 2009: 23.
2 Vgl.: Bleischwitz, R; Bringezu, S., (2016): 17 Nachhaltiges Ressourcenmanagement, Studienbrief Nr. 0820 des Fernstudiengangs „Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit“ der TU Kaiserslautern.
3 ebd: 18.
4 Vgl.: Greve, J. (2011): 1 ff.
5 Vgl.: Sautter, H. (2016): Sozial- und Umweltstandards, Studienbrief Nr. 0210 des Fernstudiengangs „Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit“ der TU Kaiserslautern: 4
6 vgl.: ebd.: 5-6
7 vgl. ebd.: 20.
8 vgl. ebd.: 38.
9 vgl. ebd.: 41.
10 http://www.ilo.org/berlin/lang--de/index.htm, abgerufen 9.3.17.
11 Vgl.: Sautter, H. (2016): 49.
12 vgl.: ebd.: 75, 76, 77.
13 vgl.: ebd.: 72.
14 val.:httD://www.oecd.org/berlin/Dublikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale- unternehmen.htm, abgerufen 28.2.17.
15 htto://data.worldbank.orq/countrv/india, abgerufen 27.2.17.
16 vgl. GFBV, (2015): Menschenrechtsreport Nr. 49: 12.
17 Roy.A, (2011): Wanderung mit den Genossen, FFM: 15.
18 httD://www.bDb.de/internationales/asien/indien/44424/adivasi-in-indien, abgerufen 27.2.17.
19 7 vgl. GFBV, (2015): Adivasi - Landlose in Indien: 1.
20 vgl. Wolf, K.;Geismar, I. Göttingen (2007): 32 - Menschenrechtsreport Nr. 49.
21 Rathgeber, T.(2015): 5, Ressourcenabbau in Indien, Stiftung Asienhaus.
22 vgl. Wolf, K.;Geismar, I. Göttingen (2007): 9 - Menschenrechtsreport Nr. 49.
23 vgl. Diercke Weltatlas, Braunschweig (2009): 231.
24 vql.http://www.handelsblatt.com/politik/international/indien-vielleicht-qroesstes- uranvorkommen-der-welt/4410414.html, abgerufen 28.2.17.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument behandelt die Möglichkeiten und Grenzen der Erhaltung traditioneller Gemeinschaften durch die Anwendung von Sozial- und Umweltstandards beim Abbau von mineralischen Rohstoffen, am Beispiel der Adivasis in Indien.
Was sind Sozial- und Umweltstandards?
Sozial- und Umweltstandards sind Instrumente, die darauf abzielen, wirtschaftliche Aktivitäten in Richtung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit zu lenken. Sie dienen als Richt- und Messgrößen und motivieren zu nachhaltiger Produktion und Konsum.
Welche Funktionen haben Sozial- und Umweltstandards?
Sie haben eine humanitär-sozialethische Funktion, indem sie die schlimmsten Auswüchse der Ausbeutung von Arbeitskräften verhindern sollen. Sie erhöhen die Marktransparenz, fördern Lernprozesse in Unternehmen und können zur Nachahmung motivieren.
Was sind die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte von Sozial- und Umweltstandards?
Entwicklungsländer befürchten Handelshemmnisse, wenn Industrieländer die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards verlangen. Es geht um die Internalisierung externer Kosten des Rohstoffabbaus (Umweltschäden, soziale Folgen), die andernfalls von der Gesellschaft getragen werden.
Welche internationalen Sozial- und Umweltstandards werden im Dokument erwähnt?
Die wichtigsten Standards, die im Dokument erwähnt werden, sind die der International Labour Organisation (ILO), der Global Compact (GC), Social Accountability 8000 (SAI) und die Leitsätze der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Wer sind die Adivasis?
Die Adivasis sind die indigenen Völker Indiens, die vor der Invasion indo-germanischer Hirtenvölker im 2. Jahrtausend vor Christus unterschiedliche Gebiete des heutigen Indien besiedelten. Sie leben hauptsächlich im "Tribal Belt" Zentralindiens.
Was ist das Problem der Adivasis im Zusammenhang mit dem Rohstoffabbau?
Die Adivasis leben oft in rohstoffreichen Gebieten und sind von Landvertreibung, Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden durch den Rohstoffabbau betroffen. Es besteht die Gefahr des Ressourcenfluchs, bei dem Rohstoffreichtum nicht zu Wohlstand und friedlichem Zusammenleben führt.
Welche rechtlichen Schutzmaßnahmen gibt es für Adivasis in Indien?
Die indische Verfassung garantiert Chancengleichheit und verbietet Diskriminierung. Es gibt Quotenregelungen und Verwaltungsrichtlinien für Scheduled Tribes und Tribal Areas, um ihre Rechte zu schützen.
Was ist die Rolle der Europäischen Union und Deutschlands in Bezug auf die Situation der Adivasis?
Die Rolle der Europäischen Union und Deutschlands wird am Ende des Dokuments angesprochen, ist aber in den Auszügen hier nicht weiter ausgeführt.
- Arbeit zitieren
- Master 0f Arts Silvia Bolley (Autor:in), 2017, Sozial- und Umweltstandards beim Abbau mineralischer Rohstoffe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119853