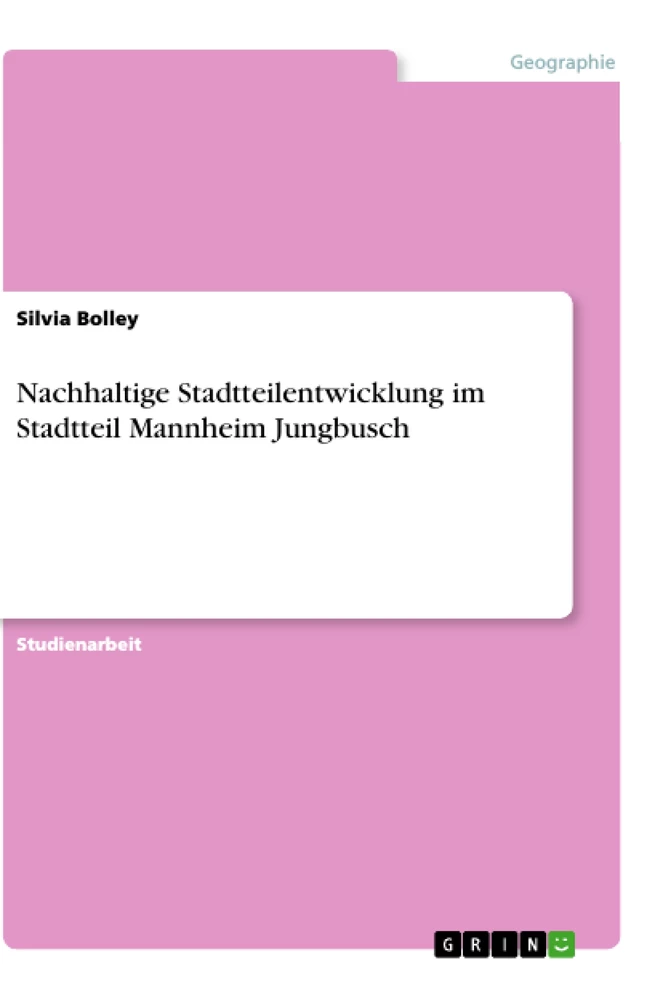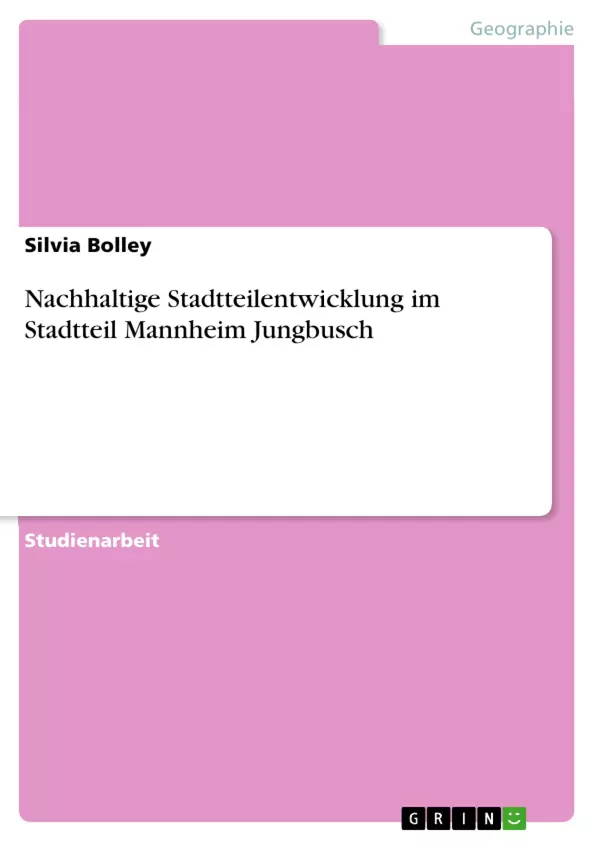Im Rahmen des Studiengangs "Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit" ist die vorliegende Aufgabenstellung, ein Konzept für die stärkere Ausrichtung auf eine nachhaltige Stadtteilentwicklung im Stadtteil Mannheim Jungbusch zu erstellen.
Im theoretischen Teil wird zunächst auf den geschichtlichen Hintergrund und die vorliegende Problematik des Stadtteils eingegangen, verschiedene Leitbilder dargestellt und Definitionen und Dimensionen nachhaltiger Stadtentwicklung sowie Indikatoren zur Messung ihrer Entwicklung genannt. Im Folgenden wird das bisherige Geschehen im Stadtteil den theoretischen Dimensionen zugeordnet und dann zusätzliche Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung vorgeschlagen.
Inhalt
1. Einleitung
1.1 Entstehung des Stadtteils Mannheim „Jungbusch“
1.3 Statistische Daten
1.2 Problemlagen im Stadtteil Mannheim Jungbusch in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht
2. Nachhaltige Stadtentwicklung
2.1 Entstehungshintergrund NachhaltigerStadtentwicklung
2.2 Definitionen und Dimensionen nachhaltiger Stadtentwicklung
2.3. Leitbilder nachhaltiger Stadtentwicklung
2.4 Indikatoren nachhaltiger Stadtentwicklung
3. Einordnung der Entwicklung im Stadtteil Mannheim/Jungbusch in die vorhandenen Konzepte und Leitbilder
3.1 Strategische Ziele und Zielgruppen im Gutachten Wohn.Raum.Stadt
3.2 Welche Leitbilder und Nachhaltigkeitsdimensionen können in Bezug auf die Entwicklung im Jungbusch identifiziert werden.
3.3 Vorschlag für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung mit Schwerpunkt auf der sozialen Dimension
5. Ausblick
Nachhaltige Stadtteilentwicklung im Stadtteil Mannheim Jungbusch
Nachhaltige Stadtteilentwicklung des Mannheimer Stadtteils „Jungbusch“
1. Einleitung
Im Rahmen des Studiengangs „Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit“ ist die vorliegende Aufgabenstellung, ein Konzept für die stärkere Ausrichtung auf eine nachhaltige Stadtteilentwicklung im Stadtteil Mannheim Jungbusch zu erstellen. Im theoretischen Teil gehe ich zunächst auf den geschichtlichen Hintergrund und die vorliegende Problematik des Stadtteils ein, stelle verschiedene Leitbilder dar und benenne Definitionen und Dimensionen nachhaltiger Stadtentwicklung sowie Indikatoren zur Messung ihrer Entwicklung. Im folgenden ordne ich das bisherige Geschehen im Stadtteil den theoretischen Dimensionen zu und schlage dann zusätzliche Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung vor.
1.1 Entstehung des Stadtteils Mannheim „Jungbusch“
Mannheim ist mit 337.919 im Jahr 2016 die drittgrößte Stadt des Landes Baden- Württemberg und aufgrund dieser Einwohnerzahl Großstadt.1)
Im Jahr 1606 machte der Bau der Festung Friedrichsburg aus dem kleinen Fischerdorf, gelegen zwischen Rhein und Neckar, eine kurfürstliche Residenz. Ein Jahr später erhielt Mannheim die Stadtprivilegien von Kurfürst Friedrich IV, derzuvordie Bevölkerung der „Zitadelle“, der heutigen Innenstadt, enteignete und die zum Ausgleich die „geformte Unterstadt“, ein Gebiet nordwestlich dieser Zitadelle bekam; ein Gebiet, das wegen des starken Bewuchses des Neckarufers mit jungem Gehölz Jungbusch genannt wurde.2) Zum Teil liegt der „Jungbusch“ auf einem früher, in Erinnerung an die dort aufeinem Friedhof beerdigten PestopferderJahre 1666 und 1667, „Pestbuckel“ genannten Hügel.
Die damalige schachbrettartige Planung des Straßennetzes mit 144 gleich großen Quadraten brachte Mannheim den Namen „Quadratestadt“ ein. Am Rande dieses Schachbrettes befindet sich das MannheimerSchloss, dessen Bau 1720 begann und 1760 beendet wurde. 3)„Besonders nach der Reichsgründung 1871 kam es zu einem verstärkten industriellenBoom der Stadt, der sich in der Erweiterung der Hafenanlage sowie in Stadterweiterungen niederschlug. Ebenso wie die Geburtsstätte der BASF, die Teer und Anilinfabrik von Engelhorn und Clemm, beherbergte der Stadtteil Zementwerften. Mannheim wurde aufgrund seiner geographischen Lage und seines Hafens zu einer der wichtigsten Industrie - und Handelsstädte Deutschlands. Der Mannheimer Stadtteil Jungbusch entstand ab 1879 in der Gründerzeit für Reeder, Kapitäne, Kaufleute und die bürgerliche Oberschicht.4) siehe zurAnschauung Abbildung 1 unten, aus:5* Gründerzeithaus in Mannheim - Jungbusch Begrenzt wird der Stadtteil im Norden durch den Neckar, im Westen durch den Handelshafen und im Süden und Osten durch den Luisenring. Die B44 durchtrennt das Quartier in den Gewerbe - und Dienstleistungsgeprägten Nordosten und den Südosten, in dem die Bevölkerung wohnt. Dies hat eine relativ hohe Bevölkerungsdichte zu Folge.
siehe zur Anschauung unten: Bildquelle Abbildung 2: Kartenausschnitt Jungbusch/ Innenstadt, Stadtteilbroschüre Innenstadt/Jungbusch derStadt Mannheim6*
Der soziale und wirtschaftliche Abstieg des Stadtteils ist verwoben mit dem Ausbau der Rheinschifffahrt Richtung Basel und dem Bedeutungsverlust des Hafens. Im Zuge der Industrialisierung verlagerten sich die Betriebe in die Unterstadt und „Jungbusch“ wurde zum Industriegebiet und zum Arbeiterviertel Mannheims. Der Luisenring wurde zur Hauptverkehrsstraße und verlor seinen Charakter als Flaniermeile. Die Umweltbelastungen durch die Fabriken ließen die Wohlhabenden in die neue Oststadt ausweichen. Derweil wandelte sich der Jungbusch zum Arbeiterviertel. Im 2. Weltkrieg fanden viele Flüchtlinge hierObdach, da derJungbusch vom Bombenhagel verschont wurde. Daher ist auch dessen gründerzeitliche Bausubstanz bis heute gut erhalten. Soldaten nutzten die Barbetriebe und Rotlichteinrichtungen im Viertel gerne, was zu deren Vermehrung führte und der Jungbusch hier seinen bis heute nicht sehr guten Ruf als „Rumpelkammer Mannheims“7* begründete. Infolgedessen zogen viele normale Arbeiterfamilien in die neu errichteten Quartiere Vogelstang und Herzogenried. Der daraus resultierende Leerstand mit niedrigen Mieten sorgte für Nachzug von italienischen und türkischen Gastarbeitern und deren Familien und zog verschiedene soziale Randgruppen an.8* In den Siebziger jahren verlorder Stadtteil durch den postfordistischen Strukturwandel, der sich hier auch durch den Niedergang der Binnenschifffahrt und durch Deindustrialisierung zeigte, seine ehemalige Bedeutung und wandelte sich zunehmend zum Rotlichtviertel und zum sozialen Brennpunkt. Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung nahmen zu. DerJungbusch erreichte seinen Tiefpunkt in sozialerwie auch in ökonomischer Hinsicht.
1.3. Statistische Daten
Strukturell gehört derJungbusch zum Stadtbezirk Innenstadt/Jungbusch. Die Form des Stadtteilswurde durch die Rheinbegradigung, einen Verbindungskanal im Handelshafen und den Neckardurchstich 1869 beeinflusst. Am 31.12.2015 hatte derStadtteil 5134 Einwohner und ist damit einer der am dichtest besiedelten Gebiete Mannheims, Davon leben 61,3 % Personen mit Migrationshintergrund im Viertel. Türkische Migranten (39%) und italienischstämmige Einwohner (22%) bilden die größten Migrantengruppen im Stadtteil.9)
Der Stadtteil wird im Sozialatlas 2015 als Quartier mit hoher Fluktuation und ausgeprägten sozialen Problemlagen ausgewiesen. Es finden sich rund 69 % Einpersonenhaushalte hier und 21 % der Einwohnersind aufTransferleistungen angewiesen. Circa 50% der Kinder bis 15 Jahren erhalten Leistungen der Grundsicherung. 10)
1.2 Problemlagen im Stadtteil Mannheim Jungbusch in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht
Anknüpfend an die oben geschilderten Zustände entstand 1977 die Diplomarbeit „Jungbusch, Wohngebiet für soziale Randgruppen“ von Kleinhans et al. woraufhin in den 80ern derArbeitskreis Jungbusch initiiert, wurde. Ziel war die Erhaltung des Jungbusch als Wohngebiet. Der Gemeinderat griff die Idee dieser beiden Gruppierungen auf und setzte die Autoren der Diplomarbeit als „Planungsgruppe KPS“ ein, die auch den Deutschen Städtepreis dafür erhielt. Zudem Stadt entschloss sich die Stadt Mannheim einen Antrag zurAufnahme in das Programm „Soziale Stadt“ zu stellen, um den mannigfaltigen sozialen und baulichen Problemen entgegenzuwirken. DerJungbusch wird seit 2003 durch dieses Programm unterstützt. Ein Gemeinschaftszentrum wurde errichtet, Schulen und Sportstätten gebaut sowie die Infrastruktur modernisiert. Außerdem konzentrierte sich die Stadt auf die Ansiedlung von Gewerbebetrieben der Musik - und Kreativwirtschaft.11)
Hauptprobleme im Jungbusch sind nach wie vor die hohe Bewohnerfluktuation aus ökonomischen Gründen aber auch wegen fehlenden Frei- und Grünflächen, hoher Verkehrsbelastung, mangelnden Bildungschancen für Kinder und Jugendliche und das immer noch vorherrschende schlechte Image. Eine hohe Arbeitslosenquote impliziert niedrige Kaufkraft sowie prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Die Wirtschaftsstruktur ist durch Kleinstbetriebe in Gastronomie und Handel geprägt. Der Mangel an Arbeitsund Ausbildungsplätzen lässt sich nur schwer beheben. Allerdings gibt es günstige Gewerberäume, die junge Gründer der Kreativwirtschaft anzog. Die Ansiedlung des Musikparks hat 60 Firmen aus der musikorientierten Kreativbranche mit insgesamt ca. 200 Arbeitsplätzen in den Stadtteil gebracht. Ökologisch gesehen sorgt die Lage zwischen Luisenring, Hafenstraße, Neckarvorlandstraßefürhohes Verkehrsaufkommen, dadurch hohe Lärmbelastung sowie hohe Abgaswerte. Zudem durchschneidet die B44 das Viertel in ungünstigerWeise, so dass sich die Bevölkerungsdichte im Südwesten als recht hoch erweist. Hierdurch gibt es verstärkt Probleme mit mangelnder Hygiene im öffentlichen Raum, was auch vom Quartiermanagement problematisiert wurde. Es fehlt außerdem an privaten Gärten, Fahrradwegen und Freiflächen. Die hohe Wohn raumnachfrage führt zu einem Vermietermarkt, der Mietern eine energetische Sanierung ihrerWohnungen erschwert.12*
2. Nachhaltige Stadtentwicklung
2.1 Entstehungshintergrund NachhaltigerStadtentwicklung
Wie man am Beispiel der Quadratestadt Mannheim sieht, gibt es Stadtplanung schon seit langerZeit. Seit derAntikewerden Städte planvoll angelegt.13* Eine planvoll nachhaltige Stadtentwicklung wurde allerdings erst vor relativ kurzer Zeit im Bericht der Brundtlandt-Kommission erwähnt, die ein Kapitel der „urbanen Herausforderung“ widmete.14* Ursprünglich stammt der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Eine eindeutige Definition nachhaltiger Stadtentwicklung existiert aufgrund der Komplexität des Begriffs und der beteiligten unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen nicht, was eine Operationalisierbarkeit und Überprüfbarkeit schwer macht.
Global zentralerAkteurfürdie Umsetzung und Koordination von Projekten nachhaltiger Stadtentwicklung ist das Programm derVereinten Nationen „UN-Habitat“, dessen Hauptaufgabe es ist, adäquaten Wohnraum für alle zu schaffen. Dieses Mandat ist historisch gewachsen. Die UN Habitat and Settlement Foundation wurde 1975 von der Generalversammlung derVereinten Nationen ins Leben gerufen und führte 1976 die erste UN Habitat Konferenz in Vancouver durch. Auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro wurde die Agenda 21 verabschiedet, die die Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung festschreibt. Esfolgte Habitat II 1996 in Istanbul, die die sogenannte HabitatAgenda aufden Weg brachte, in der Ziele für eine nachhaltige Stadtentwicklung, wie Umweltschutz und Armutsbekämpfung formuliert wurden. Angemessener Wohnraum für alle und nachhaltige Siedlungsentwicklung in einer zunehmend durch Verstädterung geprägten Welt werden hier u.a. als Ziele formuliert.15* 2016 wird die Habitat III - Konferenz in Quito, Ecuador durchgeführt, die eine Überprüfung und Fortschreibung der Agenda zum Ziel hat. Die „Urban 21 “ Weltkonferenz zur Zukunft der Städte im Jahr 2000 in Berlin vertiefte die Diskussion und stellte folgende Forderungen in derAbschlusserklärung: „Beseitigung derArmut, saubere Luft und Wasser sowie Sicherung akzeptabler sanitärer Einrichtungen, sichere Wohnungen, Bereitstellung guterVerkehrsanbindungen zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und anderen Zielen. Gefordert wurden zudem politische Bürgerrechte, Rechte auf Information, Rechtsstaatlichkeit und persönliche Sicherheit sowie der Schutz des Eigentums.“16) Seit 2002 finden im zweijährigen Turnus HABITAT Weltstädteforen statt. Auf europäischer Ebene startete 1994 die Gemeinschaftsinitiative URBAN mit einer Laufzeit bis 1999. Der EU - Strukturfonds sollte krisenge schüttelte Städte und Stadtviertel bei ihrer physischen, ökologischen und sozialen Erneuerung unterstützen. Das Programm URBAN II folgte bis 2006 und hatte hauptsächlich die Verringerung von Umweltverschmutzung, Kriminalität und Arbeitslosigkeit zum Ziel.
Deutschland entwickelte im Anschluss an die Rio-Konferenz eine dort geforderte nationale Nachhaltigkeitsagenda, die sich als Lokale Agenda 21 der Entwicklung in Deutschland widmet. „Nachhaltige städtebauliche Entwicklung“ ist planungsrechtlich seit dem 1.1.1998 Bestandteil des § 1 des Baugesetzbuches (BAuGB). Mit dem Programm „Soziale Stadt“ unterstützt der Bund seit 1999 Kommunen mit derAufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter Stadtteile. Die Prinzipien einer nachhaltigen Stadtentwicklung wurden u.a. 1994 in derAalborg Charta auf europäischer Ebene verankert und seitdem von ca. 2500 regionalen und lokalen Verwaltungen in 39 Ländern unterzeichnet, u.a. auch von der Stadt Mannheim.
2.2 Definitionen und Dimensionen nachhaltiger Stadtentwicklung
Aufbauend aufdem Konzept nachhaltiger Entwicklung, das zunächst im Brundtland- Bericht „Our Common Future“ im Jahre 1987 beschrieben wurde und eine an die Bedürfnisse der heutigen Generationen angepasste Entwicklung fordert, ohne die Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu verletzen, finden die 3 bzw. 4 Dimensionen der Nachhaltigkeit auch in der Stadtplanung Anwendung.
Die 3 Dimensionen Ökologie, Ökonomie, Soziales beeinflussen sich wechselseitig und stehen gleichberechtigt nebeneinander. Eine starke nachhaltige Entwicklung berücksichtigt alle Dimensionen gleichermaßen und versucht Zielkonflikte positiv aufzulösen. „Nachhaltigkeit bezeichnet einen Gleichschritt ('Koevolution') von natürlicher und menschlicher Entwicklung.“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung)17* Zunehmend wird die Dimension der politisch-institutionellen Nachhaltigkeit mit einbezogen, da effiziente Steuerung von Prozessen zur Implementierung von Nachhaltigkeitszielen unabdingbar ist und Partizipation ein wesentliches Element, die Bedürfnisse der Bevölkerung besserzu erkennen und Einflussmöglichkeiten gerechterzu verteilen. Urbane Nachhaltigkeit ist bislang nicht allgemein verbindlich definiert, obwohl das Leitbild einer nachhaltigen Stadt weit verbreitet ist. Eine weithin akzeptierte Definition von Hardoy, Mitlin und Satterthwaite soll allerdings hier beschrieben werden. Die Autoren orientieren sich an der Kernaussage der Brundtlandt - Kommission und erschließen folgende Grundbedingungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung, denen die Befriedigung ökonomischer, ökologischer, sozialer und politischer Bedürfnisse des Menschen zugrunde liegt:
- Für eine ökologische Nachhaltigkeit muss die Nutzung endlicher Ressourcen beispielsweise durch den Einsatz effizientererTechnologien und Recycling minimiert werden. Regenerative Ressourcen wie Wasser und Holz müssen nachhaltig genutzt werden, biodegradierbarer Müll darf die Kapazitäten erneuerbarer Senken, z.B eines Flusses, nicht überlasten, und nicht degradierbarer Müll sowie Emissionen dürfen die Kapazitäten lokaler und globaler Senken nicht überschreiten.
- Kulturelles, historisches und natürliches Kapital in Städten muss erhalten bleiben, da dieses nicht austauschbar und damit auch nicht erneuerbar ist, z.B historische, identitätstragende Gebäude oderAltstädte, Parks und Freiflächen, die Freizeit- und Erholungsfunktion bieten.
- Das vorhandene Sozial- und Humankapital muss fürzukünftige Generationen erhalten und weiterentwickelt werden. Diese Kapitalform beinhaltet tragfähige soziale Beziehungen (Vertrauen, Verlässlichkeit, Hilfe und Unterstützung) sowie institutionelle Strukturen, die z.B. die Wahrung von Menschenrechten und Good Governance unterstützen sollen. Sie bezieht sich aufdie Weitergabe von Wissen, Erfahrung und dem kulturellen Erbe einer Nation oder sozialen Gruppe.“18*
Die ökologische Dimension urbaner Nachhaltigkeit kann definiert werden als „Schutz, Widerstandsfähigkeit und Adaption physischer und biologischer Systeme“ (Pugh 1996).19* Eine Verbesserung der ökologischen Situation soll nicht durch die Externali- sierung von Umweltproblemen stattfinden, was zu vielerlei Problemlagen in Städten führt.
Die ökonomische Dimension wird im Konzept des Umweltübergangs (McGraham und Songsore 1996) aus einer Systemperspektive betrachtet. Je höher der Grad der ökonomischen Entwicklung, desto höher der Grad der Umweltprobleme und deren Ausstrahlung ins Hinterland. „Nachhaltige urbane Wirtschaft zielt auf Maximierung des wirtschaftlichen Wohlstands bei gleichzeitigem Erhalt der anderen Kapitalarten, auf denen dieser beruht.“20*
Auch soziale Nachhaltigkeit ist unterschiedlich definiert. Am verbreitetsten sind Definitionen, die soziale Bedingungen betonen, die die menschliche Bedürfnisbefriedigung ermöglichen bzw. unterstützen (Hardoy et. al 2001, S.351)21*
Politische Nachhaltigkeit kann auf urbaner Ebene leichter als auf nationalstaatlicher Ebene umgesetzt werden, da die Einheiten kleinräumiger und übersichtlicher sind. Der Zugang zu Teilhabe und Partizipation an Entscheidungsprozessen isttransparenter und direkter möglich. Ein Schlüsselbegriff ist hier Good urban Governance, der die Steuerungsmechanismen zur Umsetzung festgelegter Nachhaltigkeitsziele im städtischen Raum beschreibt. Sie kann kurz und prägnant definiert werden als „desired standards of practice of urban governance“ (UN-HABITAT 2002, S. 13)22*
2.3. Leitbilder nachhaltiger Stadtentwicklung
Ein Leitbild ist in der Raumplanung stetem Wandel unterworfen und drückt eine Zielvorstellung aus, wobei derzeitliche Aspekt Undefiniert bleibt. Im Laufe der Geschichte gab es eine Vielzahl von Leitbildern, die Stadtentwicklung betreffend, man denke nur an die Charta von Athen, die Gartenstadtbewegung oder das Leitbild der „gegliederten und aufgelockerten Stadt“. In den 60erJahren gab es das Leitbild der„autogerechten Stadt“ sowie das Leitbild der„Urbanität durch Dichte“. In den 70 erJahren kam das Leitbild der„erhaltenden Stadterneuerung“ auf.23) In den 90erJahren begannen ökologische Ziele in die Diskussion einzufließen. Die verschiedenen Leitbilder der nachhaltigen Entwicklung lassen sich den vier Dimensionen der Nachhaltigkeit zuordnen und haben ihre Schwerpunkte verschieden gesetzt. So gibt es die „ökologische“, „ökonomische“, die „kulturelle“, die „demokratische“, die „unternehmerische“ und auch die „soziale“ Stadt.
In der „ökologischen und ressourcensparenden“ Stadt soll ein ausgeglichener Strom an Stoffflüssen geschaffen werden. Haughton (2001,S.68ff) differenziert dieses Leitbild weiter in vier verschiedene Wege zur Förderung einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung.24) So gibt es die selbstständige Stadt, in der die negativen Einflüsse der Stadt auf das Umland minimiert werden sollen. Auch die neu gestaltete Stadt oder die „fair share city“ verbindet ökologische mit städtebaulichen bzw. ökonomischen Prinzipien. In der „fair share city“ wird der natürlichen Umwelt ein ökonomischer Wert zugesprochen, um der Überbeanspruchung natürlicher Ressourcen zu begegnen. Die „extern abhängige Stadt“ wiederum folgt kapitalistischer Logik und hat das Ziel genügend Kapital zu erwirtschaften, um soziale und ökologische Probleme zu lösen. Bei den ökonomischen Leitbildern sei die „wettbewerbsorientierte“ Stadt (Kapital akkumulieren, Investoren binden, Rahmenbedingungen für Investitionen schaffen Leuchtturmprojekte...), die „telematische“ Stadt (tragende Rolle dertechnologischen Entwicklung, Telearbeit...) und die „intelligente“ Stadt (Energieumwandlungs- .Transport -, Umweltschutztechnologien) zu nennen. Sozial ausgerichtete Leitbilder streben die „soziale“ Stadt, die „lebenswerte“ Stadt oder auch die „kulturelle“ Stadt an. Die Bürger der Stadt sollen eigenständig ihren Lebensunterhalt sichern können und mit angemessenem Wohnraum versorgt sein wie auch Zugang zu sozialer Infrastruktur haben. Bei der Betonung der kulturellen Komponente geht es um den Erhalt historisch-architektonischen Erbes wie auch zeitgenössischer Kunst. Politische Leitbilder mit Fokus auf starker städtischerSelbstverwaltung wie die „demokratische“ Stadt, die „inkludierende“ Stadt sowie die „verantwortliche“ Stadt betonen die Prinzipien von Good urban Governance, dezentrale Administration, offene Entscheidungsstrukturen und öffentlicher Partizipationsmöglichkeiten. 25) Eine weitere Kategorie stellen städtebauliche Leitbilder dar: die kompakte Stadt, die Stadt der kurzen Wege sowie die polyzentrische Stadt. Diese Prinzipien müssen jeweils mit den einzelnen Leitbildern verknüpft werden um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu ermöglichen. Zur Umsetzung dieser Leitbilder existieren unterschiedliche Strategien. Die Effizienzstrategie beinhaltet eine Minimierung des Material - und Energieeinsatzes. Die Konsistenzstrategie setzt vor allem aufAnpassung an die natürlichen Stoffkreisläufe und basiert hauptsächlich auf stofflicher Substitution. Die Suffizienzstrategie hat eine Minimierung des Konsumverhaltens der Bürger zum Ziel.26)
2.4 Indikatoren nachhaltiger Stadtentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung muss natürlich auch aufWirksamkeit überprüft werden können. Das Bundesämter Bau-, Stadt-, und Raumordnung (BBSR) hat in den 90er Jahren, abgeleitet aus der Rio - Deklaration 1992, ein Indikatorensystem zur Erfolgskontrolle nachhaltiger Stadtentwicklung entwickelt. Es verfolgt maßgeblich zwei Ziele, nämlich die Berichterstattung über nachhaltige Entwicklung sowie die Systematisierung und Konkretisierung der Ziele. Es wurden verschiedene Zieldimensionen für die drei Nachhaltigkeitsdimensionen formuliert. Die ökonomische Wettbewerbsfähigkeitwurde in drei Zieldimensionen unterteilt und soll mit einem Zielwert gemessen werden, der sich an 75% des Bundeswertes des jeweiligen Zieles anlehnt. Soziale und räumliche Gerechtigkeit wurden in neun Zieldimensionen unterteilt. Die Zielwerte unterscheiden sich beijedem Ziel, sind aberVergleichswerte in Bezug aufden Bundesdurchschnitt oder diejeweilige Region. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist in fünf Zieldimensionen unterteilt. Diese Zielwerte sind spezifisch auf Flächen und Schutzgebiete bezogen. Ausgewertet werden die Daten in Netzdiagrammen, Nachhaltigkeitsspinnen genannt. Es wurden auch noch weitere Indikatorensysteme entwickelt, z.B der Berliner Nachhaltigkeitsindex im Rahmen der lokalen Agenda 21.
2013 hat die Stadt Mannheim den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (Governance und Verwaltung) gewonnen. Unter anderem war das beispielhafte Monitoringsystem der Stadt ein Grund dafür: Alle Dienststellen und Eigenbetriebe überprüfen anhand von Kennzahlen Zielzustände und Wirkungen von Maßnahmen und können dadurch frühzeitig Anpassungen vornehmen. Zudem führt die Stadt mehrstufige, innovative Beteiligungsprozesse in den wichtigen Stadtentwicklungsbereichen durch.
3. Einordnung der Entwicklung im Stadtteil Mannheim/Jungbusch in die vorhandenen Konzepte und Leitbilder
Laut der Broschüre „Stadtteilziele Innenstadt Jungbusch“27* will Mannheim die urbanen Herausforderungen, vordenen u.a. derJungbusch steht, aufgreifen. „Innenstadt und Jungbusch werden aufgewertet, ohne die Bevölkerung zu verdrängen.“28* Eine sozial ausgewogene Bevölkerungsstruktur sei das Ziel. Die Charakteristika der historischen Barockstadt sollen erhalten werden. Grundlage der Stadtentwicklung ist das EKI Mannheim, Entwicklungskonzept Innenstadt Mannheim mit seinem Integrierten Handlungskonzept.29* Defizite des Quartiers Jungbusch und der Innenstadt (wenig Grünflächen, versiegelte Flächen, hohe Verkehrsbelastung, hoherGeräuschpegel, schlechte Luft) gilt es demnach auszugleichen.
Bei der Sanierung von Gebäuden der GBG- Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft steht die sozial verträgliche Sanierung und derAspekt der Familien im Vordergrund. Nachbarschaftliche Strukturen sollen unterstützt werden. Die Verbindungen zwischen den Quartieren sollen gestärkt werden, da derJungbusch aufgrund derVerkehrslage von der Innenstadt abgeschnitten wurde. Bildungs- und Arbeitsangebote gemäß der wirtschaftspolitischen Strategie Mannheims sollen weiter angeboten werden. Die Universität wird stärker eingebunden in die Entwicklung. Das interkulturelle Einkaufsflair soll ebenso wie die Kreativszene gestärkt werden, was für die Entwicklung des Kreativwirtschaftsstandorts Jungbusch wichtig ist. Die Kooperation mit dem Hafen bietet neue Perspektiven für Gewerbe und Bildung. Die in den letzten Jahren vermehrt zugezogenen EU -Bürgerinnen fördert die Stadt mit niedrigschwelligen Angeboten. Zugang zu Bildung, Arbeit und besseren Wohnverhältnissen soll ermöglicht werden. Mittels des Integrierten Handlungskonzepts für das Stadterneuerungsgebiet „Jung- busch/Verbindungskanal“ soll dem hohen Anteil Erwerbsloser und sozial Bedürftiger entgegen gekommen werden. Das Quartiermanagementwird hier explizit in seiner zentralen Rolle und integrativen Kraft genannt. Auch die Bedeutung von genügend Betreuungsangeboten für Kinderwird gesehen. Ganztagsschulen, Schulsozialarbeiter und Anlaufstellen mit vielfältigen Freizeitangeboten sollen für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen. Die Entwicklung der Quartiere wird mit dem Entwicklungskonzept Mannheim, dem Spielleitplan Östliche Unterstadt sowie dem Masterplan Blau_Mannheim_Blau 2020 (Planungsgrundlage für die Uferräume) in Zusammenhang gesehen.
Im Integrierten Handlungskonzept von 2007 stellt die Stadt sieben Handlungsfelder inclusive strategischen Zielen, Maßnahmen und der Rolle des Quartiermanagements sowie Indikatoren, die die Wirksamkeit messen, vor. Bereits in den 80er und 90er Jahren wurden aufgegebene Flächen neuer Nutzung zugeführt. Das Areal der Halberg Werft wurde für eine Schule und Freizeitgelände genutzt. Eine Zukunftswerkstatt im Jahr 1996 versuchte schon früh die Bewohnerschaft in die Stadtteilentwicklung einzubinden. Schon hier entstand die Leitidee „Wohnen, Arbeiten und Leben am Fluss“, um den Zugang zum Wasserwiederzu erschließen und die Randbereiche neu gestalten zu können. Auch die Gemeinwesenarbeit der 70er und 80er Jahre bewahrte den Stadtteil vor einem weiteren Zuspitzen sozialer Konflikte. Handlungsfelder sind 1. Städte bauliche Akzente, 2. Wohnen und Umfeld, 3. WirtschaftlicherAufbruch, lokale Ökonomie und Beschäftigung, 4. Beteiligung, Selbsthilfe und Bewohnerengagement, 5. Zusammenleben, Integration, Bildung, 6. Stärkung des kulturellen und politischen Lebens und 7. Verkehr, Sicherheit und öffentliche Ordnung.30* Wie man an diesen Handlungsfeldern erkennen kann, liegt der Schwerpunkt auf sozialen und ökonomischen Themenbereichen. Auch das Handlungsfeld 1 wird unter dem Aspekt der Ökonomie betrachtet. Es geht um die Aufwertung des Quartiers als Schnittstelle zwischen Wohnen und Arbeiten. Gewerbe und Dienstleistungen ebenso wie Freizeit - und Sportstätten sollen angesiedelt werden, um die direkt benachbarten Quartiere mit aufzuwerten und den Infrastrukturwandel fortzusetzen sowie private Investitionen anzuschieben verbunden mit Image- und Profilgewinn. Bei Punkt 2 ist der Modernisierungsstau und die dichte Bebauung im Vordergrund. DerSchwerpunktVerkehr, Sicherheit und Öffentliche Ordnung ist eingebunden in die Entwicklung der Gesamtstadt zu betrachten, was die Verkehrsbelastung, die Lärm - und Abgasbelastung betrifft. Die Situation in der Hafenstraße und der Dalbergstraße wurde durch Erneuerung und Verkehrsberuhigung verbessert.
Auch die Teilnahme am Programm „Soziale Stadt“ und URBAN II belegen, dass der Schwerpunkt der Stadtentwicklung auf dem sozialen und ökonomischen Feld liegen. Das Leitbild der sozialen Stadt greift die Armut urbaner Bevölkerungsgruppen auf. Die Bürger einer Stadt sollen in die urbane Ökonomie integriert sein und eigenständig ihren Lebensunterhalt verdienen können, wie auch mit angemessenem Wohnraum versorgt sein und am sozialen Leben teilhaben können.31* Das Programm „Soziale Stadt“, an dem Mannheim teilgenommen hat, zielt aufeinen Stopp weiterer Degradierung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, die im Zuge des Niedergangs des Sozialen Wohnungsbaus entstanden sind. Hier ist die Bevölkerung von mehrdimensionalen Ausgrenzungsprozessen betroffen, die durch das Programm positiv beeinflusst werden sollen und so eine Revitalisierung der Quartiere zur Folge haben sollen.
3.1 Strategische Ziele und Zielgruppen im Gutachten Wohn.Raum.Stadt
Als Vorläufer des Integrierten Handlungskonzeptes wurde das Gutach- ten„Wohn.Raum.Stadt“ von der Stadt Mannheim in Auftrag gegeben. Im September 2010 erschien die Publikation. Zielgruppen derStudie sind wie folgt: I.Gründer, Expe- rimentalisten und Selbstständige, 2.Junge, mobile Wissensarbeiter, 3.Etablierte Wissensarbeiter, 4.Urbane, karriereorientierte Haushalte mit Kindern, ö.Stadtreife, solvente Generation 50 plus, 6. Vorstadtaffine, gut situierte Familien (Periphere Nestbauer), 7.Vorstädtische Mittelschichthaushalte mit Kindern. Die drei wichtigsten strategischen Ziele der Studie sind „Stärkung der Urbanität, Talente überdurchschnittlich gewinnen, fördern und halten sowie die zentralen Projekte Mannheim Kulturhauptstadt 2020 und Masterplan Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen“. Die langfristige Anziehungs- und Bindungskraft für Bevölkerungsgruppen, die auf gehobene Wohnqualität Wert legen ist eines der Ziele der Handlungskonzeption. Besonderes Gewicht wird dabei auf die atmosphärisch kulturelle Urbanität der kreativen Stadt gelegt. Hierbei kommt der Bewerbung Mannheims zur Kulturhauptstadt 2020 natürlich besonderes Gewicht zu.32* In der Weiterentwicklung der Studie als Wohnungspolitisches Konzept der Stadt Mannheim „Wohn.Raum.Stadt 2“ wird die Grundlage der Stadtentwicklung erörtert. Es wird erklärt, dass Kern der Strategien nicht das sozialpolitische Ziel einer angemessenen Versorgung mit Wohnraum ist. Nicht eine neue Wohnungsnot sei die Motivation derAkteure sondern die Profilierung Mannheims als attraktiver Wohnstandort und Lebensmittelpunkt in Konkurrenz mit anderen Metropolregionen. Der Wohnungsbestand soll an sich verändernde Bedürfnisse der Bürger angepasst werden. „Der besondere thematische Schwerpunkt von Wohn.Raum.Stadt II liegt in der Schaffung attraktiver Wohnangebote für Haushalte mit mittleren und höheren Einkommen, insbesondere in Form von Wohneigentum. Hochqualifizierte Erwerbstätige und gut ausgebildete Facharbeiter sollen in Mannheim nicht nur die richtigen Arbeitsstellen, sondern auch die dazu passenden Wohnformen finden. Dies gilt in besonderem Maß für den Übergang von Ausbildung und Studium in die Berufstätigkeit. Auch junge Familien, die sich in dieser Lebensphase häufig gründen, sollen mehr adäquaten Wohnraum und ein familienfreundliches Wohnumfeld in Mannheim finden und nicht aufgrund fehlenderAngebote ins Umland ausweichen müssen.“33* Und weiter heißt es, der Schwerpunkt des Wohnungsbaus liege im Geschosswohnungsbau und dort vor allem im Segment der Eigentumswohnungen. Ausstattung und Preisgestaltung richte sich an Zielgruppen mit höherem Einkommen.34* In derAuswertung des Mietspiegels kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass die Mieten von 2012 bis 2014 um 7,2 % gestiegen sind.35* Im gleichen Zeitraum haben sich die Preise für Eigentumswohnungen um 11% erhöht.36* Allerdings nennt das Gutachten auch den Konflikt, dass bei steigender Nachfrage von der Innenentwicklung ein gewisser Druck auf die Bestände ausgeübt wird. Dies vor allem in den unteren und den mittleren Preislagen. Deshalb beobachtet die Stadt den Wohnungsmarkt weiterhin genau.37* Aufgrund derfrei gewordenen Konversionsflächen sollte sich diese Situation aber entspannen. Ein Siedlungsmonitoring findet seit 2010 statt, was bedeutet, dass Wohnraumvergabe nicht mehr über Berechtigungsscheine sondern durch indikatorengestütztes Monitoring stattfindet.38* Zu diesem Thema gehören auch die Wohnungen mit Mietpreisbindung und die Belegungsrechte. Am 30.6.2013 waren noch 6110 Wohnungen in Mietpreisbindung. Dies soll sukzessive abgebaut werden. 2020 soll es noch 4195 Wohnungen mit Mietpreisbindung geben. Die Belegungsrechte sollen bis 2071 weggefallen sein.39* Das heißt, dass die Gemeinde das Recht aufgibt, einen Wohnungssuchenden für eine gebundene Wohnung vorzuschlagen. Auch die Wohnungsbindungen sollen zum großen Teil wegfallen. Die Wohnungspolitik wird also sukzessive dem Markt überlassen. Hier ist auch die Rolle der GBG gefragt, der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, die Eignerin von 19208 Wohnungen ist und sich bezahlbaren Wohnraum für alle auf die Fahnen geschrieben hat.40) Außerdem wird im Gutachten vorgeschlagen, dass die GBG ihr Engagement im Handlungsfeld Wohneigentum sowie im gehobenen Mietwohnungsbau für Mannheimer Mittelschichtfamilien, Wissensarbeiter und urbane karriereorientierte Familien verstärkt um so auch Impulse für private Investoren zu setzen. Diese Handlungsfelderweiterungen erklären klar die Zielrichtung der zukünftigen Wohnungspolitik. Vor allem die Aufwertung der Innenstadt sowie die Marktöffnung der sozialen Wohnungspolitik, die abgefedert verlaufen soll, liegen im Fokus des Handelns. Allerdings werden auch Maßnahmen vorgeschlagen, wie z.B. Kleinstgenossenschaften zu unterstützen. Deshalb ist in diesem Programm zwar auszumachen, dass der Fokus vor allem auf der ökonomischen Entwicklung liegt, aber auch noch Offenheit besteht in Richtung Steuerung des Prozesses, um kulturelle und soziale Diversität zu erhalten.
3.2 Welche Leitbilder und Nachhaltigkeitsdimensionen können in Bezug aufdie Entwicklung im Jungbusch identifiziert werden.
a) Überprüft man zunächst das „Integrierte Handlungskonzept 2007X“, so wird deutlich, dass über die Jahre ein hohes Maß an Bürgerbeteiligung angeboten wurde und Partizipationsangebote gemacht und angenommen wurden. Gemeinwesenarbeit fand in Anfängen seit den 70er Jahren im Jungbusch statt und gründete sich auf die beiden Hauptkirchen. Sie wurde später durch das Quartiermanagement ersetzt. Die so entstandenen tragfähigen Netzwerke zwischen Bewohnerinitiativen, Vereinen, Kirchen, Moscheen, Sozialen Trägern und anderen Akteuren konnten wertvolle Impulse setzen und die Nachbarschaft verbessern. Der hohe Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund stellte hier eine besondere Herausforderung dar, da es besonderer Formen der Mitwirkung bedurfte, diese Bewohner an der Stadtteilentwicklung zu beteiligen. Anfang der 80er Jahre begann die Stadt mit dem Sozialplan Jungbusch, den Stadtteil zu stabilisieren und zu entwickeln. Der Bewohnerverein Jungbusch sowie die Jugendinitiative Jungbusch wurden 1984 gegründet und sollten Bürgerbeteiligung erleichtern und festigen. Ein Koordinierungskreis Jungbusch wurde Ende der 80er Jahre gegründet und stellte eine bis heute funktionierende Schnittstelle zwischen Bewohnern, Politik und Verwaltung dar. Das Gemeinschaftszentrum Jungbusch wurde 1986 im Rahmen des Sozialplans in freierTrägerschaft nationen- und generationenübergreifend eröffnet und ist seither ein wertvollerTreffpunkt, leistet Jugendarbeit, Beratung und Integrationsförderung. Gemeinschaftszentrum, Bewohnerverein und die beiden Ortskirchen organi- sierten die Zukunftswerkstatt Jungbusch, die im Jahr 1996 die Leitidee „Wohnen, Leben und Arbeiten am Fluss“ aufbrachte, um dasViertel attraktiverzu machen.
Ein Aktionsfonds Jungbusch inclusive Vergabegremium wurde etabliert, der von 2002 bis 2006 über 30 bewohnergetragene Projekte fördern konnte. 2012 gründete sich die Initiative „Wohin geht derJungbusch“, zu der Bewohner, Bezirksbeiräte, Stadtteilorganisationen wie z.B. die Kirchen gehören. Diese Initiative arbeitet mit dem Quartiersmanagement zusammen. Die Initiative „Saubere Böckstraße“ wurde maßgeblich vom Quartiermanagement ins Leben gerufen. Viele Projekte fürjunge Migranten und Frauen sowie langzeitarbeitslose Personen wurden durchgeführt. Es wird eine Stadtteilzeitung herausgegeben. Bewohnersprechstunden und Informationsarbeit finden laufend statt. Netzwerkstrukturen werden fortentwickelt. Koordinierungskreis Jungbusch, Runde Tische sowie Arbeitskreise ermöglichen Teilhabe und eventuell Einflussnahme. Hauseigentümer und Gewerbetreibende werden hierzu gezielt eingeladen, sowie Ver- tretervon Migrantenorganisationen oder anderen Schlüsselpersonen. Das Quartiermanagement vernetzt diese Arbeit mit derVerwaltung und den politischen Handlungsebenen. Es führt Kinder - und Jugendkonferenzen (z.B. auch Spielleitplan: Befragung der Kinder über die zukünftige Gestaltung des Viertels) durch und aktiviert Vertreter von Migrantengruppen. Zudem wurden auf Initiative des Quartiermanagements eine Bewohnerbefragung durchgeführt, dessen Ergebnis in das „Integrierte Handlungskonzept“ einfloss.42*
Das Integrierte Handlungskonzept agierte also, wenn man von einem Viersäulenmodell ausgeht, vor allem in der Sphäre der politisch institutionellen Nachhaltigkeit. Die Säule der Partizipation und effizienten Steuerung, Good urban Governance, wurde stark beachtet. Zudem fand später die Verwaltungsreform statt, die im Masterplan Change hoch 2 mündete.43* Auch die soziale Dimension der Stadtentwicklung wurde in der Vergangenheit in Form von Sozialplan sowie Stadtteilarbeit und Quartiermanagement einbezogen.
b) Nach Beendigung der ersten Sanierungsphase, die 1977 begann, startete die zweite Phase mit der Förderung durch das EU-Programm Urban II von 2000 - 2006 und das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ von 2003 bis 2012.44* Mithilfe des Programms „Soziale Stadt“, das sich auf das gleiche Sanierungsgebiet bezog wie Urban II sollte mittels städtischer Investitionen, Projektmitteln des Landes und privaten Investoren eine Aufwertung des Stadtteils ermöglichen. Das Freiraumwegenetz wurde ausgebaut, die Promenade am Verbindungskanal entstand, dieVerkehrsinfrastrukturwurde verbessert, die Jungbuschhalle plus X mit multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten wurde gebaut, Spielplätze saniert und das Quartiersmanagement etabliert. Zudem konnten private Sanierungen steuerlich abgeschrieben werden. Darüber hinaus wurden Projekte mit der Ziel2-Förderung der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) realisiert. Diese Maßnahmen konzentrierten sich weitgehend auf die Förderung wirtschaftlicherAktivitäten und die Ansiedlung von Unternehmen.45* Die so entstandenen Leuchtturmprojekte Popakademie Baden-Würtemberg und der Musikpark Mannheim verknüpften Kunst und Wirtschaft. Im Musikpark haben sich über 60 Firmen aus der Musikszene angesiedelt und es wurden über 200 Arbeitsplätze geschaffen. Im Zeitraum von 2000 - 2006 wurden Projekte mit einem Kostenvolumen von 40 Millionen Euro durchgeführt.46* Auch der Umbau der Kaufmannsmühle durch den Investor Suhl, in der ca. 90 Wohneinheiten, Lofts und Gewerberäume entstehen und fast fertig sind, haben ein Investitionsvolumen von ca. 55 Millionen Euro.47* Diese beschriebenen Aktivitäten lassen sich vor allem der ökonomischen Dimension zuordnen, deren Gewicht noch zu prüfen ist. Die Aufwertung des Quartiers führt sukzessive zu einer Verteuerung der Mieten und der Erhöhung der Preise für Wohneigentum, so dass sozial schwächere Bewohner das Gebiet verlassen müssen, wenn dieser Prozess nicht sozial gesteuert wird. Dr.Esther Baumgärtner, Ethnologin und Quartiermanagerin der Unterstadt, sieht eine simulierte Gentrifizierung, die zum Ziel hat, den Jungbusch fürein bürgerlicheres Publikum attraktiverzu machen, als auch seinen Ruf zu verbessern.48*
3.3 Vorschlag für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung mit Schwerpunkt auf der sozialen Dimension sowie deren Evaluation
Aus den in „Wohn.Raum.Stadt“ beschriebenen Zielen und Maßnahmen, wie sie oben schon eingehend beschrieben wurden.ist eine starke Betonung der ökonomischen Dimension ableitbar. Um die Gefahr einer Überbetonung der ökonomischen Dimension zu mindern und soziale Segregation zu verhindern, ist es wichtig, die zukünftigen Schritte auf ein mögliches Übergewicht dieser Dimension hin zu überprüfen.
Da die Stadtteilentwicklung im Jungbusch nicht isoliert zu sehen ist, sondern im Kontext der Stadtentwicklung Mannheim, weisen verschiedene Projekte, die in der Stadt geplant und umgesetzt wurden, auf eine nachhaltige Stadtentwicklung hin. Die sind u.a das Radwege-Programm, der ökologische Planungsatlas, das Urban Audit, das Raumbeobachtungssystem Rhein-Neckar, das Zentrenkonzeptfürden Einzelhandel, der ökologische Planungsatlas, der Lärmminderungsplan, der Stadtklimaatlas, das Geoportal, das Teilhabe-Projekt, die Strombank, Elektrobusse, das Stadtgartensystem, das Vorhaben den Schwerlastverkehrzu verbannen mittels des Grün Logistic Parks, der Grünzug NordOst zu dem der Jungbusch Verbindung hat und auch das Open Data Portal zum Mitmachen, das im Entstehen begriffen ist. Diese Projekte weisen vor allem eine ökologische Orientierung auf und haben Ausstrahlkraft auf das Quartier Jungbusch. Es wäre zu wünschen, dass die Verkehrssituation tatsächlich weiterhin verbessert wird und die Westtangente, deren Bau 2014 eingestellt wurde, baldmöglichst fertiggestelltwird, um die B44 zu entlasten. Zudem ist derVerbindung zum Grüngürtel großer Wert beizumessen, da sie über den Neckar zum Rhein führt und den Zugang zu Grünflächen stark verbessert. Allerdings sind diese Maßnahmen in der Gesamtstadtplanung enthalten.
Da die ökonomische Dimension einen hohen Stellenwert im Jungbusch hat und vor allem die beiden Seiten Ökonomie und Soziales in Konflikt kommen können, je nachdem welche einen höheren Stellenwert hat, wende ich mich vor allem diesen Punkten zu. Um soziale und ökonomische Nachhaltigkeit im Stadtteil gleichermaßen zu fördern und zu erreichen, sollte die regulierende Kraft der Stadt als Akteurin der Wohnungspolitik gestärkt werden. Angelehnt an das Quartiermanagement benenne ich hiervier Kategorien mit jeweiligen Maßnahmen.
a) Städtebauliche Akzente, Wohnen und Umfeld: Die Stadt Mannheim und die GBG sollten mehr Eigentum im Jungbusch erwerben. Grundstücke können von der Kommune im Erbbaurecht vergeben werden. So kann Bodenspekulation und der Druck auf die Mieten verhindert werden. Ein Umwandlungsverbot kann die Zerstückelung und den stückweisen Ausverkaufvon Häusern verhindern. Die Mietpreisbindung sowie die Belegungsrechte sollten beibehalten werden, da die Stadt so Einfluss auf die Miethöhe nehmen kann. FürWohnungen im Bestand derGBG sollten vor allem energetische Sanierungen erfolgen und erst in zweiter Linie Modernisierungen im gehobenen Segment. Baugenehmigungen für private Investoren sollten an die Integration von sozialem Wohnraum gekoppelt werden. Da nicht nur Mieten sondern auch die Preise für Wohneigentum steigen, wird der Erwerb von Eigentum auch für die Mittelschicht immer schwieriger. Die Unterstützung bisheriger Mieter bei der Gründung von Kleinstgenossenschaften kann hier helfen, die selbstgenutzten Wohnungen derSpekulation zu entziehen.49* Um Luxussanierungen zu steuern, sollte die Stadt den Erlass einer Erhaltungssatzung bedenken, wodurch auch verhindertwerden kann, dass historische Fassaden zerstört werden.50* Angelehnt an den Bericht des Quartiermanagement halte ich es fürzwingend notwendig, die von staatlicher Seite vorhandenen Schutzfaktoren zu erhalten und die soziale Stadterneuerung fortzuführen um negative Verdrängungseffekte zu verhindern und eine heterogene Bewohnerschaft zu stabilisieren. Um Gentrifizierung zu identifizieren, ist es wichtig, geeignete Instrumente zu entwickeln. Hier ist das Siedlungsmonitoring zu erweitern durch ein Programm, das gentrifizierungsrelevante Daten kombinieren kann und u.a. von Andrej Holm (Humboldt Universität Berlin) entwickelt wurde.51*
b) Lokale Ökonomie: Neben den Aktivitäten im kreativen Bereich und derAnsiedlung von Leuchtturmprojekten halte ich es fürwichtig, dass die Stadt über einen dauerhaften dritten Arbeitsmarkt nachdenkt. Hier könnte sie auch als Vorreiterin im Bereich neue soziale Arbeitsmarktpolitik auftreten. Die Fortführung des Quartiermanagements halte ich für eine tragende Säule, wenn es um die Verbindung der Förderung der Kreativwirtschaft mit vielfältigen flankierenden soziokulturellen Projekten geht, wodurch der soziale Zusammenhalt gestärkt wird. Durch Maßnahmen der Beschäftigung, Qualifizierung und Ausbildung kann die Nahversorgung gestärkt und gleichzeitig fürArbeitsplätze gesorgt werden. Diese sollten fortgeführt und ausgebaut werden, ebenso wie die Übernahme von Patenschaften und Mentoren und weitere im Bericht des Quartiermanagement genannte Maßnahmen. Die Förderung des kleinteiligen, vielfältigen Einzelhandels kann den Jungbusch revitalisieren.52)
c) Beteiligung und bewohnerschaftliches Engagement: Hier ist die vorbildliche Arbeit des Quartiermanagements unter Einbezug aller Zielgruppen fortzusetzen.
d) Integration, Bildung, Kultur: Auch hier sind die vielfältigen Projekte zu verstetigen und bedarfsgerecht auszubauen. Ein Fehlbedarfan offenen, außerschulischen Freizeitangeboten für Kinderzwischen 6 und 13 Jahren, dervom Quartiermanagement festgestellt wurde, gilt es durch adäquate Angebote zu beheben. Auch die Zusammenarbeit mit den beiden ansässigen Moscheen sollte erweitert werden. Nachzudenken wäre auch über eine weiteres Grundschulangebot, um kleine Klassen und optimale Unterstützung zu gewährleisten. Auch die Problematik derverstärkten Zuwanderung aus den osteuropäischen EU-Ländern ist mit Sonderprogrammen zur Arbeitsmarktintegration zu berücksichtigen.
e) Die vom Quartiermanagement durchgeführte Befragung der Bewohner kann als Evaluationsgrundlage dienen und solltefortgeführt werden. Ebenso ist das Monitoringsystem der Stadt ein geeignetes Mittel, Ziele und Maßnahmen auf Wirksamkeit zu überprüfen.
4. Ausblick
„Wohin geht der Jungbusch“ scheint mir die adäquate Frage am Schluss dieser Arbeit zu sein. Gestellt wurde sie von Bewohnern und Stadtteilorganisationen in dergleich- namigen Initiative in Zusammenarbeit mit dem Quartiermanagement Jungbusch. Da gleichermaßen positive wie negative Entwicklungen im Stadtteil zu beobachten waren, gründete sich diese Initiative. Dies scheint mir beispielhaft für das langjährige Engagement von Einwohnern in und für ihren Stadtteil zusammen mit Akteuren aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Daher bin ich zuversichtlich, dass das bisherige kreative Engagement in einer langfristigen Verbreiterung der Bevölkerungszusammensetzung und einem aktiven Sozialleben im Jungbusch mündet.
1) Kommunale Statistikstelle, Statistische Daten Mannheim N°1/201
2) Bachelorthesis Max Pflüger, Jungbusch/Mannheim, Die Entwicklung des aufstrebenden Stadtteils durch die Kultur - und Kreativwirtschaft. Abteilung Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim, Seite 2
3) www.mannheim.de, abgerufen 25.7.16
4) httDs://www.mannheim.de/buerqer-sein/innenstadtiunqbusch-144-quadrate-und-150- nationen-zwischen-rhein-und-neckar, abgerufen 4.8.16
5) Bild aus: Bachelorthesis Max Pflüger, Jungbusch/Mannheim, Die Entwicklung des aufstrebenden Stadtteils durch die Kultur - und Kreativwirtschaft. Abteilung Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim
6) Stadtteilbroschüre Innenstadt Jungbusch der Stadt Mannheim, abgerufen 9.8.2016
7) Mannheimer Morgen, (MM vom 4./5.2.1984)
8) Bachelorthesis Max Pflüger, Jungbusch/Mannheim, Die Entwicklung des aufstrebenden Stadtteils durch die Kultur - und Kreativwirtschaft. Abteilung Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim, Seite 6
9) Kommunale Statistikstelle, Statistische Daten Mannheim N°3/2016
10) http://www.iunqbuschzentrum.de/harte-fakten-und-klare- handlunqsbedarfesozialatlas-mannheim-beschreibt-den-iunqbusch-als-besondere- welt/, abgerufen 25.8.16 und MannheimerSozialatlas, aktualisierte Daten 2015, Stadt Mannheim
11) Bachelorthesis Max Pflüger, Jungbusch/Mannheim, Die Entwicklung des aufstrebenden Stadtteils durch die Kultur - und Kreativwirtschaft. Abteilung Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim, Seite
12) Stadtteilbroschüre Innenstadt Jungbusch der Stadt Mannheim, abgerufen 9.8.2016
13) https://www.uni- due.de/qeoqraphie/vvz duisburq/WS2002 2003/ScripteBlo/Stadtplanunq/02 - Geschichte-d-Stadtplanunq.pdf, Seite 1, abgerufen 4.8.16
14) Dr. Mareike Kroll; Prof. Dr. Frauke Kraas (2013):Urban Sustainability. Studienbrief Nr. 0510 des Fernstudiengangs Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit derTU Kaiserslautern, Seite 65
15) ebenda, Seite 3
16) ebenda, Seite 3
17) ebenda, Seite 63
18) ebenda, Seite 67
19) ebenda, Seite 72
20) ebenda, Seite 75
21) ebenda, Seite 75
22) ebenda, Seite 83
23) ebenda, Seite 85
24) ebenda, Seite 88
25) ebenda, Seite 92
26) ebenda, Seite 94 - 98
27) https://www.mannheim.de/buerqer-sein/innenstadtjunqbusch-144-quadrate-und- 150-nationen-zwischen-rhein-und-neckar, abgerufen 11.8.16
28) ebenda, Seite 6
29) htim, www.iunqbuschzentrum.de/wp- contentps://www.mannheim.de/eki-mannheim/eki-entwicklunqskonzept-innenstadt- mannhet/uploads/.../IHK Junqbusch 0707 neuX.pdf, Stand 11.8.16
30) www.iunqbuschzentrum.de/wp- content/uploads/.../IHK Junqbusch 0707 neuX.pdf, abgerufen 11.8.16
31) Dr. Mareike Kroll; Prof. Dr. Frauke Kraas (2013):Urban Sustainability. Studienbrief Nr. 0510 des Fernstudiengangs Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit derTU Kaiserslautern, Seite 91
32) Albert Speer & Partner GmbH (AS&P): Städtebauliches Gutachten, Analyse von Potenzial und Eignung ausgewählter kleinräumlicher Entwicklungsflächen im Rahmen des Handlungskonzeptes Wohnungsmarktentwicklung, Seite 1
33) WOHNEN IN MANNHEIM, Wohnungspolitisches Programm, Wohn.Raum.Stadt II.Herausgeberin, Stadt Mannheim, Dezernat IV - Bauen, Planung, Verkehr, Sport, Collini-Center, 68161 Mannheim, Mannheim 2014, Seite 10
34) ebenda, Seite 25
35) ebenda, Seite 27
36) ebenda, Seite 30
37) ebenda, Seite 51
38) ebenda, Seite 57
39) ebenda, Seite 59
40) http://www.qbq-mannheim.de/ueber-uns/inhalt, Seite 1, abgerufen 11.8.16
41) Albert Speer & Partner GmbH (AS&P): Städtebauliches Gutachten, Analyse von Potenzial und Eignung ausgewählter kleinräumlicher Entwicklungsflächen im Rahmen des Handlungskonzeptes Wohnungsmarktentwicklung, Seite 131
42) IHK_Jungbusch_0707_neuX.pdf
43) Verwaltungsmodernisierung Stadt Mannheim 2008-2013“ mit der Neustrukturierung der Dezernate und derAbgrenzung der Geschäftskreise gemäß § 44 Abs. 1 Gemeindeordnung BW (Beschlussvorlage 492/2007 - Sitzung des Gemeinderats vom 23.10.2007)
44) https://www.mannheim.de/stadt-qestalten/qemeinschaftsinitiative-urban-ii- mannheimludwiqshafen, abgerufen 22.8.16
45) ebenda
46) ebenda
47) http://www.morqenweb.de/mannheim/mannheim-stadt/qetreidesilo-wandelt-sich- 1.2865778, abgerufen 24.8.16
48) Baumgärtner, Esther (2009): Lokalität und kulturelle Hetereogenität. Selbstveror- tung und Identität in der multi-ethnischen Stadt, Seite 65
49) WOHNEN IN MANNHEIM, Wohnungspolitisches Programm, Wohn.Raum.Stadt II.Herausgeberin, Stadt Mannheim, Dezernat IV - Bauen, Planung, Verkehr, Sport, Seite 88
50) „Wohnen, Arbeiten und Leben am Fluss“. Bericht über die Arbeit des Quartiermanagement Jungbusch - Berichtsjahr 2011, Seite 13
51) Heil, Volker: 2013, Stadterneuerung durch Gentrifizierung, Seite 111
52) „Wohnen, Arbeiten und Leben am Fluss“. Bericht über die Arbeit des Quartiermanagement Jungbusch - Berichtsjahr 2011, Seite 28
Literaturverzeichnis
1. Albert Speer & Partner GmbH (AS&P) (2010): Städtebauliches Gutachten, Analyse von Potenzial und Eignung ausgewählter kleinräumlicher Entwicklungsflächen im Rahmen des Handlungskonzeptes Wohnungsmarktentwicklung ; Wohn.Raum.Stadt I,
2. Baumgärtner, Esther (2009): Lokalität und kulturelle Hetereogenität. Selbstverortung und Identität in der multi-ethnischen Stadt
3. Heil, Volker (2013): Stadterneuerung durch Gentrifizierung; Identifikation und Steuerungsmöglichkeiten. Das Beispiel Mannheim-Jungbusch. Copyright ©2013 GRIN Verlag, Open Publishing GmbH, ISBN: 978-3-656-43924-0
4. Innenstadtbroschüre Mannheim Jungbusch, Herausgeber: Stadt Mannheim, Fachbereich Rat, Beteiligung und Wahlen, Peter Myrczik, Rathaus E 5, 68159 Mannheim
5. Dr. Mareike Kroll; Prof. Dr. Frauke Kraas (2013): Urban Sustainability. Studienbrief Nr. 0510 des Fernstudiengangs Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit derTU Kaiserslautern
6. Kommunale Statistikstelle, Statistische Daten Mannheim N°3/2016
7. Mannheimer Sozialatlas; Stadt Mannheim, Fachbereich Arbeit und Sozia les, Sozialplanung,K 1, 7-13, 68159 Mannheim, Mannheim,August2016
8. Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, Geschäftsführer: Dr. Björn Jansen, Jörg Röver, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim
9. Stadt Mannheim, Dezernat IV - Bauen, Planung, Verkehr, Sport (2014):Wohnen in Mannheim, Wohnungspolitisches Programm, Wohn.Raum.Stadt II, Herausgeberin, Stadt Mannheim, Collini-Center, 68161 Mannheim
10. Verwaltungsmodernisierung Stadt Mannheim 2008-2013“ mit der Neustrukturierung der Dezernate und derAbgrenzung der Geschäftskreise gemäß § 44 Abs. 1 Gemeindeordnung BW (Beschlussvorlage 492/2007 - Sitzung des Gemeinderats vom 23.10.2007)
11. „Wohnen, Arbeiten und Leben am Fluss“. Bericht über die Arbeit des Quartiermanagement Jungbusch - Berichtsjahr 2011; vorgelegt von: Trägerverein Gemeinschaftszentrum Jungbusch e.V., Jungbuschstraße 19,
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der "Nachhaltige Stadtteilentwicklung im Stadtteil Mannheim Jungbusch"?
Dieses Dokument ist ein Konzept für eine stärkere Ausrichtung auf eine nachhaltige Stadtteilentwicklung im Stadtteil Mannheim Jungbusch. Es behandelt den historischen Hintergrund, die Problematik des Stadtteils, verschiedene Leitbilder, Definitionen und Dimensionen nachhaltiger Stadtentwicklung sowie Indikatoren zur Messung dieser Entwicklung. Abschließend wird das bisherige Geschehen im Stadtteil den theoretischen Dimensionen zugeordnet und zusätzliche Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung vorgeschlagen.
Wie ist der Jungbusch entstanden?
Der Jungbusch entstand im 17. Jahrhundert als Gebiet nordwestlich der Mannheimer Zitadelle. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Stadtteil zu einem wichtigen Industrie- und Handelszentrum, bevor er im Laufe der Zeit an Bedeutung verlor und sich zu einem sozialen Brennpunkt entwickelte.
Welche statistischen Daten sind über den Jungbusch bekannt?
Der Jungbusch ist dicht besiedelt, mit einem hohen Anteil von Personen mit Migrationshintergrund (61,3 %). Es gibt einen hohen Anteil an Einpersonenhaushalten und Personen, die auf Transferleistungen angewiesen sind. Viele Kinder erhalten Leistungen der Grundsicherung.
Welche Problemlagen gibt es im Jungbusch?
Die Problemlagen umfassen eine hohe Bewohnerfluktuation, mangelnde Frei- und Grünflächen, hohe Verkehrsbelastung, mangelnde Bildungschancen und ein schlechtes Image. Es gibt auch eine hohe Arbeitslosenquote, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und ökologische Belastungen durch Verkehr und Industrie.
Was versteht man unter nachhaltiger Stadtentwicklung?
Nachhaltige Stadtentwicklung zielt darauf ab, die Bedürfnisse der heutigen Generationen zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen einzuschränken. Dabei werden ökologische, ökonomische, soziale und politisch-institutionelle Dimensionen berücksichtigt.
Welche Leitbilder nachhaltiger Stadtentwicklung gibt es?
Es gibt verschiedene Leitbilder, die sich den vier Dimensionen der Nachhaltigkeit zuordnen lassen, z.B. die "ökologische und ressourcensparende" Stadt, die "wettbewerbsorientierte" Stadt oder die "soziale" Stadt.
Wie kann nachhaltige Stadtentwicklung gemessen werden?
Es gibt verschiedene Indikatorensysteme zur Erfolgskontrolle nachhaltiger Stadtentwicklung, z.B. das Indikatorensystem des Bundesamtes für Bau-, Stadt- und Raumordnung (BBSR).
Welche Konzepte und Leitbilder wurden bisher im Jungbusch umgesetzt?
Die Stadt Mannheim hat verschiedene Maßnahmen zur Aufwertung des Jungbusch ergriffen, z.B. im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" und durch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben der Musik- und Kreativwirtschaft.
Welche strategischen Ziele verfolgt das Gutachten Wohn.Raum.Stadt?
Die wichtigsten strategischen Ziele sind die Stärkung der Urbanität, die Gewinnung, Förderung und das Halten von Talenten sowie die erfolgreiche Umsetzung der zentralen Projekte Mannheim Kulturhauptstadt 2020 und Masterplan Kreativwirtschaft.
Welche Empfehlungen werden für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung im Jungbusch gegeben?
Empfohlen werden u.a. die Stärkung der regulierenden Kraft der Stadt als Akteurin der Wohnungspolitik, der Erwerb von mehr Eigentum durch die Stadt, die Beibehaltung der Mietpreisbindung, die Unterstützung von Kleinstgenossenschaften und die Fortführung des Quartiermanagements.
- Quote paper
- Silvia Bolley (Author), 2016, Nachhaltige Stadtteilentwicklung im Stadtteil Mannheim Jungbusch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119854