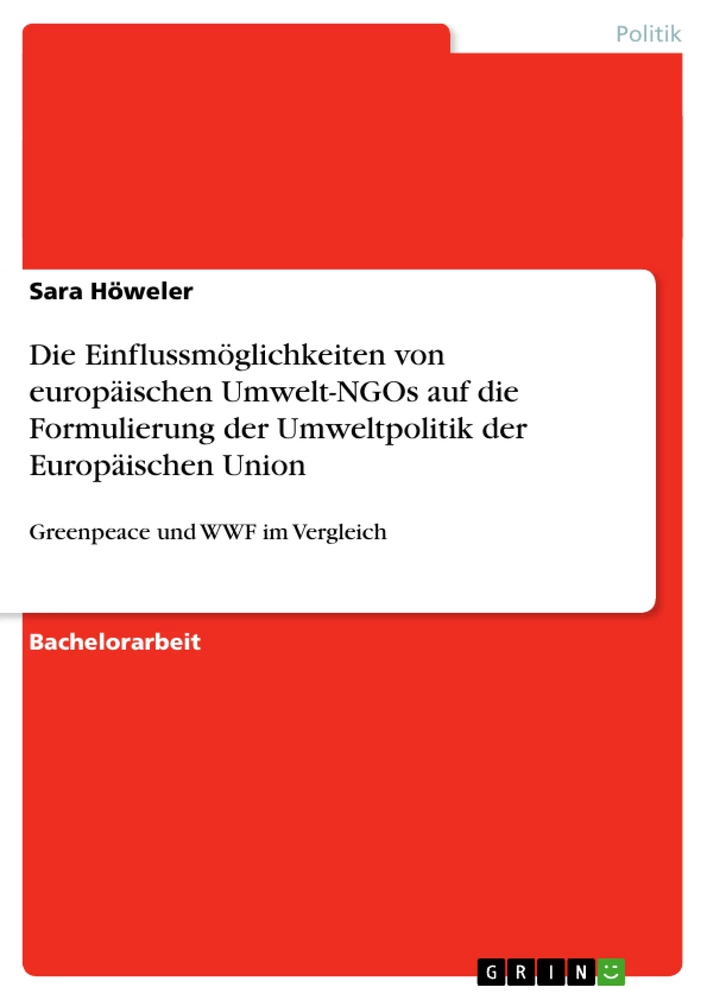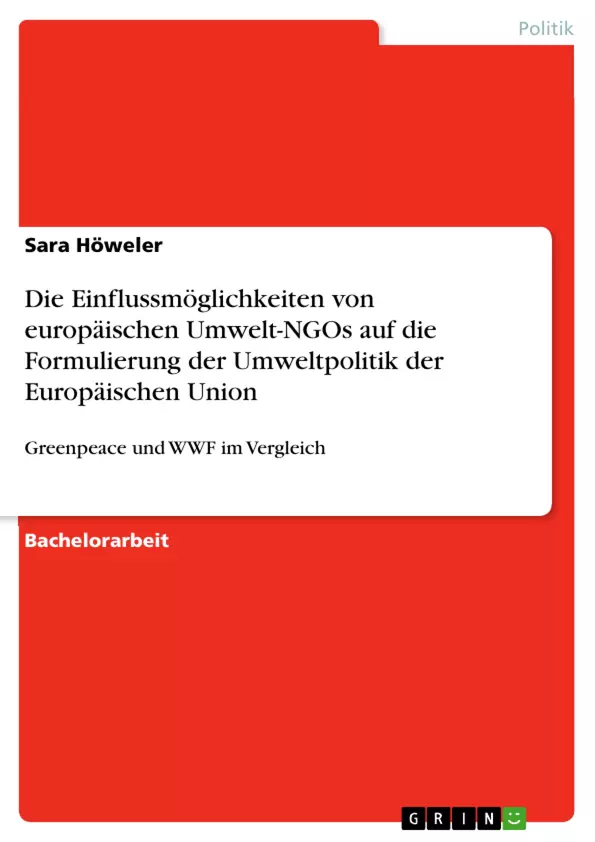Ausgehend von der Annahme, dass im Gegensatz zu Industrieverbänden die ressourcenschwachen Umwelt-NGOs eher geringe Einflussmöglichkeiten auf EU-Ebene haben, ist es Ziel dieser Arbeit, ihre tatsächlichen Partizipationsmöglichkeiten bzgl. der Formulierung der europäischen Umweltpolitik zu untersuchen und herauszufinden, ob sie gegenüber den Wirtschaftsvertretern wirklich im Nachteil sind. Neben der Analyse der wichtigsten politischen Organe, der Kommission, dem Rat und dem Parlament, auf mögliche Einflusskanäle, steht der Vergleich von zwei der größten europäischen Umwelt-NGOs, Greenpeace und WWF, im Vordergrund. Wichtige Aspekte sind hierbei:
In welcher Intensität und in welcher Art und Weise arbeiten die Interessengruppen zur Umweltpolitik und was sind ihre Intentionen? Welche Mittel zur Einflussnahme wenden sie an und wie offen sind überhaupt die Institutionen der EU für die Partizipation von Umwelt-NGOs? In diesem Zusammenhang soll in kurzer Form auch das Einflusspotential von Wirtschafts- und Industrieverbänden thematisiert werden, um die Verhandlungsmacht der beiden auf die europäische Umweltpolitik Einfluss nehmenden Gegenspieler – Umwelt- und Wirtschaftsverbände - vergleichen zu können.
Ein weiteres Erkenntnisinteresse liegt speziell darin, anhand eines detaillierten Vergleichs von Greenpeace und WWF herauszufinden, welche Strategie der Beeinflussung Erfolg versprechender ist.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zielsetzung und Gliederung
- 1.1.1 Zielsetzung
- 1.1.2 Gliederung
- 1.2 Forschungsstand
- 1.3 Begriffsdefinitionen
- NGO
- 1.3.2 Einfluss
- 1.3.3 Lobbying
- 1.1 Zielsetzung und Gliederung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Pluralismus
- 2.2 (Neo-)Korporatismus
- 2.3 Mancur Olsons Logik des kollektiven Handelns
- 3 Die Umweltpolitik der Europäischen Union
- 3.1 Die Entwicklung der europäischen Umweltpolitik
- 3.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 3.1.2 Schwerpunkte und Probleme der EU-Umweltpolitik
- 3.2 Gemeinsame Fischereipolitik
- 3.2.1 Die Reform der GFP 2002
- 3.3 Umwelt-NGOs auf EU-Ebene
- Greenpeace
- 3.3.2 WWF
- 3.1 Die Entwicklung der europäischen Umweltpolitik
- 4 Einflussmöglichkeiten
- 4.1 Einflussnahme auf die Organe der EU
- 4.1.1 Europäische Kommission
- 4.1.2 Ministerrat
- 4.1.3 Europäisches Parlament
- 4.4 Strategien der Beeinflussung
- 4.5 Machtverteilung zwischen Umwelt- und Wirtschaftsinteressen
- 4.1 Einflussnahme auf die Organe der EU
- 5 Greenpeace und WWF als Akteure in der europäischen Umweltpolitik
- 5.1 Entstehungsgeschichte
- 5.1.1 - Die Geburt einer Umweltstiftung
- 5.1.2 Greenpeace — Von der Aktionsgruppe zum internationalen Umweltkonzem
- 5.2 Struktur, Ziele und Finanzierung
- 5.2.1 Der konservative WWF
- 5.2.2 Die Protestorganisation Greenpeace
- 5.3 Instrumente und Arbeitsweise
- WWF — der kooperative Lobbying-spezialist
- Greenpeace — die aktionsorientierte Medienorganisation
- 5.4 Probleme und Defizite
- 5.4.1 Legitimationsdefizit
- 5.4.2 Das Problem der Entpolitisierung
- 5.4.3 Organisationsdefizit
- 5.1 Entstehungsgeschichte
- 6 Fallbeispiel: Reform der GFP
- 6.1 Arbeitsweisen von WWF und Greenpeace
- 6.2 Ziele der Umwelt-NGOs
- 6.3 Strategien der Einflussnahme
- WWF
- Greenpeace
- 6.4 Bewertung
- 7 Schlussbetrachtung
- 7.1 Verortung der Umwelt-NGOs im politischen System der EU
- 7.2 Resümee und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Studienarbeit untersucht die Einflussmöglichkeiten von europäischen Umwelt-NGOs, insbesondere Greenpeace und WWF, auf die Formulierung der europäischen Umweltpolitik. Die Arbeit analysiert, wie diese Organisationen ihre Interessen in Bezug auf den Umweltschutz geltend machen und welche Mittel sie dabei einsetzen.
- Die Rolle von Umwelt-NGOs im politischen System der EU
- Die Herausforderungen und Chancen der Interessenvertretung auf EU-Ebene
- Die Einflussstrategien von Greenpeace und WWF
- Die Unterschiede in der Arbeitsweise und den Zielen der beiden Organisationen
- Das Legitimationsdefizit von Umwelt-NGOs und die Problematik der Entpolitisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und Gliederung der Arbeit dar und definiert wichtige Begriffe wie NGO und Lobbying. Anschließend beleuchtet sie den Forschungsstand zum Thema Interessenvertretung in der EU und die Rolle von Umweltorganisationen. Das zweite Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen der Analyse, indem es den Pluralismus, den (Neo-)Korporatismus und die Logik des kollektiven Handelns nach Mancur Olson vorstellt.
Kapitel 3 gibt einen Überblick über die Entwicklung der europäischen Umweltpolitik, ihre rechtlichen Rahmenbedingungen und die Schwerpunktthemen. Es stellt die Gemeinsame Fischereipolitik und die Reform von 2002 vor. Außerdem werden die wichtigsten Umwelt-NGOs auf EU-Ebene, darunter Greenpeace und WWF, vorgestellt. Kapitel 4 analysiert die Einflussmöglichkeiten von Umwelt-NGOs auf die Organe der EU, insbesondere die Europäische Kommission, den Ministerrat und das Europäische Parlament. Es beleuchtet die formellen und informellen Partizipationsmöglichkeiten sowie die Strategien der Einflussnahme.
Kapitel 5 vertieft die Analyse der beiden wichtigsten Umwelt-NGOs, Greenpeace und WWF, indem es ihre Entstehungsgeschichte, Struktur, Ziele, Finanzierung und Arbeitsweise sowie mögliche Probleme und Defizite beleuchtet. Kapitel 6 untersucht die Einflussmöglichkeiten von Greenpeace und WWF anhand des Fallbeispiels der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik im Jahr 2002. Es analysiert die Arbeitsweisen, Ziele und Strategien der beiden Organisationen im Kontext dieses Reformprozesses und bewertet ihre Erfolge.
Die Schlussbetrachtung fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und verortet die Umwelt-NGOs im politischen System der EU. Sie diskutiert die Herausforderungen und Chancen der Interessenvertretung im Kontext der europäischen Integration und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Einflussmöglichkeiten von Umwelt-NGOs.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die europäische Umweltpolitik, die Einflussmöglichkeiten von Umwelt-NGOs, Greenpeace, WWF, Lobbying, Interessenvertretung, die Gemeinsame Fischereipolitik, die EU-Institutionen, die Europäische Kommission, der Ministerrat, das Europäische Parlament, die Legitimation von NGOs, die Entpolitisierung und das Organisationsdefizit. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen der Interessenvertretung von Umwelt-NGOs im Kontext der europäischen Integration und analysiert die unterschiedlichen Strategien von Greenpeace und WWF.
- Quote paper
- M. A. Sara Höweler (Author), 2005, Die Einflussmöglichkeiten von europäischen Umwelt-NGOs auf die Formulierung der Umweltpolitik der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112060