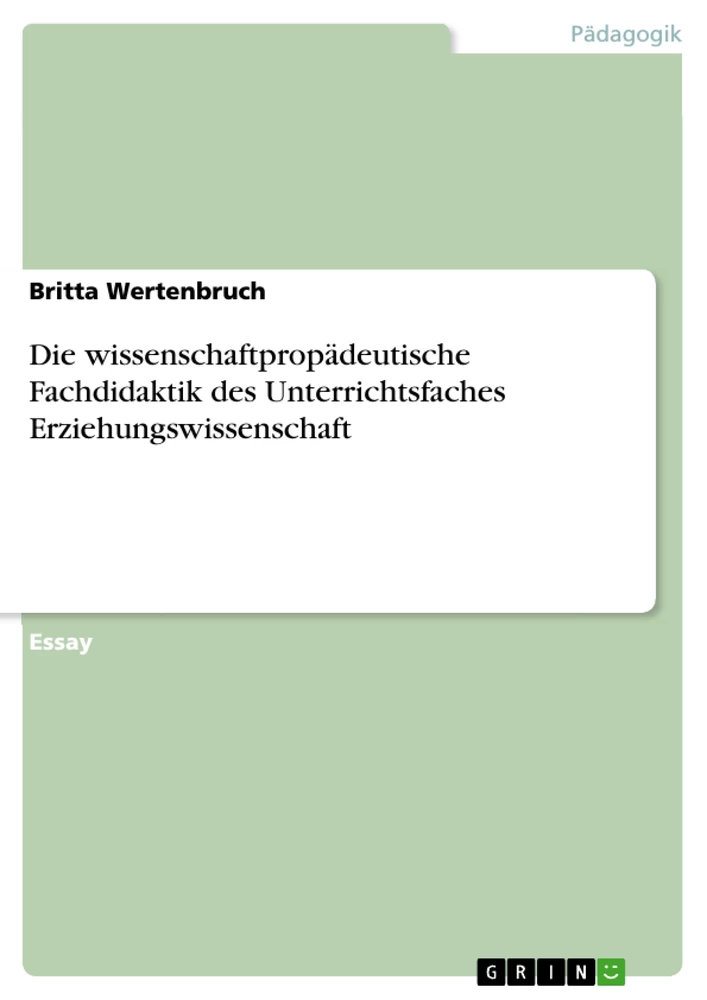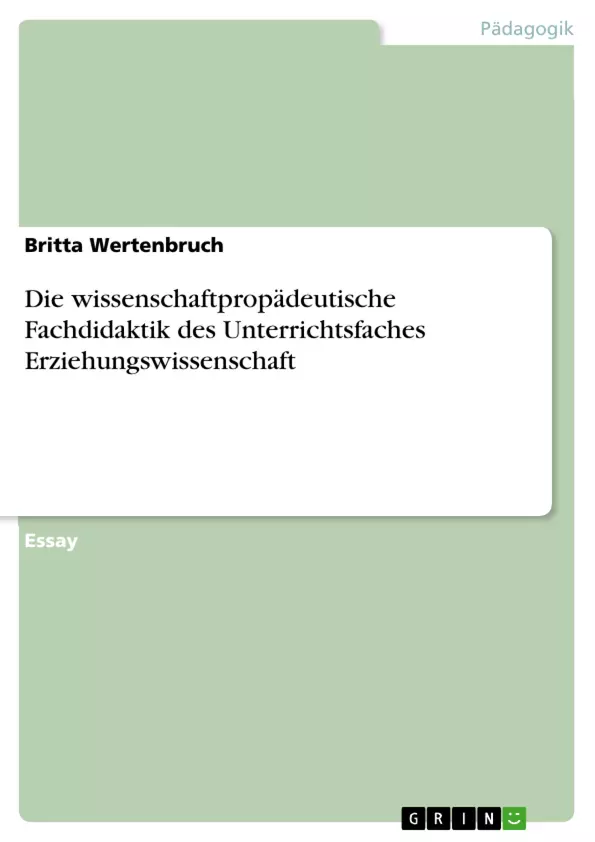Dieses Essay stellt die wissenschaftpropädeutische Fachdidaktik des Unterrichtsfaches Erziehungswissenschaft dar. Dabei wird zunächst auf die Legitimantion des Unterrichtsfaches, dann auf die Grundlagen und Begründungen für fachdidaktische Entscheidungen eingegangen. Danach werden die Aufgaben und Ziele sowie die Inhalte und Methoden der wissenschatpropädeutischen Fachdidaktik dargestellt. Am Schluss wird die Frage der Praktikabilität und Plausibilität der Fachdidaktik geklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Legitimation des Unterrichtsfaches Pädagogik
- Grundlagen und Begründungen der fachdidaktischen Entscheidungen
- Aufgaben und Ziele des Pädagogikunterrichts
- Inhalte des Unterrichtsfaches Pädagogik
- Methode des Unterrichtsfaches Pädagogik
- Plausibilität und Praktikabilität der wissenschaftspropädeutischen Fachdidaktik
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der wissenschaftspropädeutischen Fachdidaktik des Unterrichtsfaches Pädagogik. Sie analysiert die Legitimation des Faches im Rahmen der gymnasialen Oberstufe (GOSt) und untersucht die Grundlagen und Begründungen der fachdidaktischen Entscheidungen. Darüber hinaus werden die Aufgaben und Ziele des Pädagogikunterrichts sowie die Inhalte und Methoden des Faches beleuchtet.
- Legitimation des Unterrichtsfaches Pädagogik
- Grundlagen und Begründungen der fachdidaktischen Entscheidungen
- Aufgaben und Ziele des Pädagogikunterrichts
- Inhalte des Unterrichtsfaches Pädagogik
- Methode des Unterrichtsfaches Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Legitimation des Unterrichtsfaches Pädagogik in der gymnasialen Oberstufe. Es wird argumentiert, dass Pädagogik nicht mehr als Erbauungsfach oder Vorbereitung auf pädagogische Berufe verstanden werden darf, sondern als ein "echtes" Bildungsfach, das zur gesellschaftlichen Grundbildung am Gymnasium beiträgt. Das zweite Kapitel untersucht die Grundlagen und Begründungen der fachdidaktischen Entscheidungen. Dabei wird die spezifische Mittelstellung der Fachdidaktik zwischen Fachwissenschaft und Pädagogik beleuchtet und die Bedeutung von Bezugspunkten wie Lehrsituation, Lernende und Gesellschaft für fachdidaktische Entscheidungen herausgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich den Aufgaben und Zielen des Pädagogikunterrichts. Es wird deutlich gemacht, dass der Unterricht wissenschaftsorientiert, wissenschaftspropädeutisch und handlungsorientiert sein muss und den Schülern Handlungsperspektiven für die gesellschaftliche Praxis aufzeigen soll. Das vierte Kapitel behandelt die Inhalte des Unterrichtsfaches Pädagogik. Hier wird die "kritische" Erkenntnistheorie der Frankfurter Schule nach Habermas herangezogen, um Erziehung als einen Ausschnitt gesellschaftlicher Praxis zu verstehen und zu analysieren. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf die Methode des Unterrichtsfaches Pädagogik. Es werden verschiedene methodische Lernziele und Arbeitstechniken vorgestellt, die im Unterricht eingesetzt werden können, um die Studierfähigkeit der Schüler zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die wissenschaftspropädeutische Fachdidaktik, den Pädagogikunterricht, die Legitimation des Faches, die Aufgaben und Ziele des Unterrichts, die Inhalte und Methoden des Faches, die Studierfähigkeit, die gesellschaftliche Grundbildung, die "kritische" Erkenntnistheorie der Frankfurter Schule nach Habermas, Erziehung als Bestandteil gesellschaftlicher Praxis, die drei Erkenntnisinteressen (technisch, praktisch, emanzipatorisch), die drei Momente von Erziehung (Legitimation, Interaktion, Reproduktion), die Arbeitstechniken und wissenschaftlichen Forschungsmethoden im Pädagogikunterricht.
- Quote paper
- Britta Wertenbruch (Author), 2008, Die wissenschaftpropädeutische Fachdidaktik des Unterrichtsfaches Erziehungswissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112079