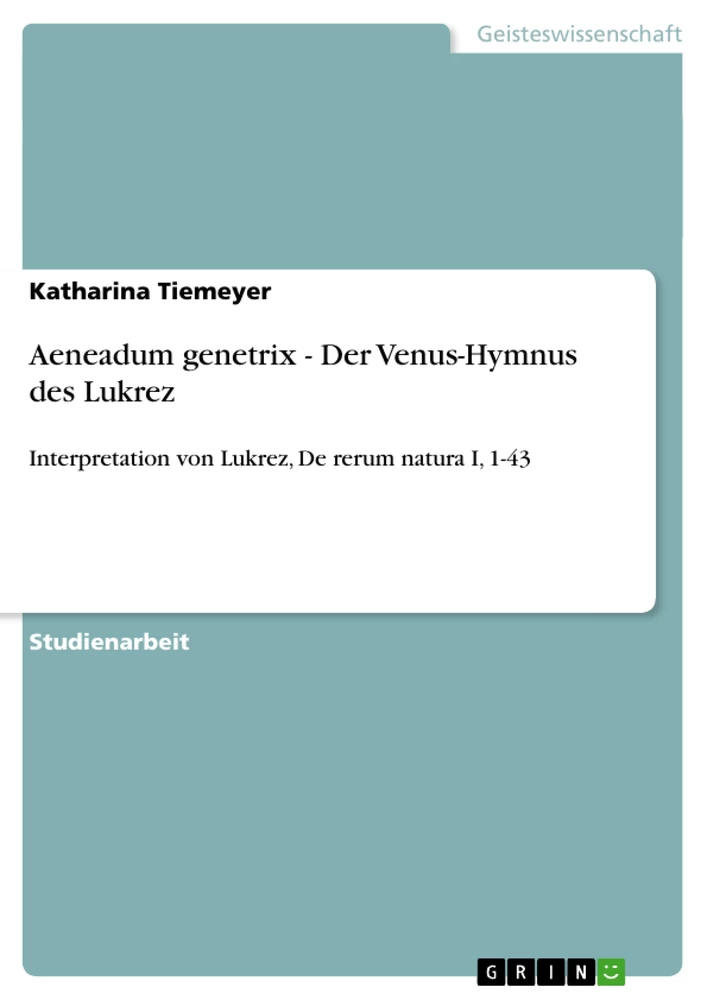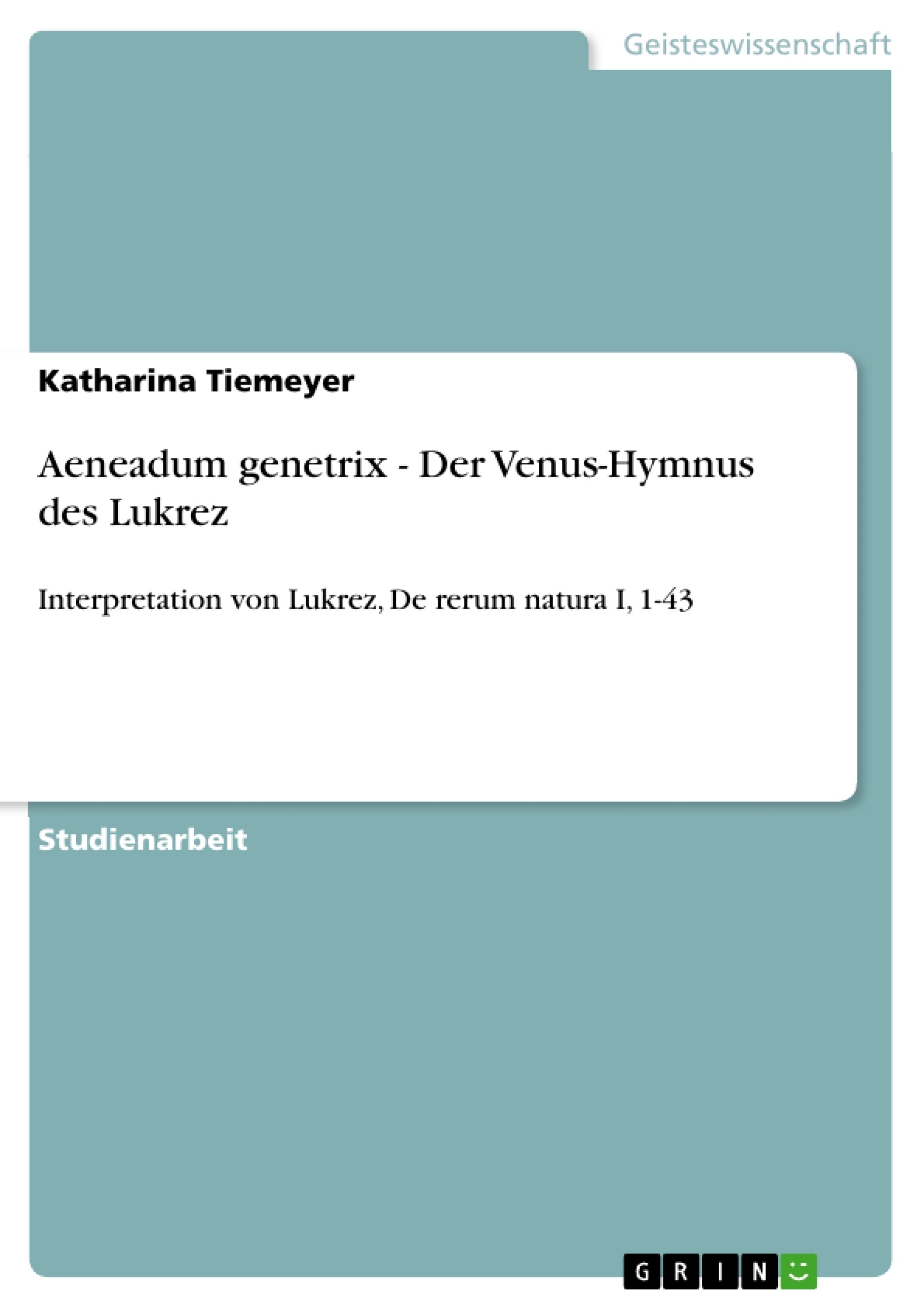I. Einleitung
„Keine Partie an dem an Schwierigkeiten so reichen Lehrgedicht des Lukrez hat in den letzten Jahrzehnten den Philologen mehr Kopfzerbrechen bereitet als das Proömium des 1. Buches“, stellte Karl Barwick bereits 1923 fest. Auch 80 Jahre später hat der Beginn von Lukrez´ De rerum natura nicht an Brisanz eingebüßt und gilt nach wie vor als „ein Dauerproblem der Lukrezforschung“.
Neben Fragen und Untersuchungen zum Aufbau des Proömiums sowie zur Komposition des Gesamtwerkes, bei denen besonders die Echtheit der Verse 44-49 Diskussionsgegenstand ist, beschäftigen die Forschung vor allem die ersten 43 Verse des ersten Proömiums, in denen Lukrez sein um 50 v.Chr. verfasstes Lehrgedicht mit einer Hymne an die Göttin Venus einleitet und sie um Inspiration für seine Dichtung und Frieden für die Römer bittet. Denn wie, so fragt man sich, konnte der Dichter sein Werk über die epikureische Konzeption der Welt, in der die Götter keine Rolle spielen und nicht in das Weltgeschehen eingreifen, ausgerechnet mit der Anrufung einer traditionellen Göttin des Pantheons beginnen lassen und sie darüber hinaus auch noch um Hilfe bitten? Die Antworten der Forschung hierauf erstrecken sich von komplexen und sehr unterschiedlichen Erklärungs- und Rechtfertigungsversuchen bis hin zum hämischen Vorwurf des „Anti-Lucretius“ : deinde vocet demens quos tentat perdere Divos/ immemor ipse sui.
In dieser Arbeit soll der Beginn von De rerum natura einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Dazu soll der Venushymnus des Lukrez (I, 1-43) analysiert und interpretiert werden, um seine Problematik und Brisanz näher zu beleuchten. Der Rest des Proömiums, das bis V.148 reicht, wird nicht in die Textanalyse miteinbezogen, da sich die Venusthematik auf die angegebene Textstelle beschränkt und diese sich insofern vom folgenden Teil des Proömiums absetzt. Gegebenenfalls jedoch wird bei der Interpretation auch auf andere Stellen des Lehrgedichts zurückgegriffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung des Hymnus an Venus (Lukrez, De rerum natura I, 1-43)
- Interpretation des Venushymnus
- Inhalt und Aufbau
- Erläuterungen zum Inhalt
- Sprache und Stil
- Interpretationsansätze in der Forschung
- Textimmanente Deutung
- Diskussion und abschließende Interpretation
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Venushymnus im ersten Buch von Lukrez' De rerum natura und analysiert dessen Problematik und Brisanz im Kontext der epikureischen Philosophie. Ziel der Arbeit ist es, die Funktion des Hymnus innerhalb des Gesamtwerks zu ergründen und seine Bedeutung für die Interpretation der epikureischen Lehre zu beleuchten.
- Die Rolle der Venus als Schöpferin und Lebensspenderin
- Die Verbindung von Natur und Liebe in der epikureischen Philosophie
- Die Funktion des Hymnus als Gegenentwurf zum stoischen Weltbild
- Die Bedeutung des Venushymnus für die Interpretation von Lukrez' De rerum natura
- Die Rezeption des Venushymnus in der Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik des Venushymnus ein, indem sie die Debatte in der Forschung um die Vereinbarkeit des Hymnus mit der epikureischen Philosophie beleuchtet. Das Kapitel „Übersetzung des Hymnus an Venus" bietet eine wortgetreue Übersetzung der Verse 1-43, die die Grundlage für die anschließende Interpretation bildet.
Das Kapitel „Interpretation des Venushymnus" analysiert die Textpassage in ihren einzelnen Bestandteilen. Zunächst wird der Inhalt und Aufbau des Hymnus anhand der einzelnen Verse untersucht. Anschließend werden die sprachlichen Mittel und rhetorischen Figuren analysiert, die Lukrez in seiner Darstellung der Venus verwendet. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die wichtigsten Interpretationsansätze in der Forschung vorgestellt und kritisch diskutiert. Abschließend wird eine eigene textimmanente Deutung des Venushymnus präsentiert.
Das Kapitel „Diskussion und abschließende Interpretation" fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert die unterschiedlichen Deutungsansätze in der Forschung. Es wird eine abschließende Interpretation des Venushymnus präsentiert, die die verschiedenen Aspekte der Textpassage in einen übergeordneten Zusammenhang stellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Venushymnus, Lukrez, De rerum natura, epikureische Philosophie, Stoizismus, Natur, Liebe, Schöpfung, Leben, Frieden, Forschung, Interpretation. Die Arbeit beleuchtet die Funktion des Venushymnus als Einleitung zu Lukrez' philosophischem Lehrgedicht und untersucht, inwiefern er als Gegenentwurf zum stoischen Weltbild verstanden werden kann.
- Arbeit zitieren
- Katharina Tiemeyer (Autor:in), 2006, Aeneadum genetrix - Der Venus-Hymnus des Lukrez, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112097