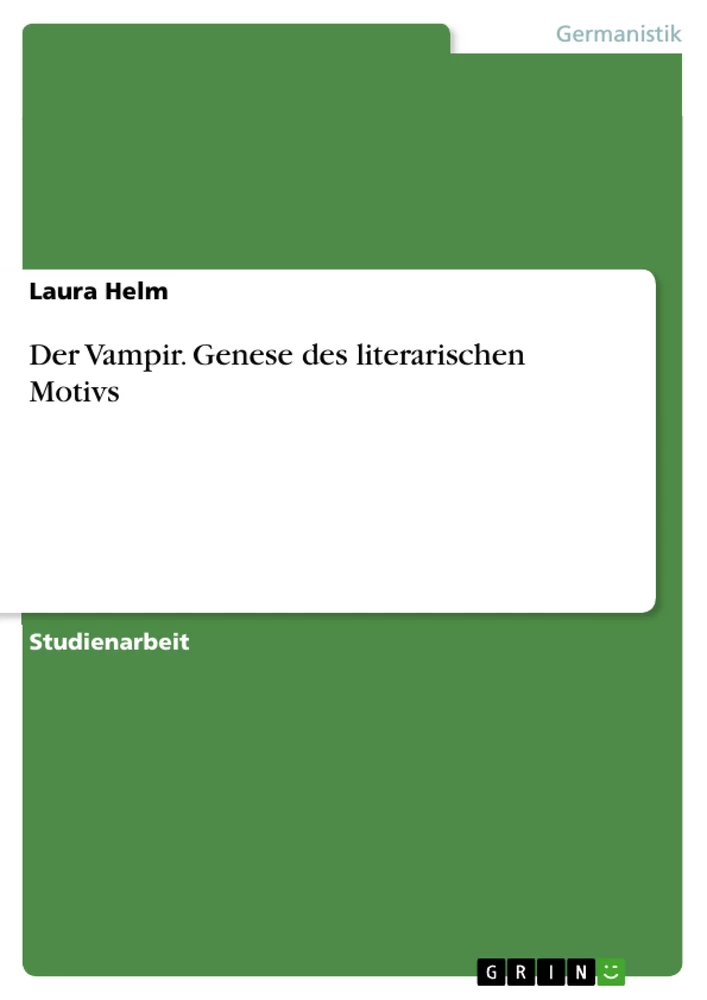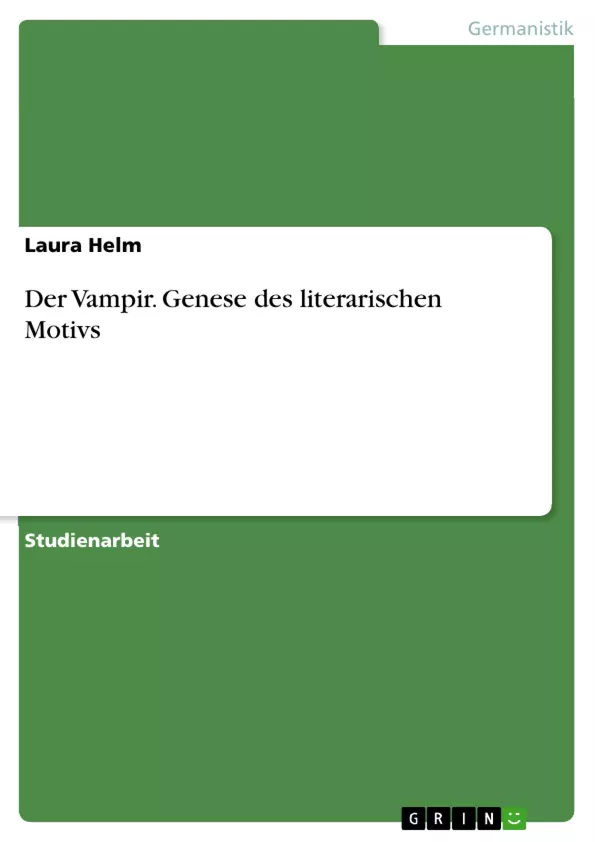In dieser Arbeit soll ansatzweise herausgearbeitet werden, wie aus dem frühgeschichtlichen Dämon über die vermeintliche tatsächliche Existenz des Vampirs über die Jahrhunderte Geistesgeschichte die Menschen begleitete, sich zur Legende (mit-)entwickelte und Eintritt in die Literatur fand. Ferner sollen anhand einer Klassifizierung der verschiedenen Typen von Vampiren die Wirkung, sowie Wirkungsgenese auf den Menschen, und das psychologische, sowie symbolische Potential erschlossen werden. Anhand eines Meilensteins der Vampirliteratur, Johann Wolfgang Goethes „Die Braut von Korinth“ soll schließlich exemplarisch die Reichhaltigkeit der Varianten des Symbolträgers Vampir dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der mythische Vampir
- 3. Der pathologische Vampir
- 3.1 Die Toten stehen auf
- 3.2 Die Einfluss der Kirche
- 3.2.1 Wer wird Vampir
- 3.2.2 Abwehrmaßnahmen
- 3.3 Erklärungsversuche
- 4. Der fiktive Vampir am Beispiel Johann W. von Goethes „Die Braut von Korinth“
- 4.1 Vampirismus
- 4.1.1 Sexualität
- 4.1.2 Emanzipation
- 4.2 Ethisch-moralischer Konflikt
- 4.3 Resümee
- 5. Der reale Vampir
- 5.1 Historische Vampire
- 5.2 Der Vampir in uns
- 5.2.1 Der soziologische Vampir
- 5.2.2 Der moderne Vampir
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Genese des literarischen Vampirmotivs. Ziel ist es, die Entwicklung des Vampirbildes von frühgeschichtlichen Dämonen über vermeintlich reale Existenz bis hin zur literarischen Figur nachzuzeichnen. Die Arbeit klassifiziert verschiedene Vampirtypen und analysiert deren Wirkung und Wirkungsgenese auf den Menschen sowie deren psychologisches und symbolisches Potential. Goethes „Die Braut von Korinth“ dient als exemplarische Fallstudie.
- Entwicklung des Vampirmotivs über die Jahrhunderte
- Klassifizierung verschiedener Vampirtypen
- Wirkung und Wirkungsgenese des Vampirmotivs auf den Menschen
- Psychologisches und symbolisches Potential des Vampirs
- Der Vampir in Goethes „Die Braut von Korinth“ als exemplarische Fallstudie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die aktuelle Popularität des Vampirmotivs. Sie skizziert die Forschungsfrage, die sich mit der Entwicklung des Vampirmotivs von frühgeschichtlichen Dämonen über die vermeintliche reale Existenz bis hin zur literarischen Figur beschäftigt. Der Fokus liegt auf der Klassifizierung der verschiedenen Vampirtypen und der Analyse ihrer Wirkung und des symbolischen Potentials.
2. Der mythische Vampir: Dieses Kapitel untersucht die mythischen Ursprünge des Vampirmotivs. Es beleuchtet verschiedene mythische Figuren aus unterschiedlichen Kulturen, die dem modernen Vampirbild ähneln, wie Lilith aus der jüdischen Tradition, die Lamia aus der griechischen Mythologie und ähnliche Gestalten aus anderen Kulturen. Es zeigt die lange Geschichte des Vampirmotivs und seine vielseitige Ausprägung in verschiedenen Mythen und Legenden auf. Das Kapitel betont die Vielschichtigkeit der mythischen Vorläufer des Vampirs und legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Entwicklung des Motivs.
3. Der pathologische Vampir: Dieses Kapitel behandelt den Vampir als pathologisches Phänomen, insbesondere im Kontext der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft. Es beschreibt die Überzeugungen über Untote und deren angebliche Rückkehr aus dem Grab, den Einfluss der Kirche auf die Deutung und Bekämpfung des Vampirismus (Abwehrmaßnahmen und Erklärungsversuche), und beleuchtet die damaligen Versuche, dieses Phänomen zu erklären. Es wird gezeigt, wie gesellschaftliche Ängste und religiöse Vorstellungen die Entstehung und Verbreitung von Vampirglauben beeinflussten.
4. Der fiktive Vampir am Beispiel Johann W. von Goethes „Die Braut von Korinth“: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Vampirismus in Goethes „Die Braut von Korinth“. Es untersucht, wie Goethe das Motiv des Vampirs nutzt, um Fragen der Sexualität, Emanzipation und ethisch-moralische Konflikte darzustellen. Die Analyse konzentriert sich auf die literarische Umsetzung des Motivs und seine Bedeutung im Kontext des Werkes. Die Bedeutung des Vampirs als Symbolträger wird herausgearbeitet.
5. Der reale Vampir: Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Rezeption des Vampirmotivs und dessen Ausdruck in der Gesellschaft. Es beschreibt historische Fälle, die als Vampirismus interpretiert wurden, und analysiert den soziologischen und modernen Vampir. Es verdeutlicht, wie das Vampirmotiv auch in der Moderne seine Bedeutung behält und sich an neue gesellschaftliche und kulturelle Kontexte anpasst.
Schlüsselwörter
Vampir, Vampirismus, Mythos, Legende, Literatur, Geschichte, Goethe, „Die Braut von Korinth“, Sexualität, Emanzipation, Symbol, Wirkungsgenese, Psychologie, Soziologie, Religion, Mittelalter, Moderne.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Die Entwicklung des Vampirmotivs"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Genese des literarischen Vampirmotivs. Sie verfolgt die Entwicklung des Vampirbildes von frühgeschichtlichen Dämonen über vermeintlich reale Existenz bis hin zur literarischen Figur. Die Arbeit klassifiziert verschiedene Vampirtypen und analysiert deren Wirkung und Wirkungsgenese auf den Menschen sowie deren psychologisches und symbolisches Potential. Goethes „Die Braut von Korinth“ dient als exemplarische Fallstudie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Der mythische Vampir, Der pathologische Vampir, Der fiktive Vampir am Beispiel Johann W. von Goethes „Die Braut von Korinth“, Der reale Vampir und Resümee. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Vampirthematik, von den mythischen Ursprüngen über die historische Wahrnehmung bis hin zur modernen Rezeption.
Was wird im Kapitel "Der mythische Vampir" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die mythischen Ursprünge des Vampirmotivs und beleuchtet verschiedene mythische Figuren aus unterschiedlichen Kulturen, die dem modernen Vampirbild ähneln (z.B. Lilith, Lamia). Es zeigt die lange Geschichte des Vampirmotivs und seine vielseitige Ausprägung in verschiedenen Mythen und Legenden auf.
Was ist der Fokus des Kapitels "Der pathologische Vampir"?
Das Kapitel behandelt den Vampir als pathologisches Phänomen im Mittelalter und der Frühneuzeit. Es beschreibt Überzeugungen über Untote, den Einfluss der Kirche auf die Deutung und Bekämpfung des Vampirismus (Abwehrmaßnahmen und Erklärungsversuche), und beleuchtet damalige Erklärungsversuche. Es wird gezeigt, wie gesellschaftliche Ängste und religiöse Vorstellungen den Vampirglauben beeinflussten.
Wie wird Goethes "Die Braut von Korinth" in der Arbeit behandelt?
Goethes „Die Braut von Korinth“ dient als exemplarische Fallstudie. Das Kapitel analysiert die Darstellung des Vampirismus in diesem Werk und untersucht, wie Goethe das Motiv des Vampirs nutzt, um Fragen der Sexualität, Emanzipation und ethisch-moralische Konflikte darzustellen. Die Bedeutung des Vampirs als Symbolträger wird herausgearbeitet.
Was wird im Kapitel "Der reale Vampir" untersucht?
Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Rezeption des Vampirmotivs und dessen Ausdruck in der Gesellschaft. Es beschreibt historische Fälle, die als Vampirismus interpretiert wurden, und analysiert den soziologischen und modernen Vampir. Es verdeutlicht, wie das Vampirmotiv auch in der Moderne seine Bedeutung behält und sich an neue gesellschaftliche und kulturelle Kontexte anpasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vampir, Vampirismus, Mythos, Legende, Literatur, Geschichte, Goethe, „Die Braut von Korinth“, Sexualität, Emanzipation, Symbol, Wirkungsgenese, Psychologie, Soziologie, Religion, Mittelalter, Moderne.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Vampirbildes nachzuzeichnen und verschiedene Vampirtypen zu klassifizieren. Der Fokus liegt auf der Analyse der Wirkung und des symbolischen Potentials des Vampirmotivs auf den Menschen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Vampirmotivs über die Jahrhunderte, die Klassifizierung verschiedener Vampirtypen, die Wirkung und Wirkungsgenese des Vampirmotivs auf den Menschen, das psychologische und symbolische Potential des Vampirs und den Vampir in Goethes „Die Braut von Korinth“ als exemplarische Fallstudie.
- Arbeit zitieren
- Laura Helm (Autor:in), 2008, Der Vampir. Genese des literarischen Motivs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112195