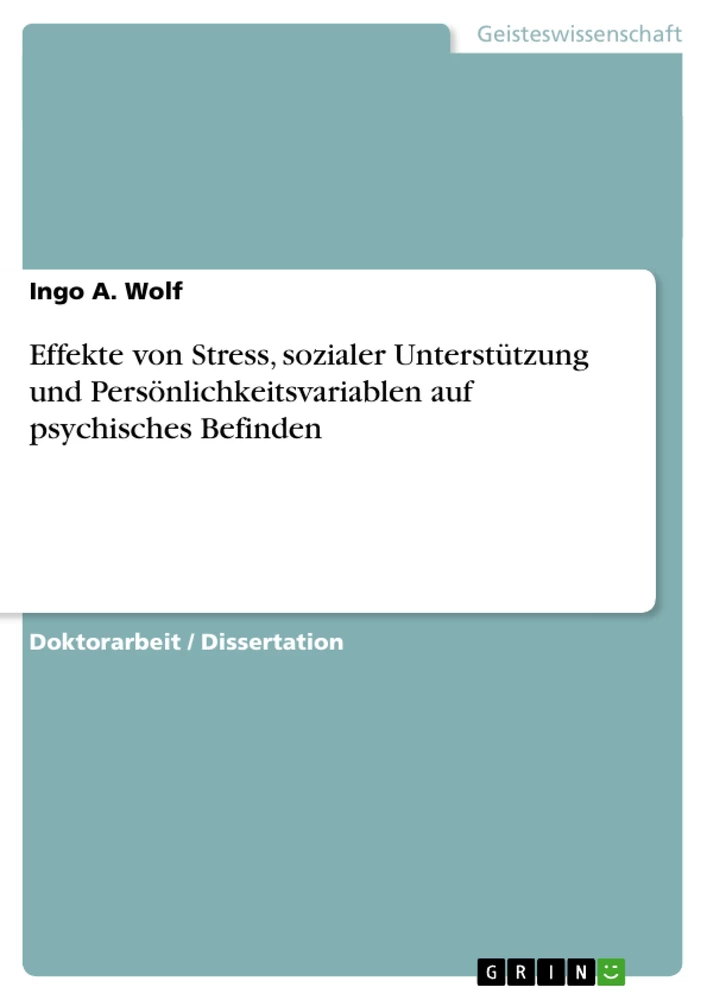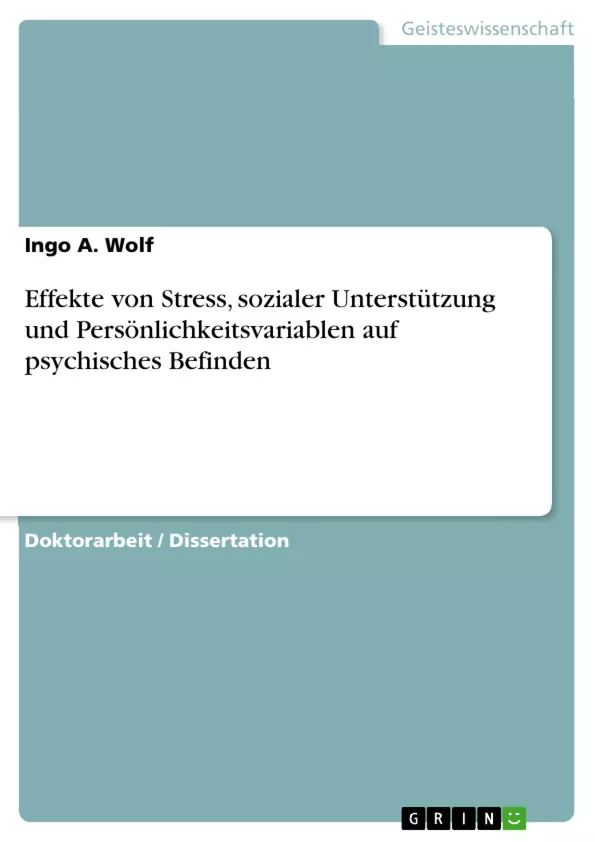Streß ist ein bekanntes Alltagsphänomen, das jeder Mensch erlebt. Die meisten Personen kennen die Erfahrung, daß sie sich „gestreßt“ fühlen. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, daß sich Menschen in ihrer Reaktion auf Streß unterscheiden. Während einige Menschen streß-reaktiv sind und in ihrer physischen und psychischen Gesundheit beeinträchtigt werden, zeigen sich andere streß-resistent und bleiben offensichtlich gesund. Was unterscheidet diese beiden Gruppen von Menschen? Welche unterschiedlichen Faktoren führen dazu, daß eine Frau, deren Ehemann soeben verstorben ist oder ein Mann, dessen Partnerin sich von ihm getrennt hat, in der Folge eine „Depression“ entwickeln und eine andere Frau oder ein anderer Mann, denen jeweils das gleiche Schicksal widerfahren ist, nicht? Warum bekommt ein leitender Angestellter einer Firma einen Herzinfarkt, während sein Kollege sich bester Gesundheit erfreut? Zeichnen sich Menschen in ihrer Reaktion auf Streß durch besondere Eigenschaften aus, welche sind dies, und wie lassen sich diese Merkmale herausfinden?
Forscher, die sich in der jüngeren Vergangenheit mit diesen Fragen beschäftigt haben, fanden bei ihren Untersuchungen heraus, daß Personen, die verschieden auf Streß reagieren, sich unter anderem durch das ihnen zuteil werdende Ausmaß an sozialem Rückhalt unterscheiden. Materielle Hilfen, Sympathie und Zuwendung seitens Angehöriger, Freunde und Arbeitskollegen scheinen offensichtlich Menschen vor den schädigenden Wirkungen von Streß zu schützen. Noch nicht ausreichend geklärt ist jedoch die Frage, ob nicht bestimmte persönliche Eigenschaften von Menschen wie z.B. Ängstlichkeit oder Selbstwertschätzung für den Streß-Schutzeffekt von sozialer Unterstützung indirekt verantwortlich sind. Mehr Licht in das Dunkel dieses unklaren Sachverhalts zu bringen, ist das Ziel dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- DANKEND ERWÄHNT
- VORWORT
- 1. EINLEITUNG
- 2. THEORETISCHER UND EMPIRISCHER HINTERGRUND
- 2.1 Einführung in die Problemstellung - Die Verbindung zwischen Streß und Gesundheit
- 2.2 Streß
- 2.2.1 Die Konzeptualisierung von Streß und Stressoren
- 2.2.2 Die Operationalisierung von Streß und Stressoren: Entwicklung von diagnostischen Meßinstrumenten
- 2.2.3 Scheidung / Trennung, Partnerschaftskonflikt und Prüfung als Beispiele für Streß
- 2.3 Soziale Unterstützung
- 2.3.1 Die Konzeptualisierung von sozialer Unterstützung
- 2.3.2 Die Operationalisierung von sozialer Unterstützung: Entwicklung von diagnostischen Instrumenten
- 2.3.3 Modelle zur Wirksamkeit sozialer Unterstützung
- Die Vielfalt formaler Modelle
- Das Haupteffekt—Modell
- Das Puffereffekt—Modell
- 2.4 Persönlichkeitsvariablen in ihrer Beziehung zu Streß und sozialer Unterstützung
- 2.4.1 Persönlichkeitsvariablen als Moderatoren von Streß und in Verbindung mit sozialer Unterstützung
- 2.4.2 Einsamkeit, Selbstwert und Ängstlichkeit
- Einsamkeit
- Selbstwert
- Ängstlichkeit
- 2.5 Ableitung des psychologischen Untersuchungsgegenstands
- 3. METHODE
- 3.1 Psychologische Hypothesen
- Haupthypothesen
- Nebenhypothesen
- Weitere interessierende Berechnungen
- Testtheoretische Überprüfungen
- 3.2 Untersuchungsplanung
- 3.2.1 Versuchsplan
- 3.2.2 Unabhängige und abhängige Variablen
- 3.2.3 Störvariablen
- 3.2.4 Untersuchungsablauf
- 3.3 Konkretisierung der Variablen, Meßinstrumente
- Studie 1
- Studie 2
- 3.4 Probanden
- Studie 1
- Studie 2
- 3.5 Formalisierte und operationalisierte Hypothesen
- 3.5.1 Formalisierung der Hypothesen
- 3.5.2 Operationalisierung der Hypothesen
- 3.6 Untersuchungsauswertung
- 3.6.1 Statistische Verfahren, Testplanung, Entscheidungskriterien
- 3.6.2 Beschreibung der Datenauswertung
- 3.1 Psychologische Hypothesen
- 4. ERGEBNISSE
- 4.1 Demographische Daten der Stichproben
- 4.2 Deskriptive Daten von Skalen
- 4.2.1 Faktorenanalysen
- 4.2.2 Verteilungsparameter der Skalen
- 4.2.3 Reliabilitäten der Skalen
- 4.3 Inwiefern unterscheiden sich Personen mit Partnertrennung in Vergangenheit, Partnertrennung in Zukunft, Partnertrennung in Vergangenheit und Zukunft, Prüfung in Zukunft, Kontrollpersonen und Erstsemesterstudenten?
- 4.4 Querschnittskorrelationen
- Gesamtstichprobe von Studie 2
- Teilstichproben von Studie 2
- 4.5 Gibt es Geschlechtsunterschiede?
- 4.6 Haupteffekte von sozialer Unterstützung
- 4.7 Puffereffekte von sozialer Unterstützung
- 4.7.1 Gibt es Puffereffekte von sozialer Unterstützung?
- 4.7.2 Sind Persönlichkeitsvariablen primär für den Puffereffekt von sozialer Unterstützung verantwortlich?
- 4.7.3 Gibt es primär einen Puffereffekt von Unterstützung unter Kontrolle von Persönlichkeitsvariablen (Suppressionseffekt)?
- 4.8 Interaktionseffekte von Persönlichkeitsvariablen mit Streß
- 4.8.1 Gibt es Interaktionseffekte von Persönlichkeitsvariablen mit Streß?
- 4.8.2 Ist soziale Unterstützung / Belastung oder eine zweite Persönlichkeitsvariable primär für den Interaktionseffekt von Persönlichkeitsvariablen mit Streß verantwortlich?
- 4.8.3 Gibt es primär einen Interaktionseffekt von Persönlichkeitsvariablen mit Streß unter Kontrolle von Unterstützung, Belastung oder einer zweiten Persönlichkeitsvariable (Suppressionseffekt)?
- 4.9 Diskriminieren Persönlichkeitsvariablen zwischen Personen, für die Unterstützung unter Streß hilfreich, hinderlich oder unwirksam ist?
- 4.10 Beeinflußt wahrgenommene soziale Unterstützung die Entwicklung und Erhaltung von relativ stabilen Persönlichkeitsvariablen oder von Depressivität?
- 4.11 Beeinflußt Depressivität die Entwicklung und Erhaltung von wahrgenommener sozialer Unterstützung?
- 4.12 Inwiefern stellt die Operationalisierung von Streß in wahrgenommenen Streß in der Form der Perceived Stress Scale (PSS) eine unabhängige Variable dar?
- 5. DISKUSSION
- 5.1 Demographische und deskriptive Daten sowie Verteilungsparameter von Skalen
- 5.2 Gruppenunterschiede
- 5.3 Querschnittskorrelationen, Geschlechtsunterschiede, Haupteffekte von sozialer Unterstützung
- 5.4 Puffereffekte von sozialer Unterstützung
- 5.4.1 Gibt es Puffereffekte von sozialer Unterstützung?
- 5.4.2 Sind Persönlichkeitsvariablen primär für den Puffereffekt von sozialer Unterstützung verantwortlich?
- 5.5 Interaktionseffekte von Persönlichkeitsvariablen mit Streß
- 5.5.1 Gibt es Interaktionseffekte von Persönlichkeitsvariablen mit Streß?
- 5.5.2 Ist soziale Unterstützung / Belastung oder eine zweite Persönlichkeitsvariable primär für den Interaktionseffekt von Persönlichkeitsvariablen mit Streß verantwortlich?
- 5.6 Diskriminieren Persönlichkeitsvariablen zwischen Personen, für die Unterstützung unter Streß hilfreich, hinderlich oder unwirksam ist?
- 5.7 Beeinflußt wahrgenommene soziale Unterstützung die Entwicklung und Erhaltung von relativ stabilen Persönlichkeitsvariablen oder von Depressivität?
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
- 7. LITERATURVERZEICHNIS
- 8. ANHÄNGE
- Anhang A: Fragebogen
- Anhang B: Parameter von demographischen Daten
- Anhang C: Konfidenzintervalle der Korrelationskoeffizienten
- TABELLENVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit den Auswirkungen von Stress auf das psychische Befinden und analysiert die moderierenden Effekte von sozialer Unterstützung und Persönlichkeitsvariablen. Die Arbeit zielt darauf ab, das Wissen über die Wirkungsweise von sozialen Beziehungen und deren Verbindungen zu anderen Merkmalen zu erweitern.
- Stress und psychisches Befinden
- Soziale Unterstützung als Streßmoderator
- Persönlichkeitsvariablen als Streßmoderatoren
- Interaktion von sozialer Unterstützung und Persönlichkeitsvariablen mit Streß
- Dreifach-Interaktionen zwischen Streß, sozialer Unterstützung und Persönlichkeitsvariablen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Dissertation beginnt mit einer umfassenden Einführung in die Thematik von Stress und Gesundheit, wobei die Konzepte des Transaktionalen Streß-Modells und des COR-Modells vorgestellt werden. Die Operationalisierung von Streß und Stressoren wird anhand verschiedener Meßinstrumente wie der Social Readjustment Rating Scale (SRRS), der Psychiatric Epidemiology Research Interview (PERI) Life Events Scale und der Perceived Stress Scale (PSS) erläutert.
Im nächsten Kapitel werden die Konzepte der sozialen Unterstützung und deren Operationalisierung in Meßinstrumente wie den Fragebogen für soziale Unterstützung (F-SOZU) und die Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) erörtert. Die verschiedenen Modelle zur Wirksamkeit sozialer Unterstützung, insbesondere das Haupteffekt-Modell und das Puffereffekt-Modell, werden detailliert dargestellt.
Kapitel 2.4 widmet sich der Untersuchung von Persönlichkeitsvariablen als Moderatoren von Streß und in Verbindung mit sozialer Unterstützung. Die Dissertation beleuchtet dabei die Rolle von Variablen wie Kontrollüberzeugung, Selbstwert, Ängstlichkeit und Einsamkeit.
Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Dissertation, inklusive der Versuchsplanung, der verwendeten Variablen und Meßinstrumente, sowie der statistischen Verfahren und Entscheidungskriterien.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, die sowohl die Gesamtstichprobe als auch die Teilstichproben analysiert. Die Ergebnisse werden anhand von Tabellen und Abbildungen visualisiert und interpretiert.
Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Dissertation und setzt sie in den Kontext der bisherigen Forschung. Die Dissertation beleuchtet dabei die Bedeutung der verschiedenen Konzeptualisierungen von Streß und die Rolle von Persönlichkeitsvariablen bei der Moderation des Stressverarbeitungsprozesses.
Die Dissertation schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Stress, soziale Unterstützung, Persönlichkeitsvariablen, psychisches Befinden, Depressivität, Ängstlichkeit, Einsamkeit, Selbstwert, Puffereffekt, Interaktionseffekte, Lebensereignisse, wahrgenommener Streß, und die Bewältigung von Streß.
- Arbeit zitieren
- Ingo A. Wolf (Autor:in), 1998, Effekte von Stress, sozialer Unterstützung und Persönlichkeitsvariablen auf psychisches Befinden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112218