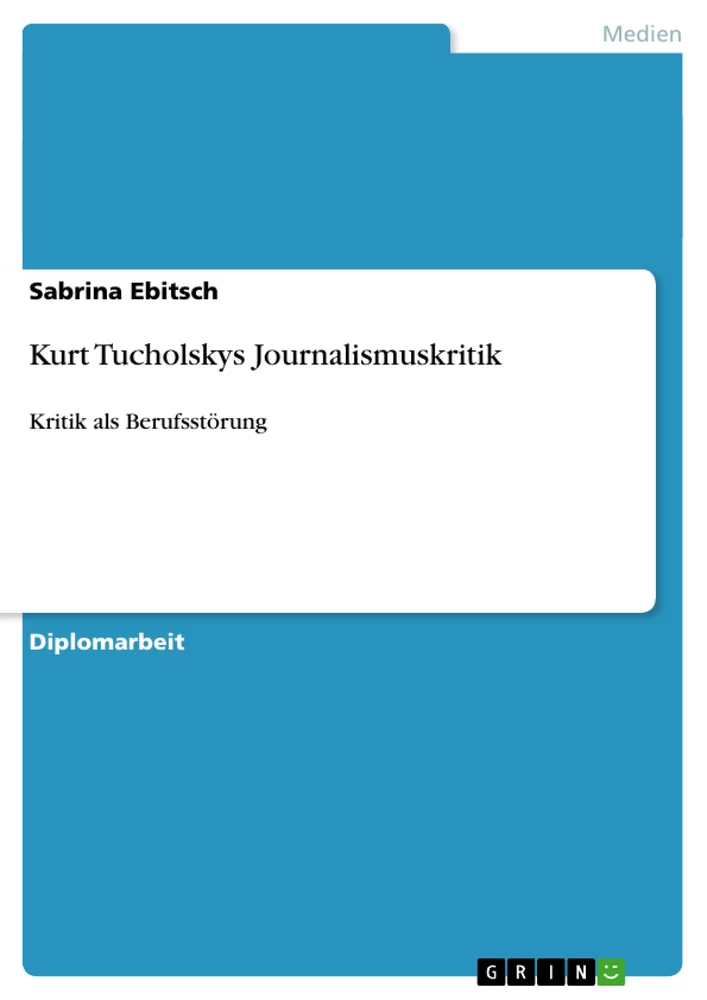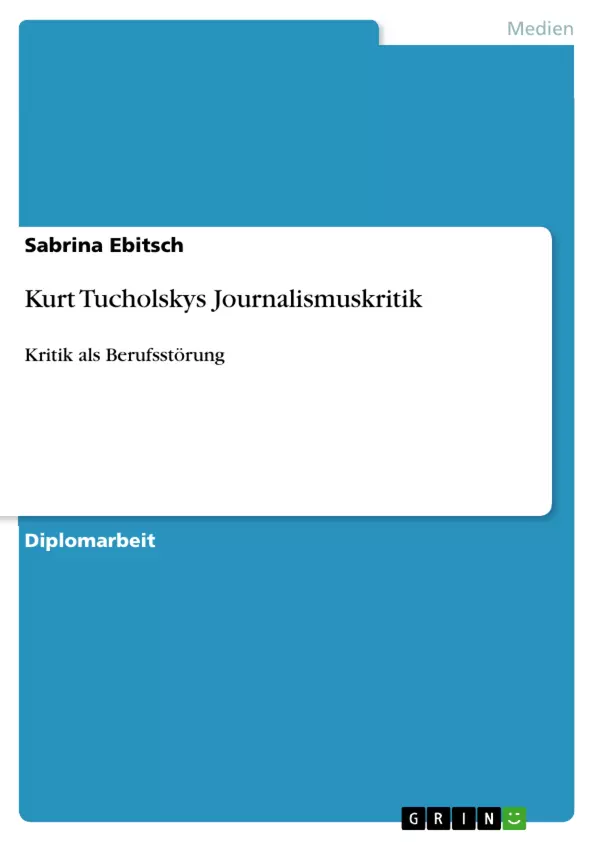Selbst einer der prominentesten Journalisten der Weimarer Republik gehört Kurt Tucholsky zu den härtesten Kritikern der eigenen Zunft. Neben Militär, Justiz und Bourgeoisie sind die Presse und ihre „Schmöcke“ ein Schwerpunkt seiner Gesellschaftskritik. Tucholskys differenzierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Berufsfeld spielt sich auf mehreren Ebenen ab – von der externen der Inserenten und Leser, über die institutionelle Ebene der Verlage bis hin zu jener journalistischen Handelns und seiner Akteure. Scheiternd an den eigenen hochgesteckten Ansprüchen greift Tucholsky aber letztlich in einem „kleinen Akt der Selbstzerstörung“ (GW Bd. 5, S. 435) als eigentlichem Movens seiner Journalismuskritik im Anderen sich selbst an.
Inhaltsverzeichnis
- PROBLEMSTELLUNG UND HERANGEHENSWEISE
- KOMMUNIKATIONSTHEORETISCHE EINORDNUNG
- KURT TUCHOLSKY ALS JOURNALIST
- DIE PRESSE ZU LEBZEITEN TUCHOLSKYS
- Die Presse um die Jahrhundertwende und im Krieg
- Gesinnungs- vs. Massenpresse
- Das Verhältnis von Presse und Staat
- Presse im Krieg: Zwischen Pathos und Zensur
- Die Presse in der Weimarer Republik
- Revolution und Kontinuität
- Stabilität und Radikalisierung
- Überblick über die Weimarer Presselandschaft
- Zeitungen
- Zeitschriften
- Die Weltbühne
- Der Niedergang der Weimarer Republik
- KURT TUCHOLSKYS KRITIK AM JOURNALISMUS
- Das negative Gesamtbild der Presse
- Außerhalb des Mediums: Die Kommunikationspartner
- Die Rolle von Lesern und Abonnenten
- Beeinflussung durch die Inserenten
- Einwirkung industrieller Teilhaber
- Einfluss von Staat und Obrigkeit
- Die Ebene des Mediums
- Realität und Medienrealität
- Journalismus als ökonomisches Instrument
- Absatzsteigerung durch die Aufmachung
- Absatzsteigerung durch Sensationalisierung
- Die Presse zwischen geschäftlichem und öffentlichem Interesse
- Journalismus als publizistisches Instrument
- Parteilichkeit der Informationszeitungen
- Kriegspropaganda statt Kriegsberichterstattung
- Die Richtungspresse
- Exkurs I: Rundfunk
- Exkurs II: Frankreich
- Die Ebene des Einzelnen: Journalistisches Handeln
- Journalistische Basiskompetenzen
- Das Medium Sprache
- Der „Schmock" als typischer Journalist?
- Unwahrhaftigkeit
- Plagiate
- Die Ebene journalistischen Handelns: Vermittlungsformen
- Politische Berichterstattung
- Feuilleton
- Reportage
- Der Auslandskorrespondent
- Satire und Witzblätter
- Exkurs III: Foto
- FAZIT: JOURNALISMUSTHEORIEN DES PUBLIZISTEN
- LITERATURVERZEICHNIS
- Quellen
- Kurt-Tucholsky-Ausgaben
- Sonstige Primärliteratur
- Sekundärliteratur zu Kurt Tucholsky
- Mediengeschichte
- Zeitgeschichtlicher Hintergrund
- Methodik
- Kommunikationswissenschaftliche Theorie
- Zeitungs- und Zeitschriftenartikel
- Internetquellen
- Tucholskys Kritik an der Abhängigkeit der Presse von verschiedenen Interessengruppen
- Die Rolle der Sprache im Journalismus und Tucholskys Kritik an sprachlichen Verfehlungen
- Die Bedeutung von Objektivität und Neutralität im Journalismus
- Tucholskys Kritik an der Sensationalisierung und Boulevardisierung der Presse
- Die Rolle des Publizisten im Journalismus und Tucholskys eigene Rolle als politischer Publizist
- PROBLEMSTELLUNG UND HERANGEHENSWEISE
- KOMMUNIKATIONSTHEORETISCHE EINORDNUNG
- KURT TUCHOLSKY ALS JOURNALIST
- DIE PRESSE ZU LEBZEITEN TUCHOLSKYS
- KURT TUCHOLSKYS KRITIK AM JOURNALISMUS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Sabrina Ebitsch widmet sich der Journalismuskritik von Kurt Tucholsky. Die Arbeit analysiert seine Schriften, um Tucholskys eigene Theorie des Journalismus zu rekonstruieren. Sie untersucht, wie er das Pressewesen seiner Zeit kritisch betrachtet und welche normativen Forderungen er an die Medien und die dort tätigen Journalisten stellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit stellt die Problemstellung dar, dass sich weder die Germanistik noch die Journalistik, Publizistik- und Kommunikationswissenschaften intensiv mit Kurt Tucholsky als Journalist beschäftigt haben. Die Arbeit will Tucholskys Kritik am Journalismus untersuchen und eine eigene Journalismustheorie des Autors entwickeln.
Dieses Kapitel stellt die zeitungswissenschaftliche Theorie der Münchner Schule vor und erklärt die Unterscheidung zwischen Journalist und Publizist. Es wird erläutert, wie die Theorie die Massenkommunikation als einen gegenseitigen Mitteilungsverkehr versteht und die Rolle des Journalismus als unparteiliche Vermittlung von Kommunikationspartnern beschreibt.
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Tucholskys Leben und Werk, insbesondere über seine journalistische Karriere. Es beleuchtet seine frühen journalistischen Arbeiten, seine Zeit beim Ulk und bei der Weltbühne, seine Mitarbeit an der Propagandazeitschrift Pieron, seinen Rückzug aus dem Journalismus und seine spätere Rückkehr. Es wird auch auf seine politischen und gesellschaftlichen Ansichten sowie seine persönlichen Beziehungen eingegangen.
Dieses Kapitel beschreibt die Presselandschaft des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Es beleuchtet die Entwicklung der Massenpresse, die Rolle von Parteien und Unternehmen in der Presse, die Auswirkungen der Inflation und die Zunahme von Zensurmaßnahmen. Es wird auch auf die verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften eingegangen, die zu Tucholskys Zeiten existierten, einschließlich der Weltbühne, und ihre jeweiligen politischen Tendenzen.
Dieses Kapitel analysiert Tucholskys Kritik am Journalismus. Es werden seine Kritikpunkte an der Abhängigkeit der Presse von verschiedenen Interessengruppen, an der mangelnden Kompetenz und dem schlechten Ethos der Journalisten, an der Sensationalisierung und Boulevardisierung der Presse sowie an der Tendenziösität der Berichterstattung in Informations- und Richtungszeitungen behandelt. Es wird auch auf seine Kritik am Rundfunk und am französischen Journalismus eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Journalismuskritik, die Medienlandschaft des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, die Rolle von Parteien und Unternehmen in der Presse, die Bedeutung von Objektivität und Neutralität im Journalismus, die Sensationalisierung und Boulevardisierung der Presse, die Tendenziösität der Berichterstattung, die Rolle des Publizisten im Journalismus, die Bedeutung von Sprache im Journalismus, die Kritik an sprachlichen Verfehlungen, die Kritik an der Abhängigkeit der Presse von verschiedenen Interessengruppen, die Bedeutung von Satire und Witzblättern, die Rolle des Auslandskorrespondenten, die Bedeutung von Fotografie im Journalismus und die Kritik an der Rundfunkzensur.
- Citar trabajo
- Sabrina Ebitsch (Autor), 2004, Kurt Tucholskys Journalismuskritik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112225