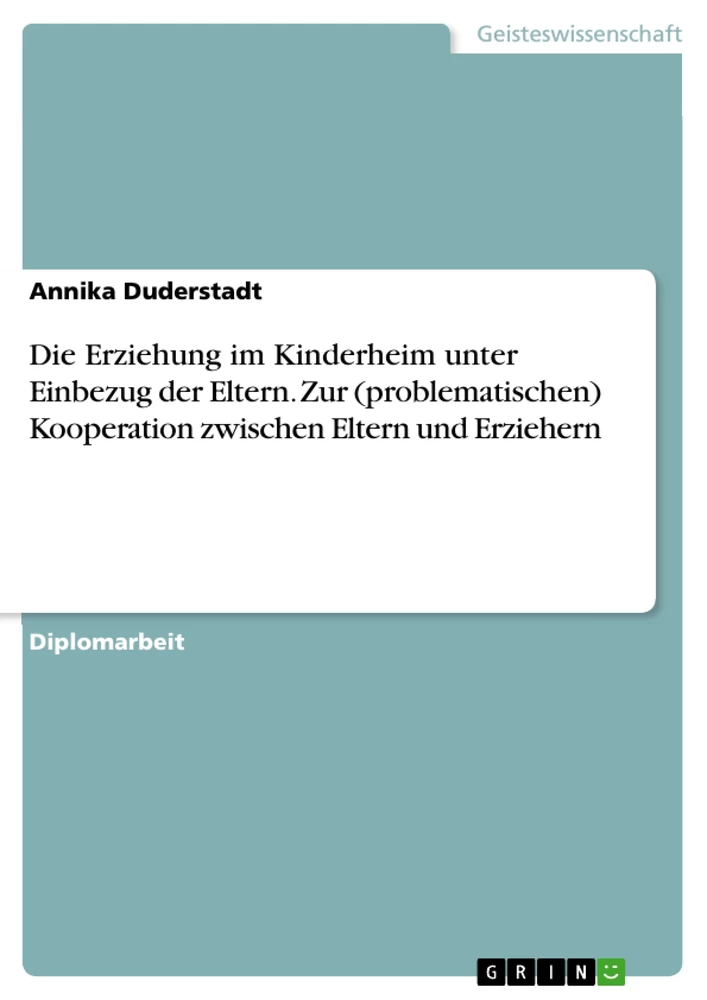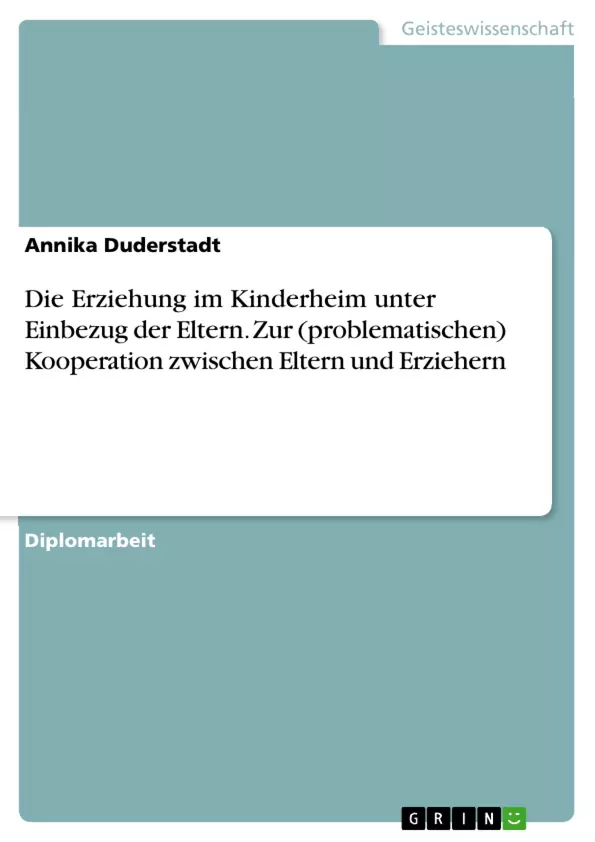Der Mythos vom Heim als totale Institution, in der Kinder und Jugendliche „aufbewahrt“ werden, entspricht schon lange nicht mehr den Zuständen stationärer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Deutschland. Vielmehr hat auch hier eine Modernisierung stattgefunden, die zu einer ausdifferenzierten Heimlandschaft beigetragen hat. Nichtsdestotrotz sind Heime auch heutzutage vor allem Lebensorte für Kinder, deren Eltern mit der Erziehung überfordert sind und deshalb staatlicher Unterstützung bedürfen.
Heimkinder waren in ihrer Herkunftsfamilie häufig schwierigsten Bedingungen ausgesetzt, die einen dortigen Verbleib unmöglich gemacht haben. Wenn Heimmitarbeiter von den teils traumatischen Erlebnissen der Kinder erfahren, sind sie leicht dazu geneigt, einseitig für das Kind Partei zu ergreifen und sich damit gegen die Eltern des Kindes zu stellen. Die Einbeziehung der Eltern ist dabei für sie nicht mit dem Kindeswohl vereinbar, schließlich haben sich die Eltern durch ihre schädigenden Handlungen das Recht auf die Pflege und Erziehung ihres Kindes verwirkt. Doch eine derart starre Haltung der Fachkräfte, kann vor dem Hintergrund der aktuellen rechtlichen Lage nicht aufrecht erhalten werden, da die Heime einen gesetzlichen Auftrag haben, der sie zur Elternarbeit verpflichtet.
Wie eine solche Kooperation zwischen Fachkräften und Eltern zu gestalten ist, darüber herrscht bisher noch Uneinigkeit, da es begünstigt durch die Formenvielfalt der Heime bisher keine einheitlichen Standards zur Umsetzung dieser Aufgabe gibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Situation der Heimerziehung in Deutschland heute
- 2.1. Heimerziehung im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
- 2.2. Aufgaben und Ziele von Heimerziehung
- 2.3. Formen von Heimerziehung
- 2.4. Heimerziehung in Zahlen
- 2.5. Wirksamkeit von Heimerziehung
- 3. Die Familie von Heimkindern
- 3.1. Familiäre Situation von Heimkindern
- 3.2. Familie als System
- 3.3. Systemisches Problemverständnis
- 3.4. Heimerziehung als Lösungsversuch
- 4. Elternarbeit in der Heimerziehung
- 4.1. Definition von Elternarbeit
- 4.2. Notwendigkeit und Ziele von Elternarbeit
- 4.3. Rahmenbedingungen von Elternarbeit
- 4.4. Qualifikation der Heimmitarbeiter für Elternarbeit
- 4.5. Zusammenarbeit zwischen Heimmitarbeitern und Eltern
- 4.5.1. Haltung der Mitarbeiter
- 4.5.2. Eltern als Partner oder Konkurrenten im Erziehungsprozess?
- 4.5.3. Mitarbeit der Eltern
- 4.5.4. Elternarbeit in der Praxis
- 5. Formen und Methoden der Elternarbeit
- 5.1. Gespräche
- 5.2. Elterngruppen
- 5.3. Elternarbeit als Trauerarbeit
- 5.4. Elternarbeit ohne Eltern
- 5.5. Elternarbeit als Familientherapie
- 6. Hindernisse und Grenzen der Elternarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Notwendigkeit von Elternarbeit in der Heimerziehung in Deutschland. Sie beleuchtet die aktuelle Situation der Heimerziehung, die familiäre Situation von Heimkindern unter Einbezug systemischer Theorie, und analysiert die Elternarbeit hinsichtlich ihrer Notwendigkeit, Methoden und Grenzen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Qualifikation der Mitarbeiter und der Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern.
- Die aktuelle Situation der Heimerziehung in Deutschland
- Die familiäre Situation von Heimkindern und systemisches Problemverständnis
- Notwendigkeit und Ziele der Elternarbeit in der Heimerziehung
- Methoden und Formen der Elternarbeit
- Hindernisse und Grenzen der Elternarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Wandel der Heimerziehung in Deutschland weg vom Mythos der totalen Institution hin zu einer modernisierten Form der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Notwendigkeit der Einbeziehung der Eltern in den Hilfeprozess und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf Kindern unter 14 Jahren, bei denen die Bedeutung der Eltern für die Entwicklung unstrittig ist. Die Einleitung betont das persönliche Interesse der Autorin an dem Thema aufgrund ihrer zukünftigen Tätigkeit im Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe.
2. Situation der Heimerziehung in Deutschland heute: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Heimerziehung im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII). Es beschreibt die Aufgaben und Ziele von Heimerziehung, verschiedene Formen, statistische Daten und die Wirksamkeit dieser Hilfeform. Es wird deutlich gemacht, dass Heimerziehung ein rechtlich definierter Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe ist und trotz des Wandels immer noch ein wichtiger Bestandteil der Hilfestellung für Kinder aus belasteten Familienverhältnissen darstellt. Die Effektivität wird kritisch hinterfragt und ein Bezug zu den Kosten und den Erwartungen der Jugendämter hergestellt.
3. Die Familie von Heimkindern: Dieses Kapitel beleuchtet die familiäre Situation von Heimkindern, die in der Mehrzahl aus belasteten Verhältnissen stammen und oft durch auffälliges Verhalten in ihrem sozialen Umfeld auffallen. Durch die Anwendung systemischer Theorie wird der Blick vom Kind als alleinigem Problemträger auf das gesamte Eltern-Kind-System erweitert. Es wird erörtert, wie die Entstehung von Problemen innerhalb des Familiensystems verstanden werden kann und ob Heimerziehung in diesem Kontext einen angemessenen Lösungsversuch darstellt. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Familiendynamik als Grundlage für die weitere Betrachtung der Elternarbeit.
4. Elternarbeit in der Heimerziehung: Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in diesem Kapitel auf der Elternarbeit. Es definiert den Begriff Elternarbeit, untersucht deren Notwendigkeit und Ziele, und beleuchtet die Rahmenbedingungen für die Heimmitarbeiter. Ein wichtiger Aspekt ist die Qualifikation der Mitarbeiter und deren Einfluss auf die Haltung gegenüber den Eltern sowie die methodische Gestaltung der Zusammenarbeit. Es wird die Frage nach der optimalen Qualifikation der Mitarbeiter diskutiert, ob diese Aufgabe von Spezialisten oder den Heimmitarbeitern übernommen werden sollte. Die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit, von informellen Kontakten bis hin zur Familientherapie, werden angesprochen.
5. Formen und Methoden der Elternarbeit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die praktische Umsetzung der Elternarbeit und stellt verschiedene Methoden vor, die in der stationären Kinder- und Jugendhilfe relevant sind. Es werden ausgewählte, wichtige Methoden vorgestellt, um einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der Elternarbeit zu geben. Die Auswahl konzentriert sich auf Methoden, die in der Praxis Anwendung finden und eine positive Veränderung bei Kind und Familie herbeiführen können.
6. Hindernisse und Grenzen der Elternarbeit: Das Kapitel 6 befasst sich mit den Grenzen und Hindernissen der Elternarbeit. Es untersucht die Situationen, in denen Elternarbeit nicht leistbar ist oder durch ungünstige Bedingungen erschwert wird. Hier werden Faktoren wie die Ressourcen der Einrichtung, die Bereitschaft der Eltern zur Zusammenarbeit und die Komplexität der familiären Situation beleuchtet, und die Herausforderungen für eine effektive Elternarbeit verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Heimerziehung, Elternarbeit, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Systemische Theorie, Familienarbeit, Heimmitarbeiter, Qualifikation, Zusammenarbeit Eltern-Fachkräfte, Kindeswohl, stationäre Hilfen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über Elternarbeit in der Heimerziehung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit über Heimerziehung?
Die Arbeit untersucht die Notwendigkeit von Elternarbeit in der Heimerziehung in Deutschland. Sie beleuchtet die aktuelle Situation der Heimerziehung, die familiäre Situation von Heimkindern (unter Berücksichtigung systemischer Theorie) und analysiert die Elternarbeit hinsichtlich ihrer Notwendigkeit, Methoden und Grenzen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Qualifikation der Mitarbeiter und der Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Arbeit beinhaltet Einleitung, ein Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen, Zielsetzung, Themenschwerpunkte und Schlüsselwörter.
Welche Aspekte der Heimerziehung werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Heimerziehung, darunter die rechtlichen Rahmenbedingungen (SGB VIII), Aufgaben und Ziele, verschiedene Formen der Heimerziehung, statistische Daten, die Wirksamkeit, die familiäre Situation der Heimkinder, sowie ein systemisches Problemverständnis. Ein zentrales Thema ist die Elternarbeit, inklusive Definition, Notwendigkeit, Zielen, Methoden, Rahmenbedingungen, Qualifikation der Mitarbeiter und Herausforderungen.
Wie wird die familiäre Situation von Heimkindern betrachtet?
Die familiäre Situation der Heimkinder wird unter Einbezug systemischer Theorie betrachtet. Der Fokus liegt nicht nur auf dem Kind als alleinigem Problemträger, sondern auf dem gesamten Eltern-Kind-System. Es wird untersucht, wie Probleme innerhalb des Familiensystems entstehen und ob Heimerziehung in diesem Kontext ein angemessener Lösungsversuch darstellt. Die Familiendynamik bildet die Grundlage für die Betrachtung der Elternarbeit.
Welche Rolle spielt die Elternarbeit in der Heimerziehung?
Elternarbeit spielt eine zentrale Rolle in der Arbeit. Die Arbeit definiert den Begriff, untersucht Notwendigkeit und Ziele, beleuchtet die Rahmenbedingungen für Heimmitarbeiter, die Qualifikation der Mitarbeiter und deren Einfluss auf die Haltung gegenüber den Eltern, sowie die methodische Gestaltung der Zusammenarbeit. Verschiedene Formen der Zusammenarbeit, von informellen Kontakten bis hin zur Familientherapie, werden diskutiert.
Welche Methoden der Elternarbeit werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Methoden der Elternarbeit vor, die in der stationären Kinder- und Jugendhilfe relevant sind, wie z.B. Gespräche, Elterngruppen, Elternarbeit als Trauerarbeit, Elternarbeit ohne Eltern und Elternarbeit als Familientherapie. Der Fokus liegt auf Methoden mit praktischer Relevanz und positivem Einfluss auf Kind und Familie.
Welche Hindernisse und Grenzen der Elternarbeit werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet Hindernisse und Grenzen der Elternarbeit, wie z.B. die Ressourcen der Einrichtung, die Bereitschaft der Eltern zur Zusammenarbeit und die Komplexität der familiären Situation. Es werden Herausforderungen für eine effektive Elternarbeit verdeutlicht, in denen Elternarbeit nicht leistbar ist oder durch ungünstige Bedingungen erschwert wird.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe umfasst Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe, Studierende der Sozialen Arbeit und alle Interessierten, die sich mit Heimerziehung und Elternarbeit auseinandersetzen. Die Arbeit ist auf eine akademische Zielgruppe ausgerichtet, die sich wissenschaftlich mit dem Thema befasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heimerziehung, Elternarbeit, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Systemische Theorie, Familienarbeit, Heimmitarbeiter, Qualifikation, Zusammenarbeit Eltern-Fachkräfte, Kindeswohl, stationäre Hilfen.
- Quote paper
- Annika Duderstadt (Author), 2008, Die Erziehung im Kinderheim unter Einbezug der Eltern. Zur (problematischen) Kooperation zwischen Eltern und Erziehern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112257