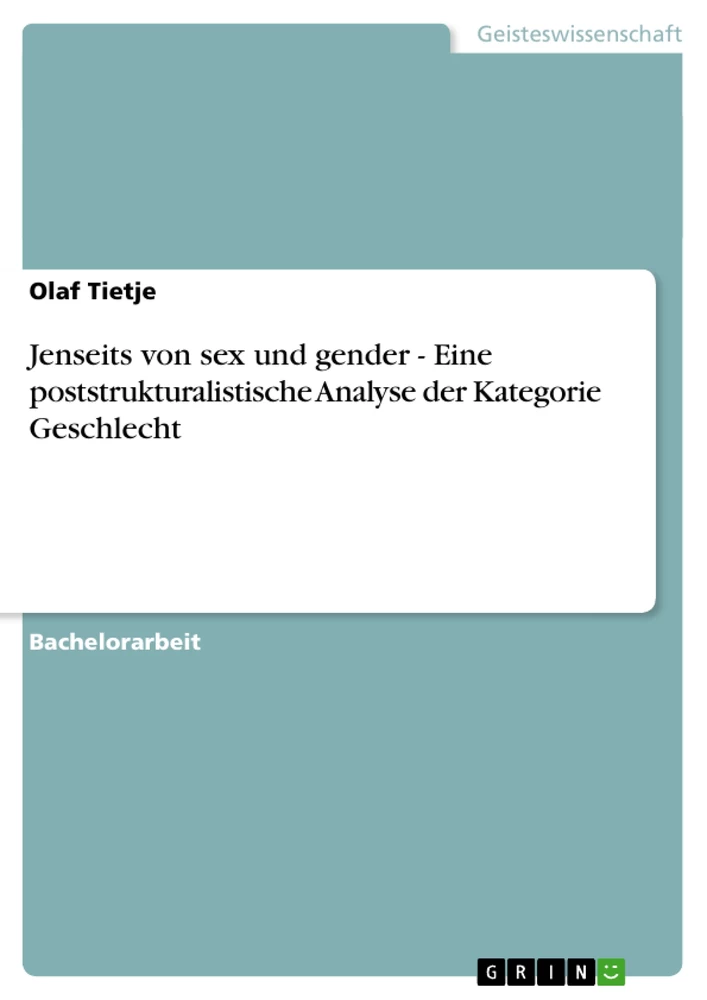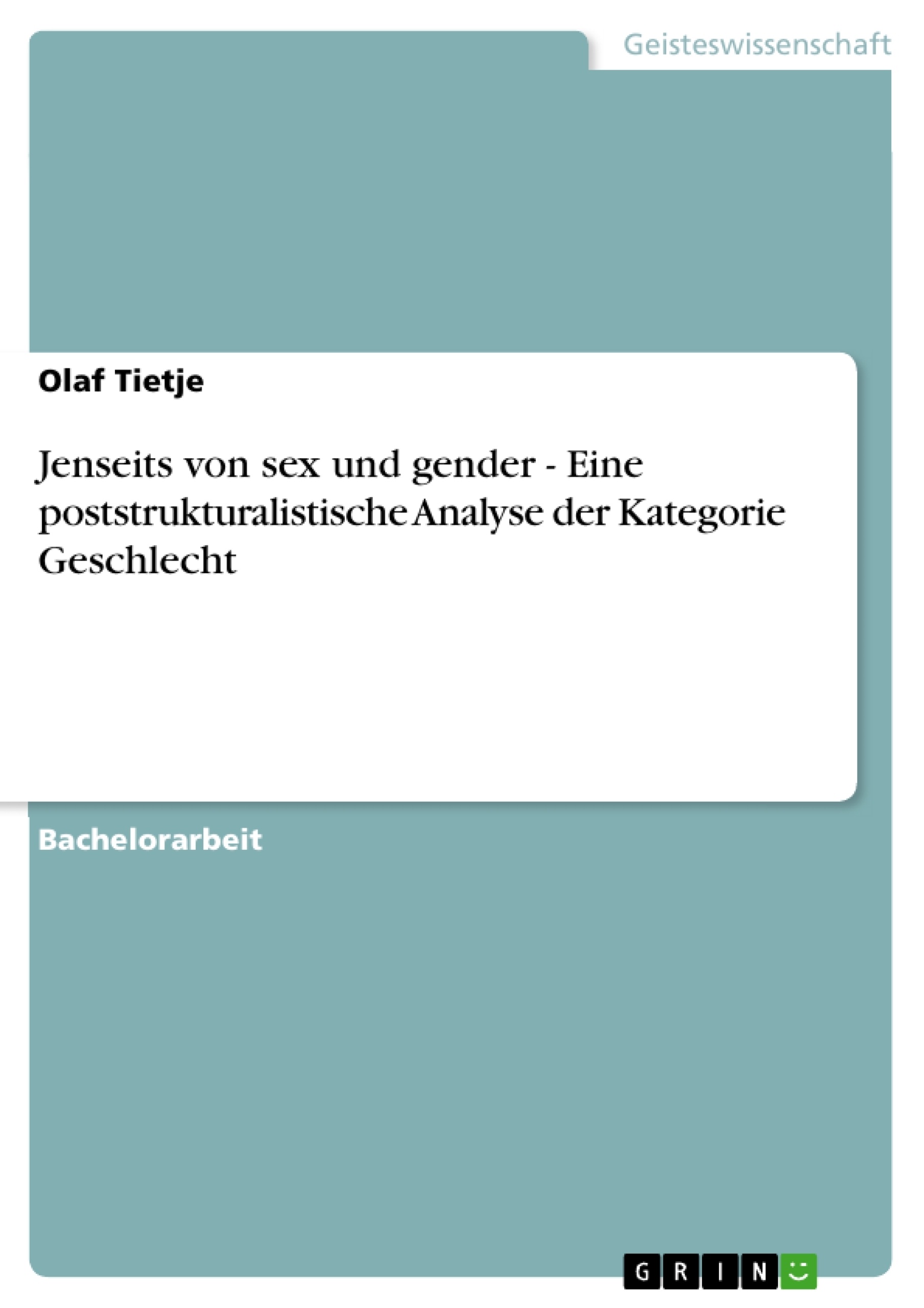Bestseller wie „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“ werden verfilmt, Eva Hermann fordert ein Zurück in die bürgerliche Familie und Frauen verdienen im Jahr 2008 noch immer durchschnittlich weniger Geld, als Männer in den gleichen Positionen. Weiter gibt es noch immer Kirchen, die Homosexualität als Sünde bewerten und Frauen kategorisch in ihren hierarchisch organisierten Strukturen den Zugang zu höheren Positionen verwehren.
Unsere Gesellschaft glaubt an zwei Geschlechter und schreibt diesen bestimmte Rollen, Eigenschaften und Fähigkeiten zu. Diese werden mit dem Geschlecht zusammen vermittelt, von anderen wahrgenommen und direkt mit dem jeweiligen Wesen in Verbindung gebracht.
In der folgenden Arbeit soll daher der Frage nachgegangen werden, ob und wenn ja, wie Geschlechtsidentitäten und Körper geformt werden: Könnte es nicht auch andere Möglichkeiten als die heterosexuellen geben und was würde dann mit dem Körper geschehen? Hierzu sollen im Wesentlichen die Schriften von Michel Foucault und Judith Butler die Arbeitsgrundlage stellen, unter anderem aber auch Jacques Derridas Theorien der dekonstruktiven Praxis Eingang finden.
Zur Analyse bilden sich vier Bereiche heraus. Im ersten Teil sollen die wichtigsten Begriffe geklärt sowie die Methode der Analyse dargestellt werden. Darauf folgen wird eine Analyse dessen, was der Körper beziehungsweise die Körperlichkeit eigentlich ist und ob diese von Natur aus festgelegt ist. Diesem anschließen wird sich ein Teil, in dem näher diskutiert wird, worin eigentlich Normalität besteht beziehungsweise, wie diese entsteht und ob eine Subversion, also ein Außen zu dieser denkbar wäre. Im vierten Teil der Arbeit soll dann diese Subversion auf die im zweiten Teil diskutierte Körperlichkeit angewendet werden.
Insgesamt wird immer wieder die Frage nach der Normalität der Geschlechter aufgeworfen und diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln bearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Das Schicksal Geschlecht?
- 2 Grundlagen
- 2.1 Methodologisches
- 2.1.1 Macht und Diskurs
- 2.1.2 Wissen und Wahrheit
- 2.2 Theoretisches
- 2.2.1 Identität und Körper
- 2.2.2 Sex und gender
- 3 Körperlichkeit
- 3.1 Performanz und kulturelle Einschreibung
- 3.2 Der Körper als verallgemeinerte Voraussetzung?
- 3.3 Die heterosexuelle Matrix
- 4 Normalität und Subversion
- 4.1 Normalität
- 4.2 Subversion
- 5 Subversion der Körperlichkeit
- 5.1 Intelligibilität und Performanz
- 5.2 Die Subversion der heteronormativen Matrix
- 5.3 Effekte der Parodie
- 6 Jenseits von sex und gender?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion von Geschlechtsidentitäten und -körpern anhand poststrukturalistischer Theorien, insbesondere der von Michel Foucault und Judith Butler. Die Zielsetzung besteht darin, die vermeintliche Natürlichkeit von Geschlecht zu hinterfragen und alternative Möglichkeiten jenseits der heteronormativen Matrix aufzuzeigen.
- Die soziale Konstruktion von Geschlecht
- Die Rolle von Macht und Diskurs in der Geschlechtsbildung
- Performativität von Geschlecht und Identität
- Normalität und Subversion als gesellschaftliche Konstrukte
- Möglichkeiten jenseits der binären Geschlechterkategorien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Das Schicksal Geschlecht?: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Konstruktion von Geschlecht und Identität. Sie beleuchtet die gesellschaftliche Gewohnheit, Neugeborene sofort einem Geschlecht zuzuordnen und die damit verbundenen Zuschreibungen von Eigenschaften und Rollen. Die scheinbar natürliche Festlegung des Geschlechts wird anhand historischer und gesellschaftlicher Veränderungen hinterfragt, wobei die Aussage von Simone de Beauvoir ("Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es") als zentraler Ausgangspunkt dient. Die Arbeit kündigt die Anwendung der Theorien von Foucault und Butler an, um die Konstruktion von Geschlecht als performativen Akt zu analysieren.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die methodologischen und theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Im methodologischen Teil werden die Konzepte von Macht und Diskurs nach Foucault sowie Wissen und Wahrheit beleuchtet. Der theoretische Teil befasst sich mit den Begriffen Identität und Körper und analysiert die Unterscheidung zwischen Sex und Gender. Es wird die Grundlage für die spätere Analyse der Geschlechtskonstruktion geschaffen, indem die relevanten theoretischen Werkzeuge vorgestellt werden.
3 Körperlichkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Performanz von Geschlecht und seiner kulturellen Einschreibung im Körper. Es wird die Frage nach dem Körper als verallgemeinerte Voraussetzung von Geschlecht diskutiert und die heterosexuelle Matrix als ein normatives System untersucht, welches Geschlechterrollen und -identitäten prägt. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen körperlicher Realität und gesellschaftlicher Konstruktion.
4 Normalität und Subversion: Das Kapitel untersucht die Konstruktion von Normalität und die Möglichkeiten der Subversion. Es analysiert, wie gesellschaftliche Normen Geschlechterrollen definieren und welche Strategien Individuen anwenden, um diese Normen zu unterlaufen oder zu verändern. Die Dialektik zwischen der Aufrechterhaltung und der Infragestellung von gesellschaftlichen Normen steht im Zentrum der Betrachtung.
5 Subversion der Körperlichkeit: Hier wird die Subversion der Körperlichkeit als Akt der Widersetzung gegen die heteronormative Matrix betrachtet. Die Intelligibilität und Performanz von Geschlecht werden kritisch beleuchtet, und die Effekte von Parodie als subversive Strategie werden analysiert. Der Fokus liegt auf Strategien der Widersetzung gegen die gesellschaftliche Ordnung und deren Auswirkungen.
Schlüsselwörter
Geschlecht, Gender, Sex, Identität, Körper, Performativität, Macht, Diskurs, Normalität, Subversion, Heteronormativität, Foucault, Butler, Poststrukturalismus, Intelligibilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Das Schicksal Geschlecht?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Geschlechtsidentitäten und -körpern, indem sie die vermeintliche Natürlichkeit von Geschlecht hinterfragt und alternative Möglichkeiten jenseits der heteronormativen Matrix aufzeigt. Sie nutzt poststrukturalistische Theorien, insbesondere von Michel Foucault und Judith Butler.
Welche methodologischen und theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Methodologisch stützt sich die Arbeit auf Foucaults Konzepte von Macht und Diskurs sowie Wissen und Wahrheit. Theoretisch werden die Begriffe Identität und Körper analysiert, mit besonderem Fokus auf die Unterscheidung zwischen Sex und Gender. Die Arbeit legt die relevanten theoretischen Werkzeuge dar, um die Geschlechtskonstruktion zu analysieren.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Kapitel 1 (Einleitung): Stellt die zentrale Forschungsfrage und den Ausgangspunkt der Arbeit dar (Simone de Beauvoir: "Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es").
Kapitel 2 (Grundlagen): Legt die methodologischen und theoretischen Grundlagen dar (Foucault, Butler).
Kapitel 3 (Körperlichkeit): Untersucht die Performanz von Geschlecht, kulturelle Einschreibungen im Körper und die heterosexuelle Matrix.
Kapitel 4 (Normalität und Subversion): Analysiert die Konstruktion von Normalität und Strategien der Subversion gesellschaftlicher Normen.
Kapitel 5 (Subversion der Körperlichkeit): Betrachtet die Subversion der Körperlichkeit als Widersetzung gegen die heteronormative Matrix, beleuchtet Intelligibilität und Performanz und analysiert die Effekte von Parodie.
Kapitel 6 (Jenseits von sex und gender?): (Inhalt nicht explizit in der Zusammenfassung beschrieben).
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Geschlecht, Gender, Sex, Identität, Körper, Performativität, Macht, Diskurs, Normalität, Subversion, Heteronormativität, und die Theorien von Foucault und Butler im Kontext des Poststrukturalismus und der Intelligibilität.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die soziale Konstruktion von Geschlecht zu untersuchen, die Rolle von Macht und Diskurs in der Geschlechtsbildung zu beleuchten, Performativität von Geschlecht und Identität zu analysieren, Normalität und Subversion als gesellschaftliche Konstrukte zu betrachten und Möglichkeiten jenseits der binären Geschlechterkategorien aufzuzeigen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit Geschlechterforschung, Poststrukturalismus und den Theorien von Foucault und Butler auseinandersetzt. Der Umfang an Fachtermini deutet auf ein fortgeschrittenes akademisches Niveau hin.
- Quote paper
- Bakkalareus Artium Olaf Tietje (Author), 2007, Jenseits von sex und gender - Eine poststrukturalistische Analyse der Kategorie Geschlecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112269