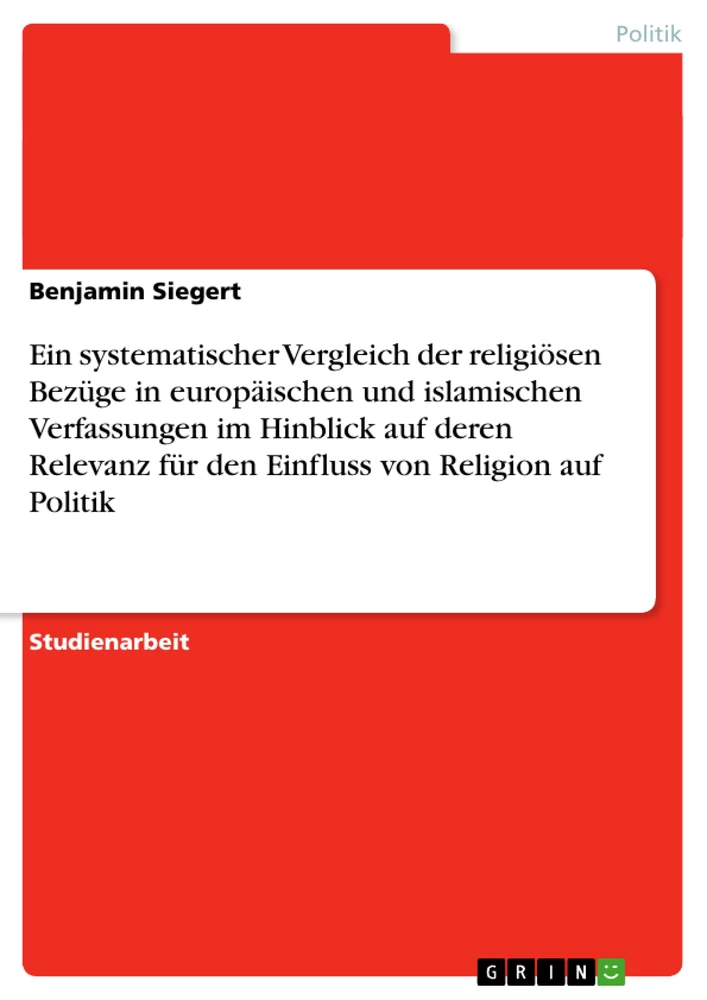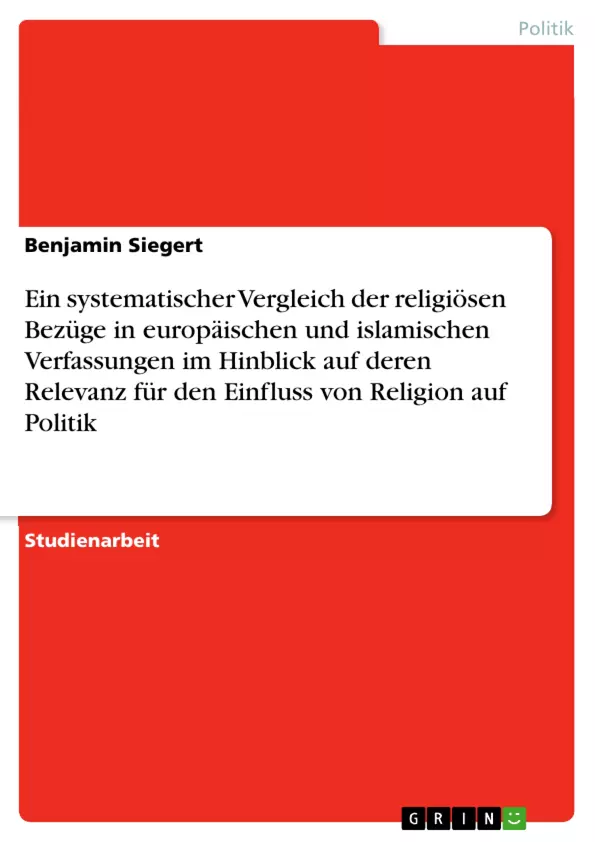Die Religion ist auf dem Vormarsch. Die Glaubensgemeinschaften in
westlichen Gesellschaften verzeichnen wieder einen positiven Trend in der
Entwicklung ihrer Mitgliedszahlen. Kirchentage werden wie Popkonzerte
zelebriert, medial aufbereitet und gerade junge Menschen entdecken
vermehrt ihren Glauben.
Auch in der öffentlichen Debatte findet eine zunehmende Beschäftigung mit
dem Komplex des Religiösen statt, angeregt besonders durch die
Geschehnisse des 11. September 2001 und deren Aufarbeitung. Religiöse
Rhetorik fand Eingang in die Politik und Glaube wurde sogar zur Legitimation
politischen Handelns missbraucht, namentlich in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Im Zuge dessen wurde das Feindbild Islam kreiert und die These
Huntingtons vom „Clash of Civilisations“ wurde wiederbelebt. In diesem
Zusammenhang wird immer wieder auf die Gefahr eines radikalisierten,
expansionistischen Islam rekurriert und die Unverträglichkeit von Islam und
Demokratie beschworen. In diesem Sinne gilt vielen die christliche Religion
als konstitutiv für die Demokratie und damit nach westlichem
Werteverständnis dem Islam überlegen.
Da diese Diskussion öffentlich häufig populistisch geführt wird, soll diese
Arbeit sich wissenschaftlich dem Thema nähern.
Welche Einflüsse der Religion auf die Politik lassen sich in einzelnen
Gesellschaften wirklich nachweisen und wie ist Einflussnahme institutionell
geregelt?
Zur Beantwortung dieser Leitfragen werden zunächst ausgewählte
Verfassungen europäischer Staaten systematisch auf ihre religiösen Bezüge
hin analysiert, verglichen und in eine Typologie von Staat- Kirche-
Beziehungen eingeordnet. Einzelne nationale Modelle werden diskutiert und
Argumente anhand der Entwicklung der EU- Verfassung und den damit
einhergehenden nationalen Begehrlichkeiten verdeutlicht. Dabei werden
auch etwaige Diskrepanzen zwischen Verfassungstext und alltäglicher Praxis
beleuchtet.
Diese finden sich, soviel sei an dieser Stelle schon vorweg genommen,
vermehrt in islamischen Staaten, weshalb in einem nächsten Schritt das
Verhältnis von Religion und Politik im Islam an einem Länderbeispiel
analysiert und der Versuch einer Verallgemeinerung vorgenommen wird.
Der Fokus der Analyse liegt bei allen Staat- Kirche- Beziehungen auf den
Aspekten Religionsfreiheit, Staatsneutralität und der Kooperation von Staat
und Kirchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Religiöse Bezüge in Verfassungen
- Institutionelle Beziehungen
- Die Verfassung der Europäischen Union
- Religion im Grundgesetz
- Vergleich internationaler Verfassungen
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert systematisch die religiösen Bezüge in europäischen und islamischen Verfassungen, um deren Einfluss auf die Politik zu untersuchen. Sie zielt darauf ab, die institutionellen Beziehungen von Staat und Religion in verschiedenen Gesellschaften zu beleuchten und die Relevanz religiöser Traditionen für politische Entscheidungen zu erforschen.
- Religiöse Bezüge in Verfassungen
- Institutionelle Beziehungen von Staat und Kirche
- Religionsfreiheit und Staatsneutralität
- Der Einfluss von Religion auf Politik in verschiedenen Gesellschaften
- Vergleichende Analyse von Staat-Kirche-Beziehungen in Europa und im Islam
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um Religion und Politik dar. Sie beleuchtet den wachsenden Einfluss von Religion in westlichen Gesellschaften und die zunehmende Beschäftigung mit dem Komplex des Religiösen in der öffentlichen Debatte. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Einflüsse der Religion auf die Politik in verschiedenen Gesellschaften zu untersuchen und die institutionelle Regulierung der Einflussnahme zu analysieren.
Das Kapitel 2.1. beschäftigt sich mit den religiösen Bezügen in Verfassungen. Es analysiert die verschiedenen Formen von Gottesbezügen in Verfassungstexten und diskutiert die Argumente von Befürwortern und Gegnern eines solchen Bezugs. Es wird auf die Bedeutung von Gottesbezügen für die Bindung an letzte Werte und die Begrenzung der menschlichen Handlungsmöglichkeiten eingegangen, sowie auf die Kritik, dass ein Gottesbezug die Trennung von Staat und Kirche verletze und die Menschenrechte in den Hintergrund stelle.
Das Kapitel 2.2. beleuchtet die institutionellen Beziehungen von Staat und Kirche. Es stellt drei verschiedene Typen von Staat-Kirche-Beziehungen vor: das Staatskirchenmodell, die totale Trennung von Staat und Kirche und ein Mischtyp, der die Trennung mit einer partnerschaftlichen Verschränkung von Staat und Kirche verbindet. Es wird auf die unterschiedlichen Modelle in Europa eingegangen und die Entwicklung hin zu einem europäischen Modell, das auf Religionsfreiheit, Staatsneutralität und Kooperation von Staat und Religion basiert, dargestellt.
Das Kapitel 3.1. analysiert die Verfassung der Europäischen Union. Es beleuchtet die Bedeutung des Respekts für die Traditionen der Mitgliedsstaaten und die unterschiedlichen Auffassungen zum Gottesbezug in der EU-Verfassung. Es wird auf die Debatte um einen möglichen Gottesbezug in der EU-Verfassung eingegangen und die verschiedenen Positionen von Frankreich, Polen, Italien, Irland und Belgien dargestellt. Es wird gezeigt, dass die EU-Verfassung letztendlich einen Kompromiss ohne ausdrücklichen Gottesbezug darstellt.
Das Kapitel 3.2. untersucht die Rolle der Religion im Deutschen Grundgesetz. Es analysiert die Gottesbezüge in der Präambel und den Artikeln 3 und 4 des Grundgesetzes und beleuchtet die Bedeutung des Religionsunterrichts an deutschen Schulen. Es wird auf die Frage eingegangen, welche Bedeutung die religiösen Formulierungen im Grundgesetz heute noch haben und ob sie nur vor dem Hintergrund ihrer Entstehung zu erklären sind. Es wird die Trennung von Staat und Kirche im deutschen Grundgesetz dargestellt und die Bedeutung der Kirchen als zivilgesellschaftliche Akteure im sozialen und karitativen Bereich hervorgehoben.
Das Kapitel 3.3. vergleicht die Verfassungen verschiedener europäischer Staaten und analysiert deren religiöse Bezüge. Es werden die Verfassungen von Griechenland, Irland, der Schweiz, Malta und der Slowakei untersucht und deren unterschiedliche Gottesbezüge und deren Auswirkungen auf das Leben der Menschen in diesen Ländern dargestellt. Es wird auf die besondere Rolle der Religion in der Verfassung des Iran eingegangen und die Diskrepanz zwischen Verfassungstext und alltäglicher Praxis im Bereich der Religionsfreiheit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die religiösen Bezüge in Verfassungen, die institutionellen Beziehungen von Staat und Kirche, die Religionsfreiheit, die Staatsneutralität, die Kooperation von Staat und Kirche, der Einfluss von Religion auf Politik, der Vergleich von Staat-Kirche-Beziehungen in Europa und im Islam, die Europäische Union, das Deutsche Grundgesetz, die Verfassungen von Griechenland, Irland, der Schweiz, Malta, der Slowakei und dem Iran sowie die Integration von Muslimen in Europa.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Siegert (Autor:in), 2006, Ein systematischer Vergleich der religiösen Bezüge in europäischen und islamischen Verfassungen im Hinblick auf deren Relevanz für den Einfluss von Religion auf Politik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112292