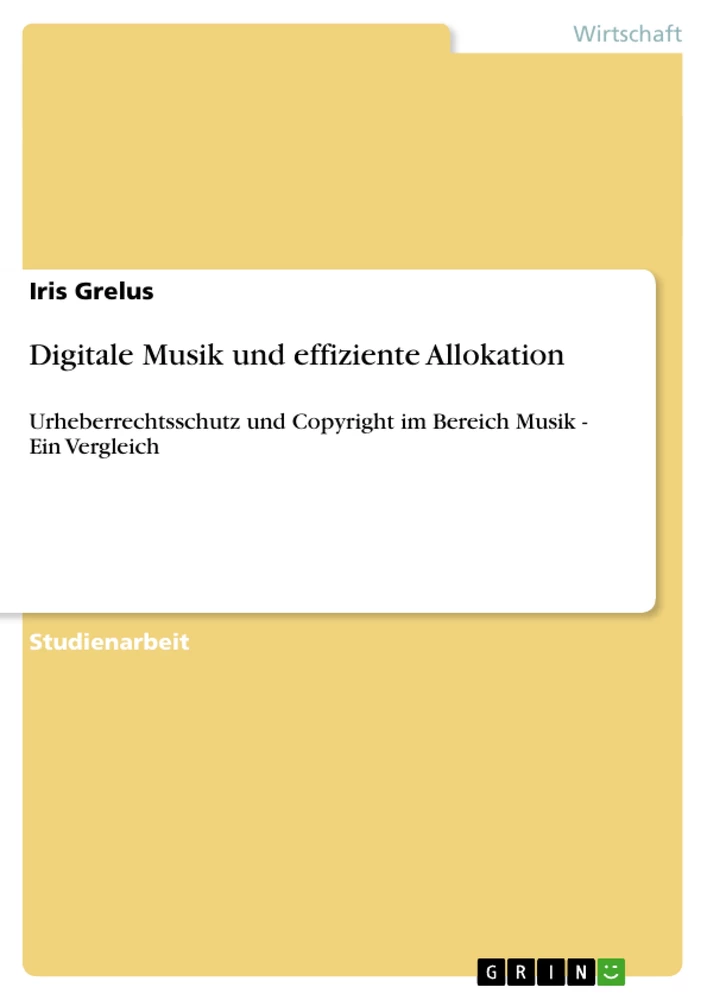In der heutigen Zeit ist es einfach geworden, sich jederzeit mit digitaler Musik zu versorgen. Besonders die illegalen Musiktauschbörsen erlebten in den neunziger Jahren einen Boom.
Musik war sofort und kostenlos verfügbar. Aufgrund der Neuheit und Einfachheit dieser Möglichkeiten gibt es wenig Rechts- bzw. Unrechtsempfindungen bei den Nutzern. Der Schaden, der durch dieses Verhalten bei den Produzenten der Musik entsteht, ist, besonders nach Angaben der Musikindustrie, groß. Unter anderem aus diesem Grund gibt es Gesetze, die die Produzenten von geistigen Schöpfungen
vor unbefugter Nutzung ihrer Werke schützen. In Europa existiert hierzu das
Urheberrechtsgesetz, in den Vereinigten Staaten von Amerika wird das Copyright angewandt. Die beiden Gesetze haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede, auf die im Verlauf der Arbeit näher eingegangen wird. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den ökonomischen Auswirkungen der beiden Konzepte. Als Grundlage für diese Betrachtung wird die Theorie der Property Rights dienen. In diesem Zusammenhang soll untersucht werden, wie sich die Aspekte der Verfügungsrechte, des Eigentums und der Allokation jeweils in den unterschiedlichen
Szenarien verhalten.
Zuerst soll zu diesem Zweck auf digitale Musik als öffentliches Gut und die Probleme, die dadurch entstehen eingegangen werden. Im Folgenden werden die Grundlagen der Property-Rights-Theory erläutert und diese, nach der Vorstellung der beiden Gesetze, auf die vorliegende
Rechtslage angewandt.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Digitale Musik als öffentliches Gut
- 1.1 Öffentliche Güter
- 1.2 Anreize zur marktlichen Bereitstellung
- 2 Grundlagen der Property-Rights-Theory
- 3 Property Rights für Musik in Urheberrecht und Copyright
- 3.1 Das kontinental-europäische Urheberrecht
- 3.1.1 Inhalte
- 3.1.2 Property Rights
- 3.2 Das anglo-amerikanische Copyright Law
- 3.2.1 Inhalte
- 3.2.2 Property Rights
- 3.1 Das kontinental-europäische Urheberrecht
- 4 Copyright und Urheberrecht - Rahmenbedingungen für eine effiziente Allokation von Musik?
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die ökonomischen Auswirkungen des Urheberrechts und des Copyrights auf die Allokation digitaler Musik. Sie vergleicht das europäische Urheberrecht mit dem anglo-amerikanischen Copyright Law unter dem Blickwinkel der Property-Rights-Theorie. Der Fokus liegt auf der Analyse der Verfügungsrechte, des Eigentums und der Effizienz der Allokation in beiden Rechtssystemen.
- Digitale Musik als öffentliches Gut und die Herausforderungen der Bereitstellung
- Grundlagen und Anwendung der Property-Rights-Theorie
- Vergleich des europäischen Urheberrechts und des anglo-amerikanischen Copyright Laws
- Analyse der Verfügungsrechte und des Eigentums an digitalen Musikwerken
- Bewertung der Effizienz der Allokation von Musik unter verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext illegaler Musiktauschbörsen und den daraus resultierenden Schaden für die Musikindustrie. Sie führt in die Thematik des Urheberrechts und des Copyrights ein und benennt die Zielsetzung der Arbeit, die ökonomischen Auswirkungen beider Rechtskonzepte anhand der Property-Rights-Theorie zu untersuchen und die Aspekte der Verfügungsrechte, des Eigentums und der Allokation zu analysieren. Die Struktur der Arbeit wird skizziert, wobei die Betrachtung digitaler Musik als öffentliches Gut, die Grundlagen der Property-Rights-Theorie und die Anwendung auf die vorliegende Rechtslage angekündigt werden.
1 Digitale Musik als öffentliches Gut: Dieses Kapitel definiert zunächst öffentliche Güter anhand der Kriterien Ausschließbarkeit und Rivalität. Digitale Musik wird als ein öffentliches Gut klassifiziert, da sie im Wesentlichen nicht-ausschließbar und nicht-rivalisierend ist. Jedoch wird hervorgehoben, dass die Nutzenstiftung digitaler Musik erst durch die Kombination mit einem privaten Gut (z.B. Datenträger) erfolgt, was die Klassifizierung als öffentliches Gut komplexer gestaltet. Die Kombination aus immateriellem Gut (geistige Schöpfung) und materiellem Gut (Datenträger) wird detailliert analysiert, um die spezifischen Herausforderungen der Allokation digitaler Musik zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Digitale Musik, Urheberrecht, Copyright, Property-Rights-Theorie, öffentliches Gut, Allokation, Verfügungsrechte, Eigentum, Effizienz, europäisches Urheberrecht, anglo-amerikanisches Copyright Law, Musikindustrie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Ökonomische Auswirkungen des Urheberrechts und Copyrights auf die Allokation digitaler Musik
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die ökonomischen Auswirkungen des Urheberrechts und des Copyrights auf die Allokation digitaler Musik. Im Fokus steht ein Vergleich des europäischen Urheberrechts mit dem anglo-amerikanischen Copyright Law unter der Perspektive der Property-Rights-Theorie. Analysiert werden Verfügungsrechte, Eigentumsverhältnisse und die Effizienz der Allokation in beiden Rechtssystemen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Digitale Musik als öffentliches Gut und die Herausforderungen ihrer Bereitstellung; Grundlagen und Anwendung der Property-Rights-Theorie; Vergleich des europäischen Urheberrechts und des anglo-amerikanischen Copyright Laws; Analyse der Verfügungsrechte und des Eigentums an digitalen Musikwerken; Bewertung der Effizienz der Allokation von Musik unter verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu digitalen Musik als öffentlichem Gut, ein Kapitel zu den Grundlagen der Property-Rights-Theorie, ein Kapitel zum Vergleich von europäischem Urheberrecht und anglo-amerikanischem Copyright Law, und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in Unterkapitel weiter unterteilt, die die einzelnen Aspekte detailliert analysieren.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung beschreibt den Kontext illegaler Musiktauschbörsen und die daraus resultierenden Schäden für die Musikindustrie. Sie führt in die Thematik des Urheberrechts und des Copyrights ein und benennt die Zielsetzung der Arbeit: die ökonomischen Auswirkungen beider Rechtskonzepte anhand der Property-Rights-Theorie zu untersuchen und Aspekte der Verfügungsrechte, des Eigentums und der Allokation zu analysieren. Die Struktur der Arbeit wird skizziert.
Wie wird digitale Musik im Kontext der Arbeit betrachtet?
Digitale Musik wird als öffentliches Gut klassifiziert, da sie im Wesentlichen nicht-ausschließbar und nicht-rivalisierend ist. Die Arbeit analysiert jedoch auch die Komplexität dieser Klassifizierung, da die Nutzenstiftung digitaler Musik erst durch die Kombination mit einem privaten Gut (z.B. Datenträger) erfolgt. Die Kombination aus immateriellem Gut (geistige Schöpfung) und materiellem Gut (Datenträger) wird detailliert untersucht.
Was sind die zentralen Schlüsselbegriffe der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Digitale Musik, Urheberrecht, Copyright, Property-Rights-Theorie, öffentliches Gut, Allokation, Verfügungsrechte, Eigentum, Effizienz, europäisches Urheberrecht, anglo-amerikanisches Copyright Law, Musikindustrie.
Welche Rechtsordnungen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das europäische Urheberrecht mit dem anglo-amerikanischen Copyright Law. Der Vergleich konzentriert sich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bezüglich Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und der Effizienz der Allokation digitaler Musik.
Welche Theorie dient als analytisches Werkzeug?
Die Property-Rights-Theorie dient als analytisches Werkzeug, um die ökonomischen Auswirkungen des Urheberrechts und des Copyrights auf die Allokation digitaler Musik zu untersuchen. Die Theorie hilft, die Verfügungsrechte und Eigentumsverhältnisse zu analysieren und die Effizienz der Allokation zu bewerten.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
(Das Fazit ist nicht im bereitgestellten HTML-Code enthalten und kann daher hier nicht zusammengefasst werden.)
- Quote paper
- Iris Grelus (Author), 2007, Digitale Musik und effiziente Allokation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112298