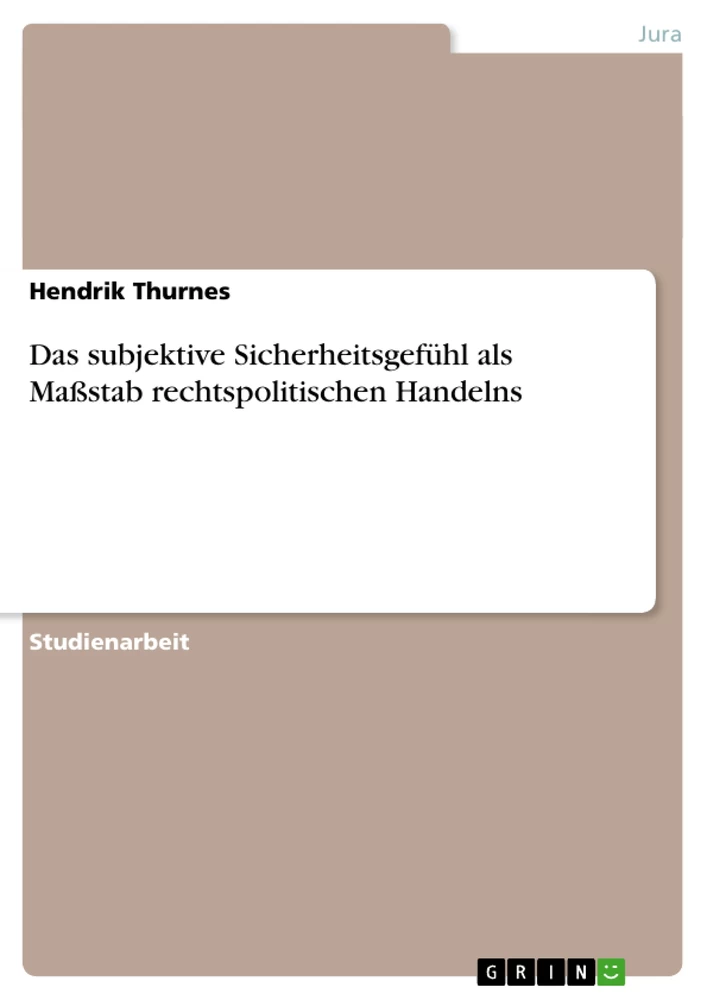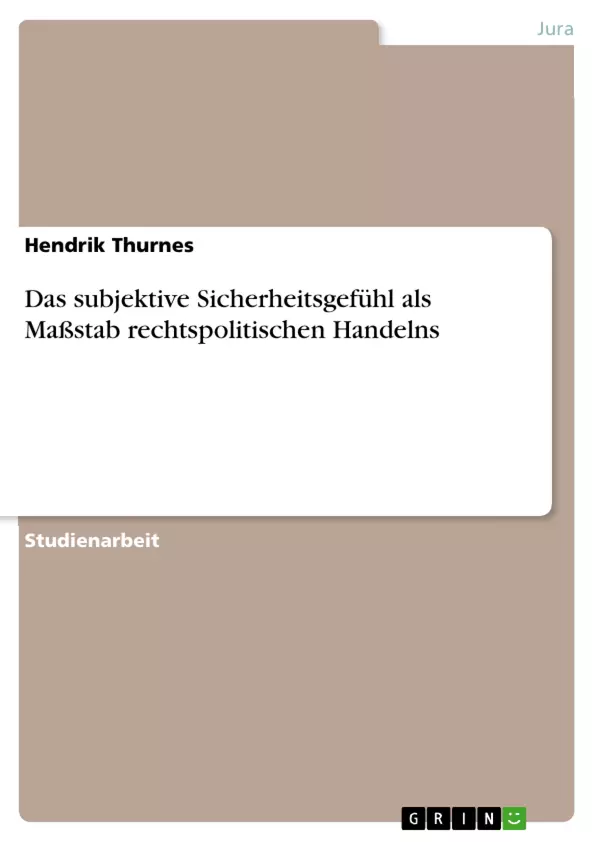Fühlen sich die Bürger bedroht, sind sie eher bereit freiheitseinschränkende Maßnahmen zu akzeptieren. Verallgemeinert kann man demnach sagen,
dass erlebte Unsicherheitsgefühle die aktuelle Sicherheitspolitik legitimieren. Heißt dies aber, dass sich das rechtspolitische Handeln rein am Sicherheitsgefühl der Bürger orientiert und möglicherweise bezüglich der
objektiven Bedrohungslage gar nicht angemessen ist. Dies ist die zentrale Fragestellung dieser Arbeit, wobei das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit keine Rolle spielt, sondern ausschließlich, welche Faktoren die
Sicherheitsgesetzgebung beeinflussen, mit speziellem Fokus auf dem Sicherheitsgefühl der Bürger.
In Anlehnung an die Argumentation vieler Kritiker und den provokativen Seminartitel, der einen Paradigmenwechsel vom liberalen Rechtsstaat hin zum Präventionsstaat suggeriert, lautet die eindeutig gewagte Arbeitsthese dieser
Arbeit, dass die Politik die öffentliche Debatte bezüglich des Terrorismus bewusst anheizt, um so kollektive Ängste innerhalb der Bevölkerung zu verstärken und letztlich Legitimation für anti-liberale Gesetzgebung herzustellen.
Um Aussagen über den Wahrheitsgehalt der Arbeitsthese machen zu können, ist es notwendig, den Nutzen sowie die Entstehungsmechanismen und Faktoren von Furcht zu verstehen, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf der Furcht vor Kriminalität im Allgemeinen und Terrorismus als spezieller Ausprägung liegt. Weiter soll begründet werden, warum es aus Sicht der Politik rational erscheint, Ängste zu instrumentalisieren. Es ist jedoch bereits jetzt schon abzusehen, dass keine eindeutigen Beweise zur Bewahrheitung der Arbeitsthese erbracht werden können. Deshalb ist es das Ziel dieser Arbeit, ein Wirkungsgefüge der relevanten Akteure bezüglich des Sicherheitsgefühls der Bürger aufzustellen, um so
wenigstens Indizien für eine irrationale Sicherheitsarchitektur vorlegen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Feindbilder
- Von Hexen und Kapitalisten
- Gemeinsamkeiten
- Terrorismus
- Mechanismen der Angst
- Kriminalitätsfurcht und Kriminalität
- Einfluss der Medien
- Medien in der modernen Gesellschaft
- Konstruktivismus
- Nachrichtenwert
- Agenda-Setting Funktion
- Schweigespirale
- Zusammenfassung
- Folgen
- Politik und Angst
- Bürger, Medien und Politik
- Kriminalitätswahrnehmung
- Politik und Medien
- Die Rolle der Bürger
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das subjektive Sicherheitsgefühl als Maßstab rechtspolitischen Handelns. Sie analysiert, wie Feindbilder konstruiert werden und welche Rolle Medien und Politik bei der Gestaltung von Angst und Unsicherheit spielen. Die Arbeit beleuchtet die Mechanismen, durch die Angst erzeugt und verstärkt wird, und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
- Konstruktion von Feindbildern im historischen und gesellschaftlichen Kontext
- Der Einfluss von Medien auf die Kriminalitätswahrnehmung und das Sicherheitsgefühl
- Die Rolle der Politik bei der Inszenierung und Nutzung von Angst
- Das Zusammenspiel von Bürgern, Medien und Politik im Kontext von Sicherheit und Angst
- Das subjektive Sicherheitsgefühl als politisches Instrument und seine Grenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und beschreibt die zentrale Fragestellung: Inwieweit dient das subjektive Sicherheitsgefühl als Maßstab für rechtspolitisches Handeln? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit untersucht werden.
Feindbilder: Dieses Kapitel untersucht die Konstruktion von Feindbildern, beginnend mit historischen Beispielen wie Hexenverfolgungen und der Dämonisierung des Kapitalismus. Es werden Gemeinsamkeiten dieser Feindbilder herausgearbeitet und der Begriff des Terrorismus im Kontext dieser Entwicklungen analysiert. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der Mechanismen, die zur Entstehung und Verbreitung von Angst beitragen.
Mechanismen der Angst: Dieses Kapitel analysiert die Mechanismen, die zur Entstehung und Verstärkung von Angst beitragen. Es untersucht den Zusammenhang zwischen Kriminalitätsfurcht und tatsächlicher Kriminalität und beleuchtet den starken Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung von Sicherheit und Gefahr. Konzepte wie Konstruktivismus, Nachrichtenwert, Agenda-Setting und die Schweigespirale werden herangezogen, um die Medienwirkung zu erklären. Die Folgen der Angst werden ebenfalls diskutiert.
Politik und Angst: Dieses Kapitel fokussiert auf die Rolle der Politik im Umgang mit Angst und Unsicherheit. Es untersucht, wie Politik Angst instrumentalisieren kann, um bestimmte Ziele zu erreichen, und welche Folgen dies für die Gesellschaft hat. Der Abschnitt verbindet die vorherigen Kapitel und betont den wechselseitigen Einfluss von Politik, Medien und öffentlichem Diskurs auf die Sicherheitswahrnehmung.
Bürger, Medien und Politik: Dieses Kapitel beleuchtet das Zusammenspiel von Bürgern, Medien und Politik in Bezug auf Kriminalitätswahrnehmung und Sicherheitsgefühl. Es analysiert, wie die öffentliche Meinung beeinflusst wird und welche Rolle die Bürger bei der Gestaltung des Sicherheitsdiskurses spielen. Das Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammen und verdeutlicht die komplexe Interaktion der drei Akteure.
Schlüsselwörter
Subjektives Sicherheitsgefühl, Rechtspolitik, Feindbilder, Terrorismus, Medienwirkung, Kriminalitätsfurcht, Angst, Politik, Bürgerbeteiligung, Sicherheitsdiskurs.
Häufig gestellte Fragen zu: Seminararbeit über Subjektives Sicherheitsgefühl und Rechtspolitik
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das subjektive Sicherheitsgefühl als Maßstab für rechtspolitisches Handeln. Sie analysiert die Konstruktion von Feindbildern und die Rolle von Medien und Politik bei der Gestaltung von Angst und Unsicherheit. Im Fokus steht der Einfluss von Angst auf die Gesellschaft und deren Mechanismen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Feindbilder, Mechanismen der Angst, Politik und Angst, Bürger, Medien und Politik und schliesst mit einem Fazit.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit beleuchtet, wie Feindbilder konstruiert werden, welchen Einfluss Medien auf die Kriminalitätswahrnehmung haben, wie Politik Angst instrumentalisiert und wie Bürger, Medien und Politik im Kontext von Sicherheit und Angst zusammenspielen. Zentral ist die Frage nach dem subjektiven Sicherheitsgefühl als politisches Instrument und seinen Grenzen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion von Feindbildern im historischen Kontext, den Einfluss der Medien auf das Sicherheitsgefühl, die Rolle der Politik bei der Inszenierung von Angst, das Zusammenspiel von Bürgern, Medien und Politik im Sicherheitsdiskurs und das subjektive Sicherheitsgefühl als politisches Instrument.
Wie werden Feindbilder in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel "Feindbilder" untersucht die Konstruktion von Feindbildern anhand historischer Beispiele (Hexenverfolgungen, Dämonisierung des Kapitalismus) und analysiert Gemeinsamkeiten und den Begriff des Terrorismus in diesem Zusammenhang.
Welche Rolle spielen Medien in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert den starken Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung von Sicherheit und Gefahr. Konzepte wie Konstruktivismus, Nachrichtenwert, Agenda-Setting und die Schweigespirale werden verwendet, um die Medienwirkung zu erklären.
Wie wird die Rolle der Politik dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie Politik Angst instrumentalisieren kann, um bestimmte Ziele zu erreichen, und welche gesellschaftlichen Folgen dies hat. Der wechselseitige Einfluss von Politik, Medien und öffentlichem Diskurs auf die Sicherheitswahrnehmung wird betont.
Wie werden Bürger in den Sicherheitsdiskurs eingebunden?
Die Arbeit analysiert das Zusammenspiel von Bürgern, Medien und Politik in Bezug auf Kriminalitätswahrnehmung und Sicherheitsgefühl. Es wird untersucht, wie die öffentliche Meinung beeinflusst wird und welche Rolle die Bürger bei der Gestaltung des Sicherheitsdiskurses spielen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Subjektives Sicherheitsgefühl, Rechtspolitik, Feindbilder, Terrorismus, Medienwirkung, Kriminalitätsfurcht, Angst, Politik, Bürgerbeteiligung, Sicherheitsdiskurs.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die deren Inhalte und die behandelten Themen kurz beschreibt.
- Arbeit zitieren
- Hendrik Thurnes (Autor:in), 2008, Das subjektive Sicherheitsgefühl als Maßstab rechtspolitischen Handelns, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112327