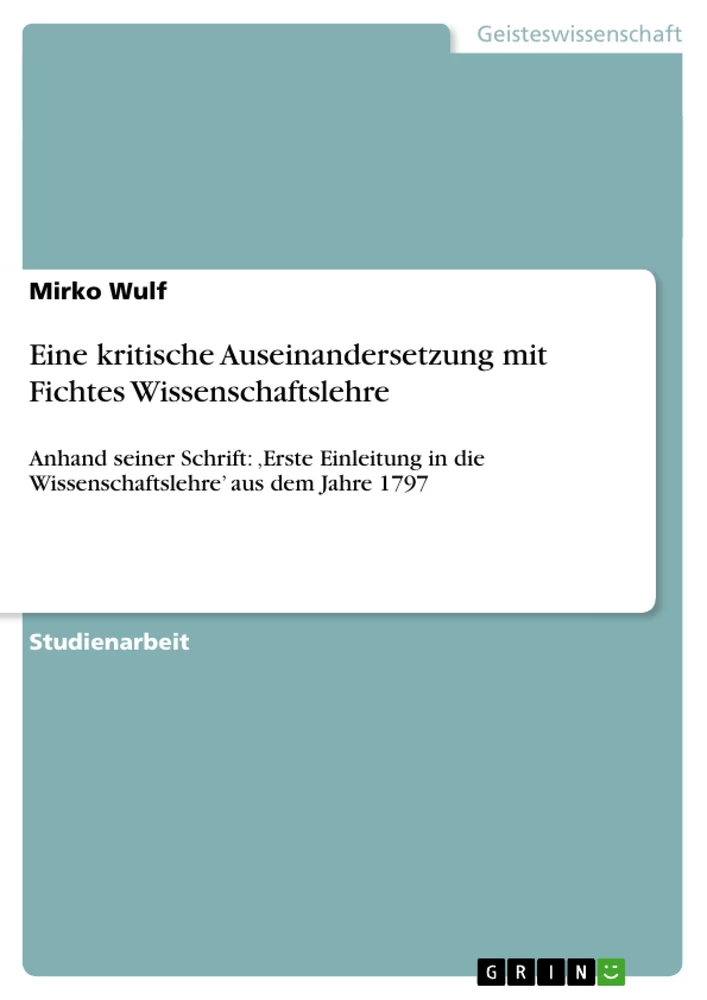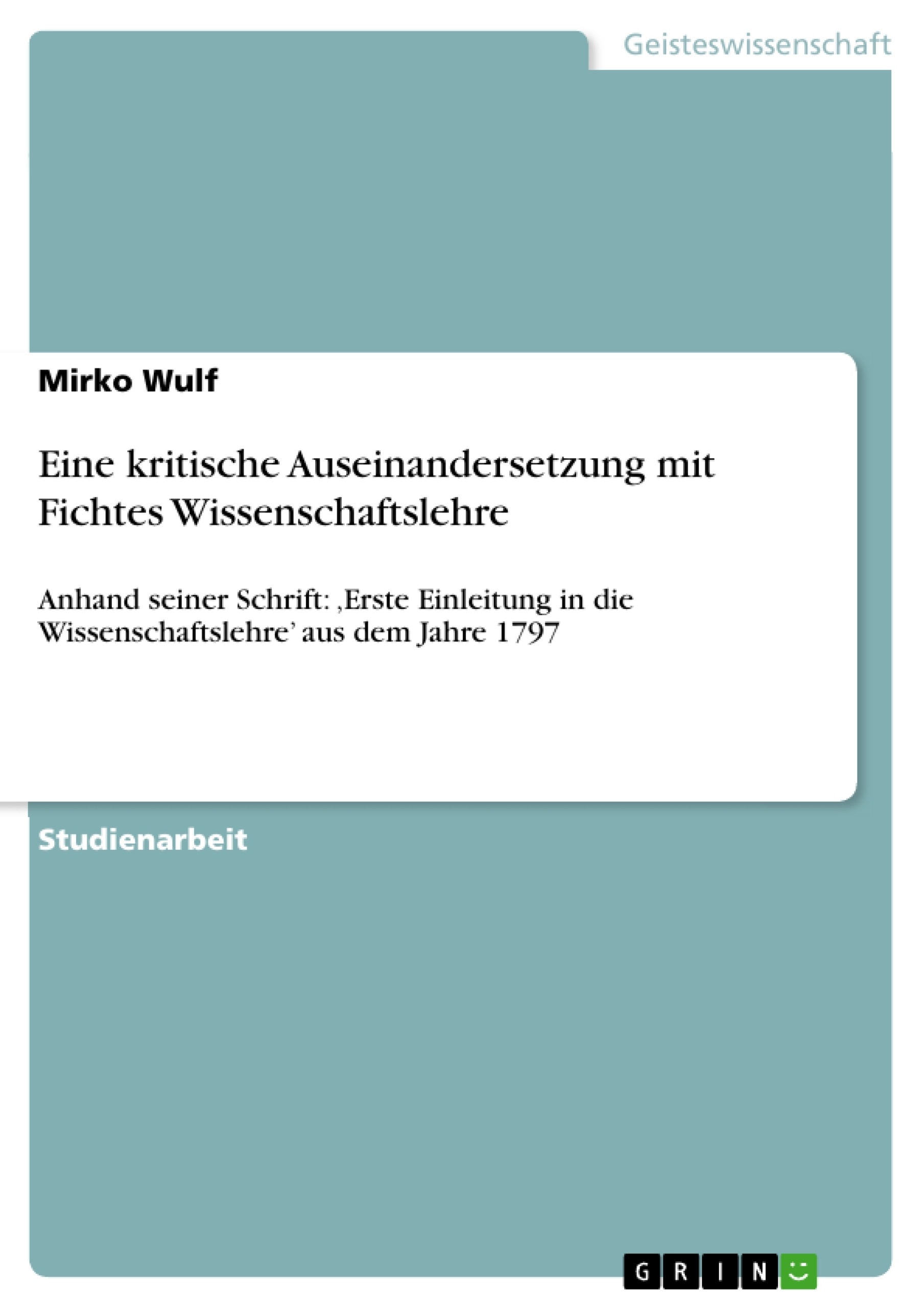Die Auseinandersetzung mit Fichtes ‚Erster Einleitung in die Wissenschaftslehre’ war nicht
leicht. Fichte neigt dazu, in seinen Argumentationen und textimmanenten Fokussierungen
dergestalt zu springen und Sachverhalte so kurz abzuhandeln, dass ein wirkungsvolles
Textverständnis kaum zu gewährleisten ist. Dazu kommt noch seine abstrakte Sprache, die in
ihrer Eindringlichkeit all denen, die Fichtes Anliegen auf begrifflicher Ebene nicht
hinterherzukommen vermögen, unterstellt, dass man sein System nicht verstanden habe.
Wolfgang Röd formuliert treffend:
„Fichtes System gehört zum Schwierigsten, was in der Philosophie je erdacht wurde, und
zwar nicht nur auf Grund seiner Abstraktheit, sondern auch wegen der spröden Sprache,
deren sich Fichte bediente.“ (Röd 2000; S. 215)
Mir sei also verziehen, wenn ich nicht auf jeden Punkt eingehe, den Fichte in seinem Text
anbringt. Weniger, dass ich seine einzelnen Gedanken nicht reproduzieren könnte, sondern
viel mehr, dass das ein oder andere zu erläutern bloß zur Verwirrung führte, da die
gelegentliche Unverständlichkeit zwischen einzelnen Aspekten durch den teilweise
indifferenten Gebrauch seines Vokabulars nicht zur Verständlichkeit beiträgt. Mein Anliegen
galt also der Vermittlung Fichtes Gesamtkonzeptes und nicht einer systematischen
Reproduktion des Textes, wenn das Vorhaben sein sollte, Fichtes Wissenschaftslehre
nachvollziehen und nicht bloß abtippen zu lernen, zumal ich nicht erbringen kann, was er
selber im Stande nicht zu leisten war – eine konkrete Theorie darbieten, auf konkreten
Argumenten beruhend, mit konkreten Beispielen erklärbar.
Auch sei mir verziehen, dass die Kritik etwas länger ausfällt. Aber diese Freiheit zur
Auseinandersetzung habe ich mir als theorienreflektierender Student genommen, zumal die
Erwähnung der Kritikpunkte, meines Erachtens nach, Sinn macht und der Kern einer
Philosophie-Hausarbeit nur ein reflektiertes und überprüfendes Verständnis des zu
bearbeitenden Gegenstandes sein kann.
Aus systematische Gründen habe ich mich anfangs dem Konflikt ‚Idealismus vs.
Dogmatismus’ gewidmet, in dem sich Fichte vorfindet. Weiter geht es sodann mit der
Erläuterung Fichtes idealistischen Konzeptes der ‚Wissenschaftslehre’ zur Falsifizierung des
Dogmatismus, gefolgt von der kritischen Reflexion derselben. Schlusslicht ist ein Résumé.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Idealismus vs. Dogmatismus:
- 2. Die Wissenschaftslehre
- 2.a) Die Idee dahinter – das Vorbild Kant
- 2.b) Die Intelligenz und die Dialektik des Ich-an-Sich - absolute Immanenz
- 2,3. Eine kritische Reflexion
- 3.a) Fichte und die normative Kraft des Gesetzten
- 3.b) Fichtes methodische Inkonsequenz
- 3.c) Fichtes Fauxpas in der Determinismus-Debatte
- 3.d) Die solipsistische Verstrickung - Fehlendes Korrelat
- 3.e) Das Paradoxon der Kohärenztheorie
- 4. Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Fichtes „Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre“ und setzt sich kritisch mit seinem idealistischen System auseinander. Sie untersucht die zentralen Argumente der „Wissenschaftslehre“ im Kontext der Debatte zwischen Idealismus und Dogmatismus und beleuchtet die methodischen und philosophischen Herausforderungen, die Fichtes Ansatz mit sich bringt.
- Die Unterscheidung zwischen Idealismus und Dogmatismus bei Fichte
- Die „Wissenschaftslehre“ als Versuch, den Grund aller Erfahrung zu bestimmen
- Die Rolle des „Ich-an-Sich“ in Fichtes System
- Kritik an Fichtes methodischen und philosophischen Argumenten
- Fichtes Bedeutung als Vorläufer der Phänomenologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Arbeit und ihren Fokus auf Fichtes „Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre“ vor. Sie erläutert die Herausforderungen, die sich aus der Auseinandersetzung mit Fichtes Text ergeben, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das erste Kapitel beleuchtet die Unterscheidung zwischen Idealismus und Dogmatismus, die Fichte in seiner Schrift vornimmt. Es wird erläutert, wie Fichte die Erfahrung als Ausgangspunkt für die Philosophie begreift und wie er den Dogmatismus als eine Form des Denkens kritisiert, die von der Intelligenz abstrahiert. Der Idealismus hingegen, so Fichte, konzentriert sich auf die Intelligenz und das „Ich-an-Sich“ als Grundlage der Erkenntnis.
Das zweite Kapitel widmet sich Fichtes „Wissenschaftslehre“ als Versuch, den Grund aller Erfahrung zu bestimmen. Es wird die Rolle des „Ich-an-Sich“ in Fichtes System beleuchtet und die Beziehung zwischen Intelligenz und Erfahrung im Rahmen der „Wissenschaftslehre“ erläutert.
Das dritte Kapitel bietet eine kritische Reflexion auf Fichtes „Wissenschaftslehre“. Es werden verschiedene Kritikpunkte an Fichtes Argumentation aufgezeigt, darunter seine methodische Inkonsequenz, seine solipsistische Verstrickung und das Paradoxon der Kohärenztheorie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Idealismus, den Dogmatismus, die Wissenschaftslehre, Fichte, das Ich-an-Sich, die Erfahrung, die Intelligenz, die Kritik, die Phänomenologie, die methodische Inkonsequenz, die solipsistische Verstrickung und das Paradoxon der Kohärenztheorie.
- Arbeit zitieren
- Mirko Wulf (Autor:in), 2007, Eine kritische Auseinandersetzung mit Fichtes Wissenschaftslehre, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112341