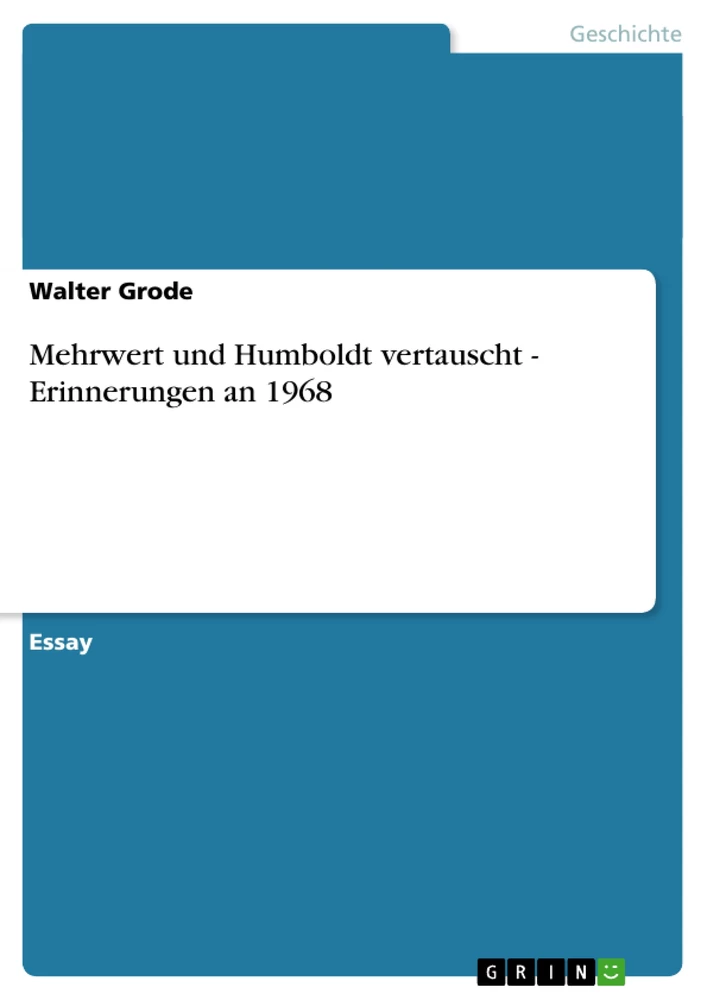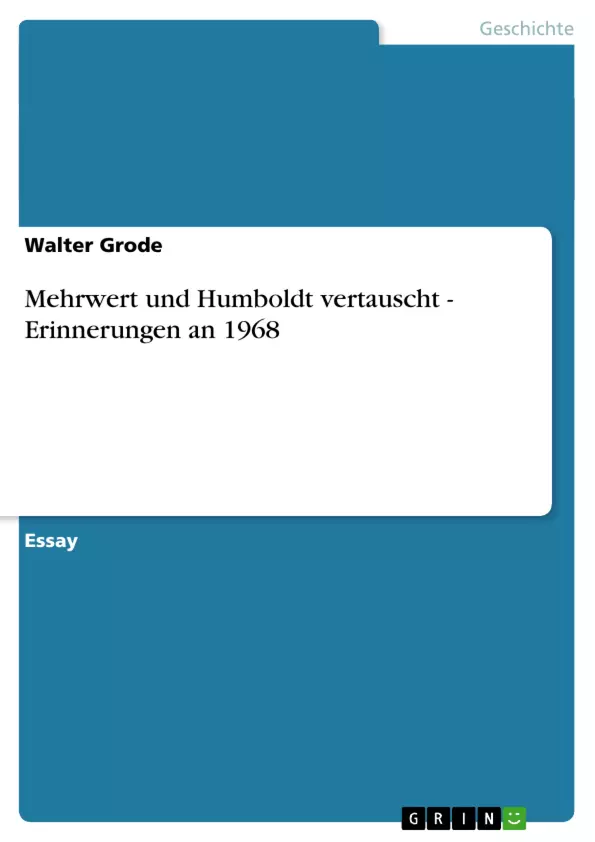Wer heute von >1968< spricht, denkt gewöhnlich an >die große Weigerung<, den großen Bruch der Studenten- mit ihrer bürgerlichen Vätergeneration. Eine solche Einstellung war mir damals vollkommen fremd. Die große >Weigerung< gegenüber dem Establishment< und die Idee einer antiautoritären Gesellschaft, die womöglich basisdemokratisch organisiert, irdisches, vor allem auch sinnliches Glück verhieß, war mir damals so fremd, wie die Frage nach der >Dialektik der Aufklärung<, deren Widersprüchlichkeit mir damals allenfalls aus den >Aufklärungsfilmen< eines >Oswald Kolle< vertraut war.
Die Erklärung ist einfach und, ich denke, doch nicht untypisch für eine halbe Generation von (ehemals) linken westdeutschen >KopfarbeiterInnen<: Ich bin – und das soll hier einmal positiv betont, und nicht nur von der Redaktion stillschweigend ausgebügelt werden – ein Kind der deutschen >Bildungskatastrophe<. Nämlich jener dramatischen Diagnose des Soziologen Georg Picht aus dem Jahre 1962, die da lautete, die bundesdeutsche Gesellschaft müsse angesichts des >Sputnik-Schocks< und der ausbleibenden Zuwanderung aus der DDR, über die in diesem Zusammenhang (offiziell) freilich nicht gesprochen wurde, über kurz oder lang im internationalen System-Wettbewerb kapitulieren, wenn nicht alle >Bildungsreserven< ausgeschöpft werden würden.
Anpassungsbereitschaft und Aufstiegsorientierung
Aufgewachsen in einem kleinbürgerlich-halbproletarischen Elternhaus entstammte ich objektiv genau jenen bildungsfernen Schichten, in denen Mitte der 60er Jahre diese Reserven vermutet wurden. Subjektiv und in meinem persönlichen Fall waren es wohl eher die nur halb bewußten Versprechungen der NS-Vergangenheit und die durch Flucht und Vertreibung hervorgerufene Erfahrung des Bruchs der eigenen Biographie, die meinen Eltern die entscheidende Maxime für meine Erziehung vorgaben.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Der Text ist eine persönliche Reflexion über die Erfahrungen des Autors im Kontext der 1968er-Bewegung und der deutschen Bildungskatastrophe. Er beschreibt, wie er als Kind kleinbürgerlicher Verhältnisse weniger von der "großen Weigerung" der Studentenbewegung, sondern vielmehr von Anpassungsbereitschaft und Aufstiegsorientierung geprägt war.
Was versteht der Autor unter "Bildungskatastrophe"?
Der Autor bezieht sich auf die Diagnose des Soziologen Georg Picht aus dem Jahr 1962, die besagte, dass die Bundesrepublik Deutschland aufgrund des "Sputnik-Schocks" und des fehlenden Zuzugs aus der DDR im internationalen Wettbewerb zurückfallen würde, wenn nicht alle "Bildungsreserven" ausgeschöpft würden.
Wie beeinflusste die "Bildungskatastrophe" die Erziehung des Autors?
Der Autor wuchs in einem Elternhaus auf, das objektiv zu den bildungsfernen Schichten gehörte, in denen diese "Bildungsreserven" vermutet wurden. Die Erfahrungen der Eltern mit Flucht und Vertreibung führten dazu, dass sie großen Wert auf Anpassungsbereitschaft und Aufstiegsorientierung legten, was sich in Verhaltensweisen wie Höflichkeit, Fleiß und Leistungsbereitschaft äußerte.
Welche Rolle spielten "Sekundärtugenden" in der Erziehung des Autors?
"Sekundärtugenden" wie Höflichkeit, Fleiß, Rationalität, Leistungsbereitschaft und Gefühlskontrolle standen in der Erziehung des Autors ganz oben an. Sie wurden als wichtige Verhaltensweisen angesehen, um den Erwartungen von Autoritäten gerecht zu werden und im Leben erfolgreich zu sein.
Wie unterschied sich die Erfahrung des Autors von der typischen Wahrnehmung der 1968er-Bewegung?
Im Gegensatz zu der Vorstellung von der 1968er-Bewegung als einer Zeit der "großen Weigerung" und des Bruchs mit der Elterngeneration war der Autor in seiner Jugend stärker von dem Wunsch nach Anpassung und Aufstieg geprägt. Die antiautoritären Ideen und die Kritik an der "Dialektik der Aufklärung" waren ihm fremd.
- Citar trabajo
- Dr. Walter Grode (Autor), 1998, Mehrwert und Humboldt vertauscht - Erinnerungen an 1968, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112379