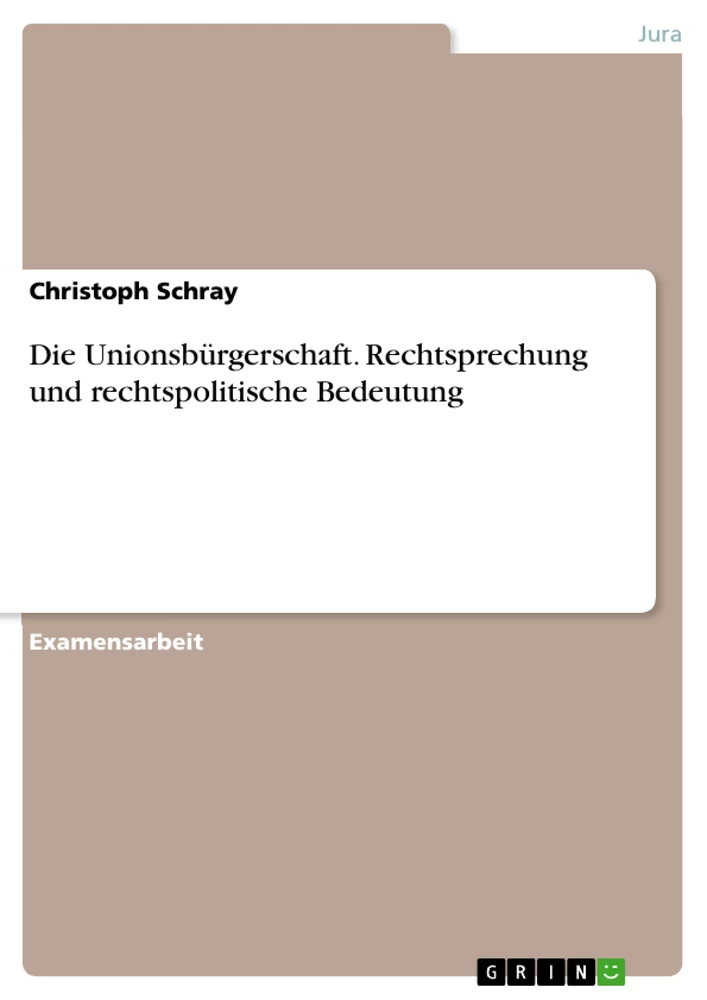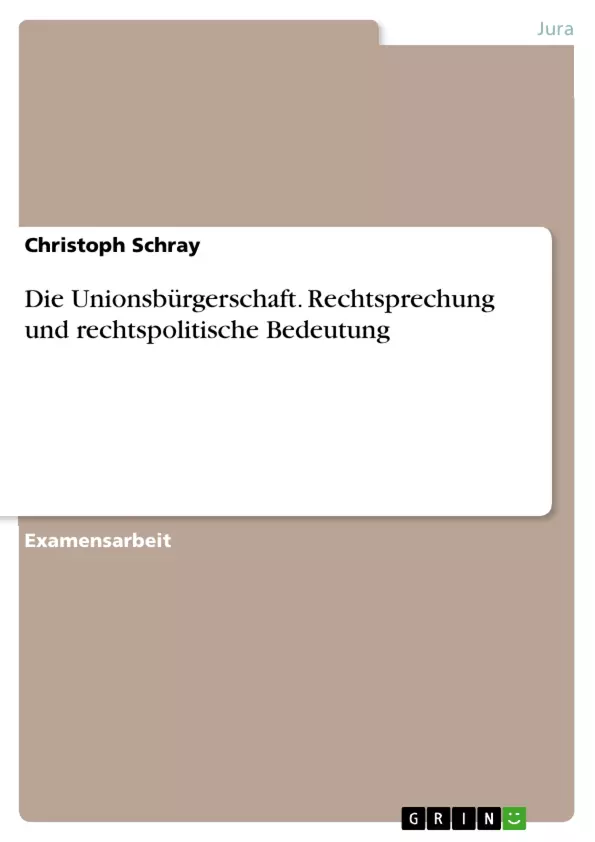Bis zum Pariser Gipfeltreffen vom 9./10. Dezember 1974 galten die Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft ausschließlich der wirtschaftlichen Integration. Dort wurde beschlossen, dass die Mitgliedstaaten eine Arbeitsgruppe einrichten um zu untersuchen, „unter welchen Voraussetzungen […] den Bürgern der Mitgliedstaaten besondere Rechte als Angehörige der Gemeinschaft zuerkannt werden können“. Auch die Kommission machte sich Gedanken zu solchen Bürgerrechten und legte ihre bereits sehr weitgehenden Vorstellungen in dem Bericht „Europa der Bürger“ im Juli 1975 die vor. So erachtete der Bericht als langfristiges Ziel u.a. „ auf dem Gebiet der politischen Rechte die vollständige Inländergleichstellung im Hinblick auf eine Europäische Union“, sowie das Kommunalwahlrecht und Zugang zu öffentlichen Ämtern. Die eingesetzte Arbeitsgruppe unter Leitung des belgischen Premierministers Tindemans schlug in ihrem Bericht „besondere Rechte“ – d.h. über die wirtschaftlichen Rechte hinaus – für die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten vor; v.a. ein individuelles Klagerecht beim EuGH, das Kommunalwahlrecht und den Ausbau der Freizügigkeit durch Abbau der Binnengrenzkontrollen . Zwar konnte sich der Rat nicht über die vorgeschlagenen Rechte einigen, führte jedoch als ersten Schritt 1976 die Direktwahl zum Europäischen Parlament ein. Erst in dem 1984 vom Europäischen Parlament verabschiedeten Spinelli-Vertragsentwurf zur Gründung einer Europäischen Union war zum ersten Mal die Rede von der „Unionsbürgerschaft“ mit besonderer Betonung der politischen Mitwirkungsrechte. Daraufhin setzte der Rat im gleichen Jahr einen Ad-hoc-Ausschuss, den sog. Adonnino-Ausschuss ein, dessen Ergebnisse weitgehend mit den heute geltenden Unionsbürgerrechten übereinstimmten. Trotz grundsätzlicher Zustimmung des Rates jedoch wurden diese nicht in der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 übernommen, in der noch die Verwirklichung des Binnenmarktes den Mittelpunkt bildete. Nachdem 1988 auch noch ein Richtlinienvorschlag der Kommission zum Kommunalwahlrecht aus formalen Gründen vom Rat abgelehnt wurde, war der Prozess der Einführung politischer Bürgerrechte vorerst auf Eis gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Die Unionsbürgerschaft – Rechtsprechung und Rechtspolitische Bedeutung
- I Einführung einer Unionsbürgerschaft
- 1.) Historische Einordnung
- 2.) Unionsbürgerliche Rechte und Pflichten
- a) Rechte der Unionsbürger
- (1) Allgemeines Freizügigkeitsrecht
- (2) Aktives und passives Wahlrecht bei Kommunalwahlen und den Wahlen zum Europäischen Parlament
- (3) Diplomatischer und konsularischer Schutz
- (4) Petitions- und Beschwerde- und Informationsrecht
- b) Pflichten der Unionsbürger
- II Rechtsprechung des EuGH zur Unionsbürgerschaft
- 1.) Urteilsauswertungen
- a) Vorrangigkeit der wirtschaftsbezogenen Grundfreiheiten
- b) Verbleibendes Definitionsrecht der Mitgliedstaaten
- c) Das Kriterium des Grenzübertrittes
- d) Abgeleitetes Freizügigkeitsrecht für Drittstaatsangehörige
- e) Minderheitenschutz auch für Unionsbürger
- f) Soziale Leistungen für Unionsbürger ohne wirtschaftlichen Kontext
- g) Unionsbürgerliches Diskriminierungsverbot
- 2.) Entwicklungstendenzen
- III Rechtspolitische Bedeutung der Unionsbürgerschaft
- 1.) Berichte der Kommission über die Unionsbürgerschaft
- a) Zusammenfassung der Berichte der Kommission zur Unionsbürgerschaft
- (1) Die Unionsbürgerschaft
- (2) Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit
- (3) Gleichbehandlung ungeachtet der Staatsangehörigkeit
- (4) Aktives und passives Wahlrecht
- (5) Recht auf diplomatischen und konsularischen Schutz
- (6) Recht auf außergerichtliche Rechtsmittel
- (7) Stärkung der Unionsbürgerschaft durch die Charta der Grundrechte
- (8) Information der Unionsbürger
- b) Stellungnahme zu den Kommissionsberichten
- 2.) Politische Intention der Unionsbürgerschaft
- 3.) Von der Marktbürgerschaft zur Unionsbürgerschaft
- 4.) Nationaler Staatsangehörigkeit und Unionsbürgerschaft
- IV Unionsbürgerschaft - Quo vadis?
- 1.) Kritische Betrachtung der Unionsbürgerschaft
- 2.) Die Unionsbürgerschaft als unabhängiger Status?
- 3.) Fortentwicklung der Unionsbürgerschaft
- Die Entwicklung der Unionsbürgerschaft in historischer Perspektive
- Die Rechte und Pflichten der Unionsbürger im Rahmen des Unionsrechts
- Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Unionsbürgerschaft
- Die rechtspolitische Bedeutung der Unionsbürgerschaft in Bezug auf die Europäische Integration
- Die Herausforderungen und Chancen der Unionsbürgerschaft in der Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Unionsbürgerschaft, ihrer Rechtsprechung und rechtspolitischen Bedeutung. Ziel ist es, die Entwicklung und Bedeutung der Unionsbürgerschaft im Kontext des europäischen Rechts zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine historische Einordnung der Unionsbürgerschaft und erläutert die unionsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Das zweite Kapitel widmet sich der Rechtsprechung des EuGH zur Unionsbürgerschaft, wobei verschiedene Urteile des Gerichtshofs analysiert werden. Das dritte Kapitel untersucht die rechtspolitische Bedeutung der Unionsbürgerschaft und analysiert die Berichte der Kommission über die Unionsbürgerschaft. Darüber hinaus wird die politische Intention der Unionsbürgerschaft sowie die Entwicklung von der Marktbürgerschaft zur Unionsbürgerschaft diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Unionsbürgerschaft, Europäisches Recht, Rechtsprechung, Europäischer Gerichtshof (EuGH), Freizügigkeit, Diskriminierungsverbot, soziale Leistungen, politische Rechte, Europäische Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Rechte eines Unionsbürgers?
Dazu gehören das Freizügigkeitsrecht, das Wahlrecht bei Kommunal- und Europawahlen sowie der diplomatische Schutz im Ausland.
Wann wurde die Unionsbürgerschaft offiziell eingeführt?
Erste Konzepte entstanden in den 1970er Jahren, aber rechtlich verankert wurde sie maßgeblich durch den Vertrag von Maastricht.
Welche Rolle spielt der EuGH bei der Unionsbürgerschaft?
Der EuGH hat durch seine Rechtsprechung das Diskriminierungsverbot gestärkt und soziale Leistungen für Unionsbürger auch ohne wirtschaftlichen Kontext ermöglicht.
Was ist der Unterschied zwischen Marktbürgerschaft und Unionsbürgerschaft?
Marktbürgerschaft bezog sich rein auf wirtschaftliche Freiheiten, während die Unionsbürgerschaft politische und soziale Rechte für alle EU-Bürger umfasst.
Haben Unionsbürger auch Pflichten?
Ja, die Verträge erwähnen neben den Rechten auch Pflichten, wenngleich diese weniger detailliert ausgearbeitet sind als die Rechte.
- Quote paper
- Christoph Schray (Author), 2007, Die Unionsbürgerschaft. Rechtsprechung und rechtspolitische Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112553