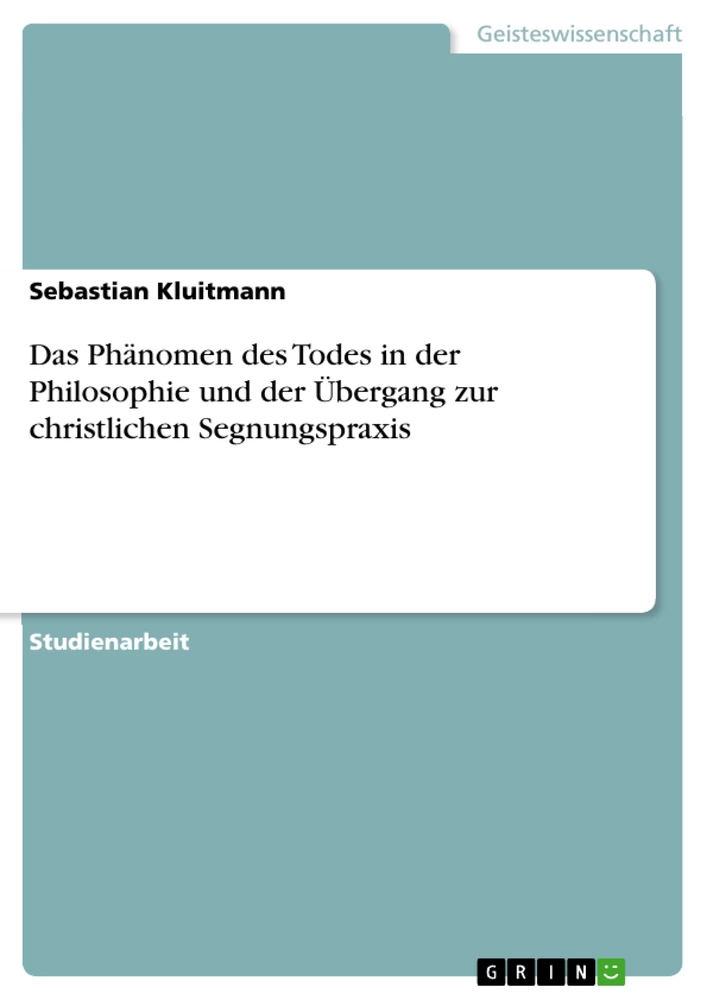In allen Kulturen und zu allen Zeiten hat Religion und Glauben eine wichtige Rolle gespielt. Sie ist wesentlicher Bestandteil jeder Kulturgesellschaft, Gesellschaft ohne Religion ist undenkbar. In der folgenden Arbeit werde ich einen Erklärungsansatz für die Omnipräsenz von Religion im menschlichen Leben aufzeigen und auf die Sichtweise des katholischen Christentums, speziell im Hinblick auf das Segensverständnis, eingehen. Den Anfang bildet in Anlehnung an Fink und sein Konzept der Grundphänomene des menschlichen Daseins eine anthropologische Erörterung, die den Menschen maßgeblich durch das Erkennen der eigenen Sterblichkeit charakterisiert sieht. Im Anschluss daran werden exemplarisch einige philosophische Positionen zum Tod vorgestellt. Im Tod sieht sich der Mensch mit einer unvorstellbar fremden Sphäre konfrontiert. Als Seiender schaut er in den Abgrund des Nicht-Seins und ist sich bewusst, dass er sich diesem mit jedem Tag unausweichlich nähert. Die Eigentümlichkeit der menschlichen Existenz liegt genau darin: als Lebender immer auch schon Sterbender zu sein und darum zu wissen. Es ist das Wissen um die eigene Sterblichkeit, das menschliches von anderem, beispielsweise tierischem Sein unterscheidet. Da sich aber das Nichts unserem Verstand radikal entzieht, sich nicht von uns begreifen lässt, bietet nur der Glaube die Möglichkeit, mit dem Nichts oder dem Numinosen, wie es z.B. Tugend hat oder Wiederkehr verstehen, umzugehen und es in unsere Lebenswelt zu integrieren. Religion erscheint so als Lebensweise, die es ermöglicht, sich positiv zu diesem unverständlichen übermächtigen Numinosen zu verhalten. Im Katholizismus geschieht dies im Gebet und Segen. Daher wird der letzte Teil dieser Arbeit schließlich verschiedene Sichtweisen und Arten von Segensfeiern thematisieren und damit verbundene Probleme aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anthropologische Vorüberlegungen
- Der Tod als wesentliches Merkmal menschlichen Daseins
- Philosophische Verhaltensweisen zum Tod
- Tod in Platons Phaidon
- Tod bei Epikur
- Tod bei Lukrez
- Der Tod bei Seneca
- Der Tod in Montaignes Essay 'Que Philosopher, c'est apprendre a mourir'
- Religiöse Verhaltensweisen zum Tod
- Segen
- Segen heute
- Schlussbemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von Religion und Glauben im menschlichen Leben, insbesondere im Hinblick auf das Segensverständnis im katholischen Christentum. Sie analysiert den Tod als ein zentrales Merkmal des menschlichen Daseins, ausgehend von Eugen Finks Konzept der Grundphänomene. Die Arbeit beleuchtet verschiedene philosophische Positionen zum Tod und zeigt auf, wie Religion als Lebensweise die Auseinandersetzung mit dem Nichts ermöglicht. Schließlich werden verschiedene Sichtweisen und Arten von Segensfeiern im Katholizismus thematisiert.
- Der Tod als Grundphänomen des menschlichen Daseins
- Philosophische Perspektiven auf den Tod
- Die Rolle von Religion im Umgang mit dem Tod
- Segensverständnis im katholischen Christentum
- Segensfeiern und ihre Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von Religion und Glauben im menschlichen Leben. Sie stellt das Konzept der Grundphänomene nach Eugen Fink vor und hebt den Tod als ein zentrales Merkmal des menschlichen Daseins hervor. Die Arbeit argumentiert, dass das Wissen um die eigene Sterblichkeit das Menschsein von anderen Lebensformen unterscheidet und dass Religion eine Möglichkeit bietet, mit dem Nichts oder dem Numinosen umzugehen.
Der Abschnitt "Anthropologische Vorüberlegungen" beschäftigt sich mit dem Tod als wesentlichem Merkmal menschlichen Daseins. Er erläutert Finks Konzept der Grundphänomene und zeigt auf, wie der Tod in der Spannung zu anderen Grundphänomenen wie Arbeit, Herrschaft, Liebe und Spiel steht. Der Tod wird als ein "rätselhaftes Doppelgesicht" der Lebensphänomene beschrieben, das den Menschen in seiner genuinen Seinsart ausmacht.
Der Abschnitt "Philosophische Verhaltensweisen zum Tod" präsentiert verschiedene philosophische Positionen zum Tod. Er analysiert die Sichtweisen von Platon, Epikur, Lukrez und Seneca sowie Montaignes Essay "Que Philosopher, c'est apprendre a mourir". Die verschiedenen Philosophen setzen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Tod auseinander und entwickeln verschiedene Strategien, um mit der Endlichkeit des menschlichen Lebens umzugehen.
Der Abschnitt "Religiöse Verhaltensweisen zum Tod" beleuchtet die Rolle von Religion im Umgang mit dem Tod. Er konzentriert sich auf das Segensverständnis im katholischen Christentum und zeigt auf, wie Gebet und Segen als Mittel dienen, um sich positiv zum Numinosen zu verhalten. Der Abschnitt beleuchtet verschiedene Arten von Segensfeiern und die damit verbundenen Probleme.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Tod als Grundphänomen des menschlichen Daseins, die philosophischen Perspektiven auf den Tod, die Rolle von Religion im Umgang mit dem Tod, das Segensverständnis im katholischen Christentum und die Bedeutung von Segensfeiern. Die Arbeit beleuchtet die anthropologische Bedeutung des Todes, die verschiedenen philosophischen Positionen zum Tod und die Rolle von Religion als Lebensweise, die es ermöglicht, sich positiv zum Nichts zu verhalten. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Segensverständnis im katholischen Christentum und den verschiedenen Arten von Segensfeiern.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Eugen Fink den Menschen im Kontext des Todes?
Nach Fink ist das Wissen um die eigene Sterblichkeit ein wesentliches Merkmal, das menschliches Sein von anderem, etwa tierischem Sein, unterscheidet.
Welche philosophischen Positionen zum Tod werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert Positionen von Platon (Phaidon), Epikur, Lukrez, Seneca und Montaigne.
Welche Rolle spielt die Religion im Umgang mit der Sterblichkeit?
Religion wird als Lebensweise verstanden, die es ermöglicht, sich positiv zum unbegreiflichen Nichts oder dem Numinosen zu verhalten und dieses in die Lebenswelt zu integrieren.
Was wird unter dem katholischen Segensverständnis untersucht?
Der Text thematisiert verschiedene Sichtweisen und Arten von Segensfeiern im Katholizismus als Form der religiösen Auseinandersetzung mit dem Dasein.
Was ist das "rätselhafte Doppelgesicht" nach Eugen Fink?
Es beschreibt den Tod als ein Grundphänomen, das in Spannung zu anderen Lebensphänomenen wie Arbeit, Liebe, Herrschaft und Spiel steht.
- Quote paper
- Sebastian Kluitmann (Author), 2008, Das Phänomen des Todes in der Philosophie und der Übergang zur christlichen Segnungspraxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112599