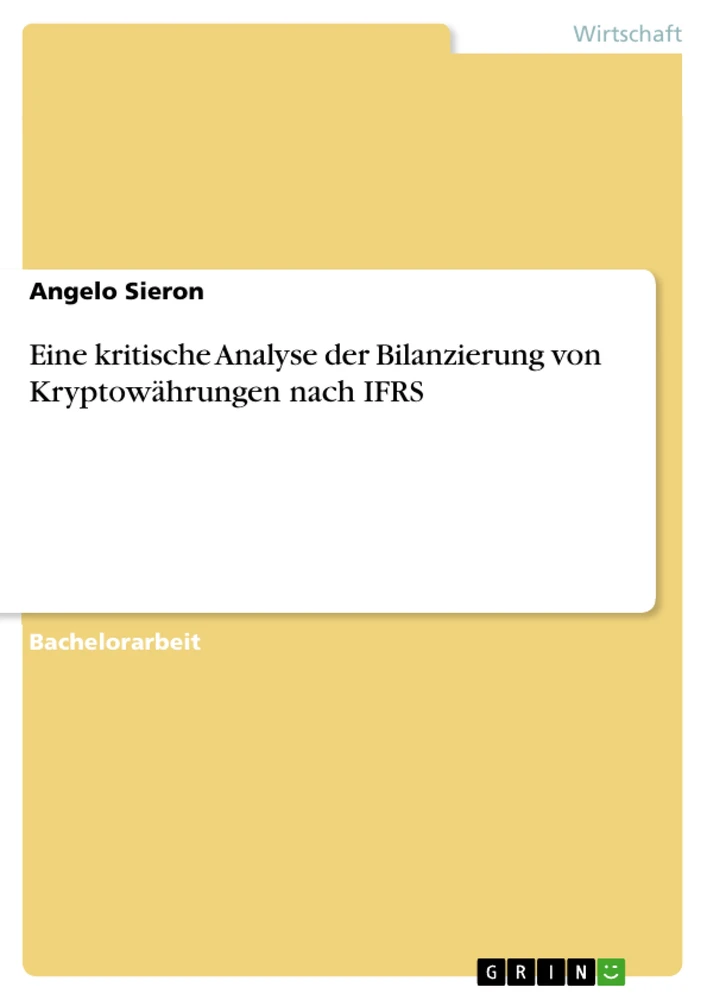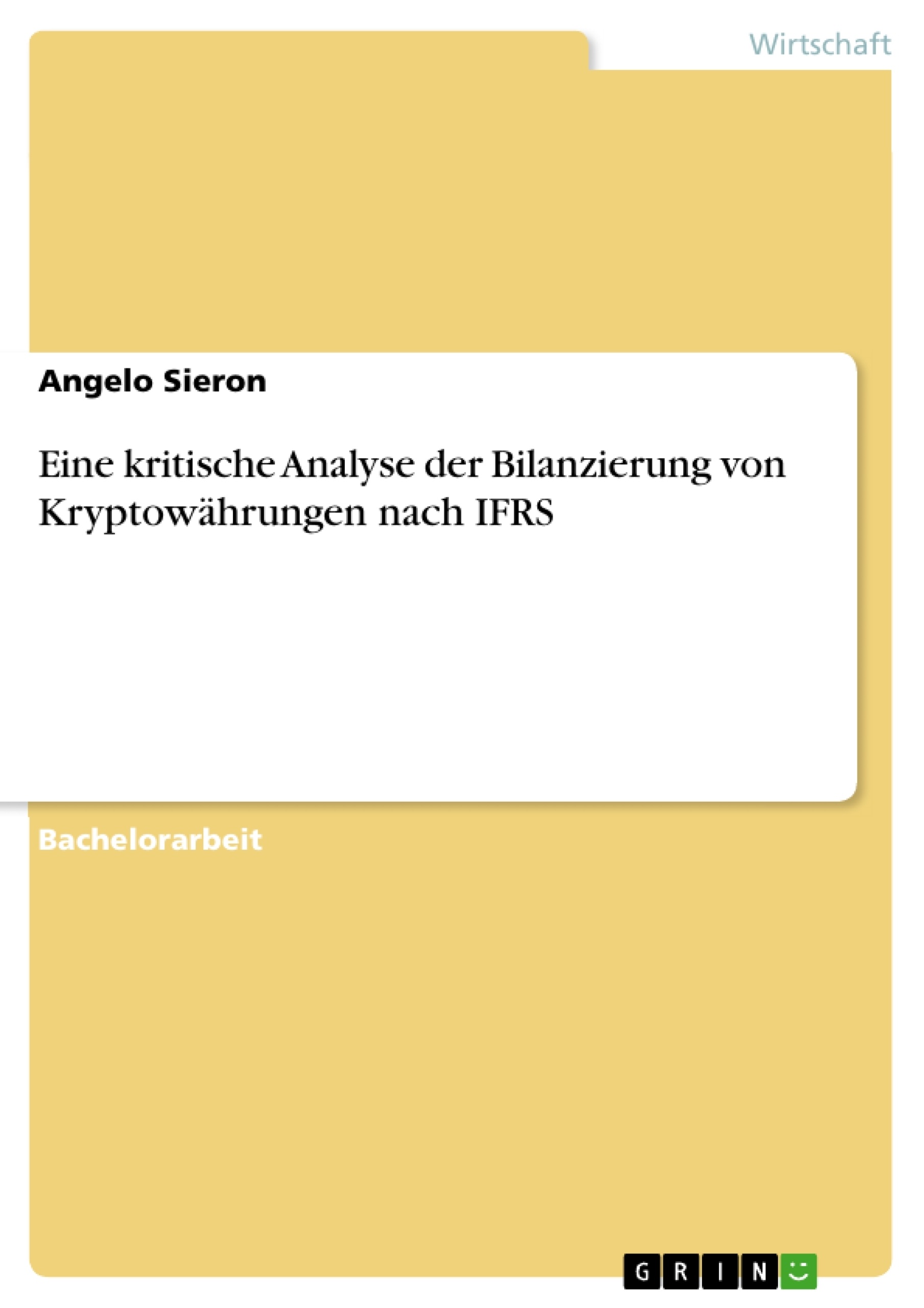Diese Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit einer kritischen Analyse der Bilanzierung von Kryptowährungen nach IFRS. Darüber hinaus wird geklärt, wie eine Folgebewertung von Kryptowährungen von Unternehmen im IFRS-Abschluss zu handhaben ist.
Was genau Kryptowährungen sind und wie sie funktionieren, wird in dieser Arbeit beantwortet. Die Beantwortung dieser Fragen ist ein wichtiger Vorgang, der eine Einordnung von Kryptowährungen ins IFRS-Normengefüge überhaupt ermöglicht. Im Anschluss werden die Ziele sowie einzelne Standards der IFRS näher betrachtet und erläutert. Diese theoretische Basis für Kryptowährungen und einzelne Standards ist notwendig, um nachfolgend zu analysieren, nach welchem Standard Kryptowährungen zu bilanzieren sind.
Außerdem wird durch diese Vorgehensweise, ein Verständnis für das Thema Kryptowährungen geschaffen. Dadurch wird die Einordnung ins IFRS-Normengefüge nachvollziehbarer. Ist die theoretische Basis geschaffen, kann eine Analyse erfolgen. Ziel dieser Analyse ist neben dem Ergebnis, wie Kryptowährungen nach IFRS zu bilanzieren sind, eine Handlungsempfehlung an den IASB. Verbesserungsvorschläge in der Handhabung verschiedener Probleme sowie Anregungen sollen schließlich ebenfalls durch diesen Beitrag erzielt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. KRYPTOWÄHRUNGEN ÜBERBLICK
- 2.1 DEFINITION KRYPTOWÄHRUNG
- 2.2 DIE ERSTE KRYPTOWÄHRUNG
- 2.3 WÄHRUNG
- 2.3.1 Definition Geld
- 2.3.2 Definition Währung
- 2.4 DEZENTRALISIERUNG
- 2.4.1 Zentrales System
- 2.4.2 Dezentrales System
- 2.5 BLOCKCHAIN
- 2.5.1 Das Konzept
- 2.5.2 Die Funktionsweise
- 2.5.3 Mining
- 2.6 BESCHAFFUNG VON KRYPTOWÄHRUNGEN
- 2.7 AUFBEWAHRUNG VON KRYPTOWÄHRUNGEN
- 2.7.1 Paper-Wallet
- 2.7.2 Mind-Wallet
- 2.7.3 Software-Wallet
- 2.7.4 Hardware-Wallet
- 3. IFRS ÜBERBLICK
- 3.1 WICHTIGKEIT INTERNATIONALER RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN
- 3.1.1 Abschlussadressaten
- 3.1.2 Ziele von Rechnungslegung für allgemeine Zwecke
- 3.1.3 Anwender in Deutschland
- 3.1.4 Anhang
- 3.2 VERMÖGENSWERTE
- 3.3 FINANZINSTRUMENTE GEMÄẞ IAS 32
- 3.4 IAS 7 KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
- 3.4.1 Zahlungsmittel
- 3.4.2 Zahlungsmitteläquivalente
- 3.5 VORRÄTE GEMÄẞ IAS 2
- 3.5.1 Bewertung von Vorräten
- 3.5.2 Folgebewertung von Vorräten
- 3.5.3 Angaben bei Vorräten
- 3.6 IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE GEMÄẞ IAS 38
- 3.6.1 Bewertung von immateriellen Vermögenswerten
- 3.6.2 Folgebewertung von immateriellen Vermögenswerten
- 3.6.3 Angaben bei immateriellen Vermögenswerten
- 3.1 WICHTIGKEIT INTERNATIONALER RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN
- 4. BILANZIERUNG VON KRYPTOWÄHRUNGEN NACH IFRS
- 4.1 KRYPTOWÄHRUNGEN ALS VERMÖGENSWERTE
- 4.1.1 Künftiger wirtschaftlicher Nutzen
- 4.1.2 In der Verfügungsmacht des Unternehmens
- 4.1.3 Resultat aus vergangenen Geschäftsaktivitäten
- 4.1.4 Ergebnis
- 4.2 KRYPTOWÄHRUNGEN ALS FINANZINSTRUMENT
- 4.3 KRYPTOWÄHRUNGEN ALS ZAHLUNGSMITTEL
- 4.4 KRYPTOWÄHRUNGEN ALS ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE
- 4.5 KRYPTOWÄHRUNGEN ALS VORRATSVERMÖGEN
- 4.5.1 Analyse
- 4.5.2 Bewertung bei Erstansatz
- 4.5.3 Folgebewertung
- 4.5.4 Angaben
- 4.5.5 Ergebnis
- 4.6 KRYPTOWÄHRUNGEN ALS IMMATERIELLER VERMÖGENSWERT
- 4.6.1 Analyse
- 4.6.2 Bewertung bei Erstansatz
- 4.6.3 Folgebewertung
- 4.6.4 Angaben
- 4.6.5 Ergebnis
- 4.7 KRITISCHE WÜRDIGUNG
- 4.1 KRYPTOWÄHRUNGEN ALS VERMÖGENSWERTE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bilanzierung von Kryptowährungen nach IFRS. Die Analyse fokussiert sich auf die Einordnung von Kryptowährungen in verschiedene Vermögenswerte und Bilanzpositionen nach IFRS. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Kryptowährungen als Finanzinstrumente, Zahlungsmittel, Vorräte oder immaterielle Vermögenswerte bilanziert werden sollten.
- Definition und Funktionsweise von Kryptowährungen
- Überblick über die relevanten IFRS-Standards
- Bilanzierungsansätze für Kryptowährungen
- Kritische Würdigung der verschiedenen Bilanzierungsansätze
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Kryptowährungen. Hier werden die Definition, die Funktionsweise und die Besonderheiten von Kryptowährungen erläutert. Das zweite Kapitel befasst sich mit einem Überblick über die International Financial Reporting Standards (IFRS). Hier werden die wichtigsten Standards und deren Bedeutung für die Bilanzierung von Kryptowährungen erläutert.
Im dritten Kapitel wird die Bilanzierung von Kryptowährungen nach IFRS analysiert. Dabei werden verschiedene Ansätze diskutiert, die für die Einordnung von Kryptowährungen in die Bilanz relevant sind. Diese Ansätze umfassen die Einordnung als Finanzinstrumente, Zahlungsmittel, Vorräte und immaterielle Vermögenswerte. Für jeden Ansatz werden die relevanten Kriterien des IFRS-Frameworks geprüft und bewertet.
Schlüsselwörter
Kryptowährungen, Bilanzierung, IFRS, Finanzinstrumente, Zahlungsmittel, Vorräte, Immaterielle Vermögenswerte, Blockchain, Mining, Dezentralisierung, Bewertung, Erstansatz, Folgebewertung, Angaben
Häufig gestellte Fragen
Können Kryptowährungen als Zahlungsmittel nach IFRS bilanziert werden?
Nach aktueller Analyse erfüllen Kryptowährungen meist nicht die strengen IFRS-Kriterien für Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente gemäß IAS 7.
Wann werden Kryptowährungen als Vorräte (IAS 2) bilanziert?
Dies ist der Fall, wenn das Unternehmen Kryptowährungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum Verkauf hält, beispielsweise als Krypto-Broker.
Sind Kryptowährungen immaterielle Vermögenswerte (IAS 38)?
In vielen Fällen werden sie als immaterielle Vermögenswerte eingestuft, da sie identifizierbare, nicht-monetäre Vermögenswerte ohne physische Substanz sind.
Gelten Kryptowährungen als Finanzinstrumente gemäß IAS 32?
Die Arbeit untersucht diese Einordnung kritisch, kommt jedoch oft zu dem Ergebnis, dass sie mangels vertraglichem Recht auf Cashflows nicht als klassische Finanzinstrumente gelten.
Wie erfolgt die Folgebewertung von Kryptowährungen?
Die Folgebewertung hängt vom gewählten Standard ab (z.B. Anschaffungskostenmodell oder Neubewertungsmodell bei IAS 38 oder Nettoveräußerungswert bei IAS 2).
- Citar trabajo
- Angelo Sieron (Autor), 2019, Eine kritische Analyse der Bilanzierung von Kryptowährungen nach IFRS, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1126065