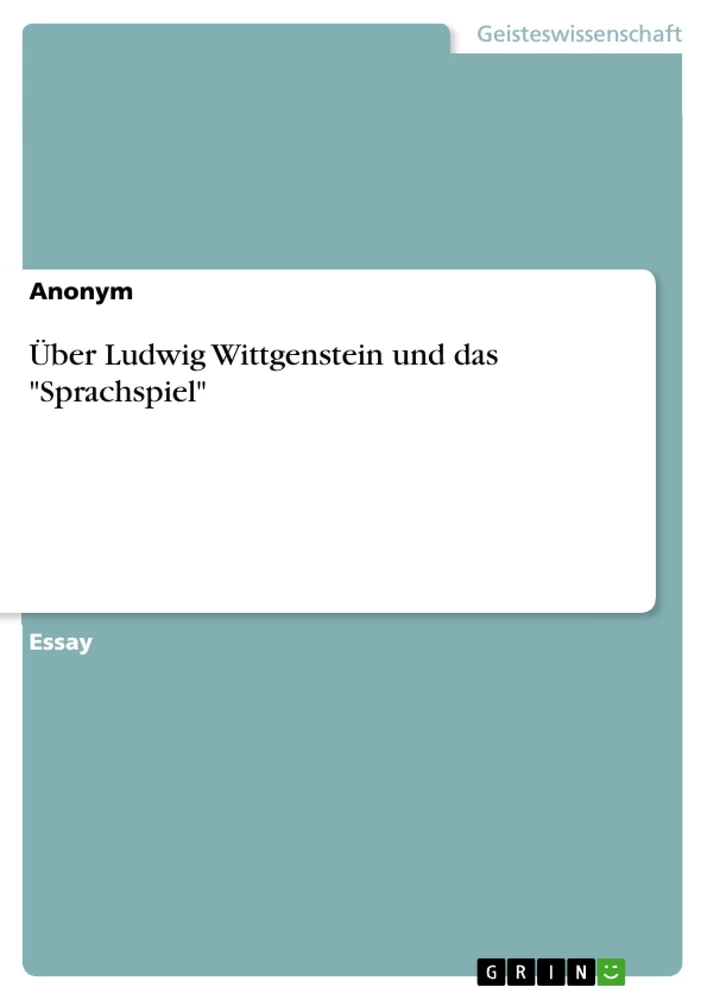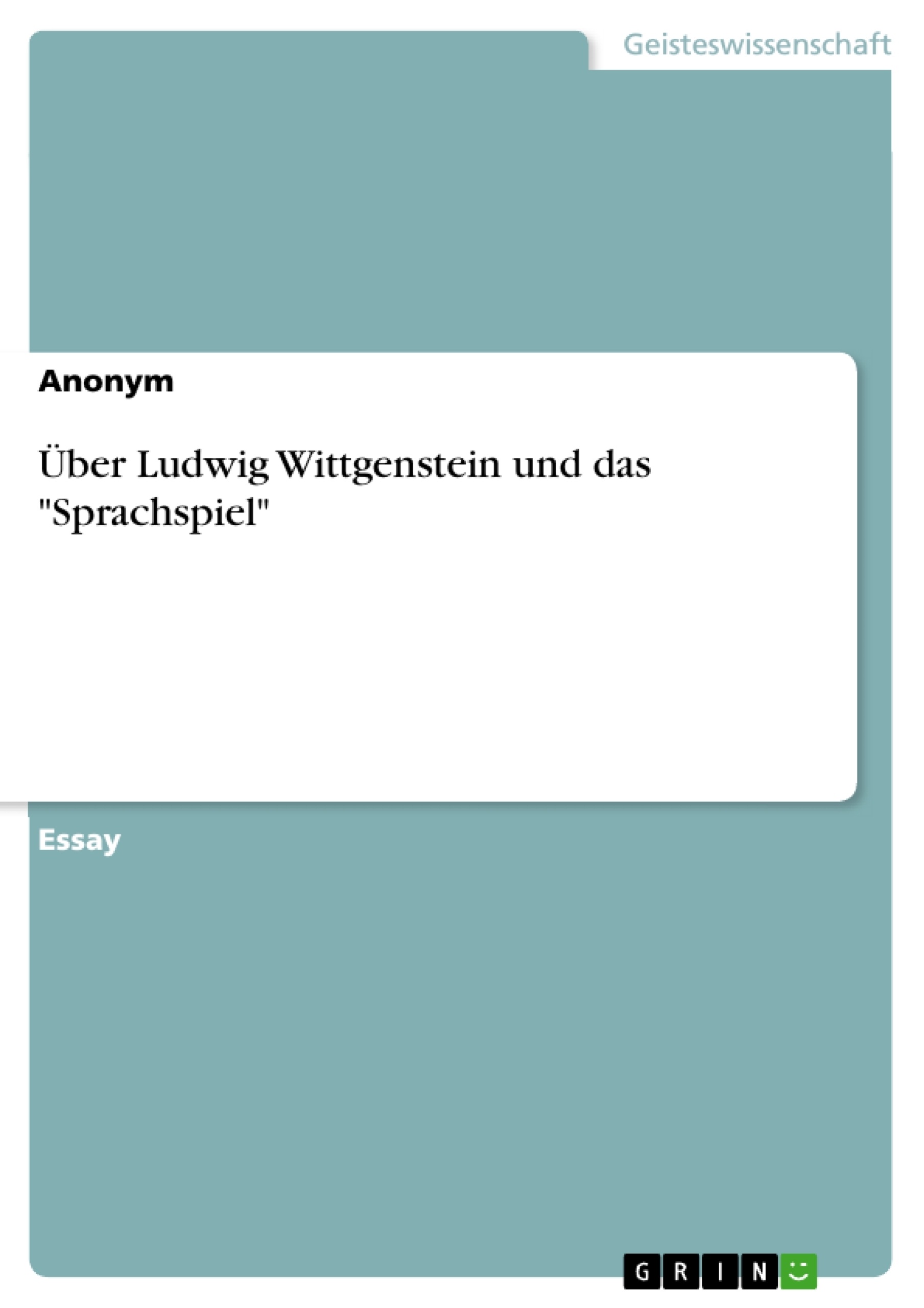Dieses kurze Essay soll den Versuch unternehmen, sich dem von Wittgenstein gewählten Begriff des "Sprachspiels" anzunähern und diesen anhand von Beispielen verdeutlichen.
Hierzu sollte erwähnt werden, dass Wittgenstein jenen Begriff nicht definiert. Nein, er umreißt ihn, in dem er keine klare Grenze zieht, welche das „Sprachspiel“ etwa von dem Begriff der Sprache oder dem des Gesprächs absondert. Würde Wittgenstein einem jeden Begriff eine Bedeutung zuordnen, resultierte daraus eine Aufspaltung seiner eigenen Philosophie. Er zerlege sie in scheinbar eindeutig belegte Begriffe. Der Interpret jedoch soll Wittgensteins Anspruch auf das Wesentliche verstehen und den roten Faden erkennen, anhand dessen er das Werk untersucht. Die zahlreichen unterschiedlichen Bezüge des Sprachspiels auf unterschiedliche Situationen, Beispiele und Lebensformen zeigen, dass das Sprachspiel mit seinen umfangreichen Schattierungen, mit einer klaren Definition nicht erfasst werden können. Wittgenstein untersucht diese Nuancen aus möglichst vielen Blickwinkeln. Was sich in den Paragraphen der PU widerspiegelt, welche immer wieder vom Sprachspiel handeln und sich aufeinander beziehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Augustinus und die „primitiven Sprachen“
- Das Sprachspiel und die „Familienähnlichkeiten“
- Sprache und Lebensformen
- Das Sprachspiel und die Situation
- Das Sprachspiel und die Tätigkeit
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit dem zentralen Begriff des „Sprachspiels“ in Ludwig Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“. Er analysiert Wittgensteins Ansatz, den Begriff des Sprachspiels nicht durch eine klare Definition zu fassen, sondern durch die Untersuchung seiner vielfältigen Bezüge auf verschiedene Situationen, Beispiele und Lebensformen. Das Ziel des Essays ist es, eine Annäherung an das Wesen und die Funktionsweise des Sprachspiels im Kontext der Wittgensteinschen Philosophie zu ermöglichen.
- Die Kritik an Augustinus’ Auffassung von Sprache
- Das Konzept der „Familienähnlichkeiten“ und die vielfältigen Bezüge des Sprachspiels
- Der Zusammenhang zwischen Sprache und Lebensformen
- Die Rolle des Sprachspiels in Situationen und Tätigkeiten
- Die Bedeutung des Sprachspiels für das Verständnis der menschlichen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt den zentralen Begriff des „Sprachspiels“ ein und skizziert die Herangehensweise des Essays.
- Das zweite Kapitel untersucht Augustinus’ Auffassung von Sprache und zeigt Wittgensteins Kritik an dieser Vorstellung.
- Im dritten Kapitel wird das Konzept der „Familienähnlichkeiten“ eingeführt und die vielschichtigen Bezüge des Sprachspiels auf verschiedene Situationen, Beispiele und Lebensformen beleuchtet.
- Das vierte Kapitel untersucht den engen Zusammenhang zwischen Sprache und Lebensformen, wobei verschiedene Möglichkeiten und Variationen von Sprachen und Lebensformen in den Vordergrund gestellt werden.
- Das fünfte Kapitel zeigt die Bedeutung des Sprachspiels in Situationen und Tätigkeiten auf, wobei der kreative Charakter von Sprache und die Anpassung von Regeln in bestimmten Situationen hervorgehoben werden.
- Das sechste Kapitel beleuchtet die Rolle des Sprachspiels in der Tätigkeit, mit dem Beispiel eines Bauarbeiters auf einer Baustelle.
Schlüsselwörter
Der Essay befasst sich mit zentralen Begriffen wie „Sprachspiel“, „Familienähnlichkeiten“, „Lebensform“, „primitiven Sprachen“, „Situation“, „Tätigkeit“ und „Kreativität“. Diese Schlüsselwörter bilden den Rahmen für die Analyse von Wittgensteins Philosophie und seinem Verständnis der menschlichen Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ludwig Wittgenstein unter einem „Sprachspiel“?
Wittgenstein definiert den Begriff nicht streng, sondern umreißt ihn als die Einheit von Sprache und den Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist. Es betont den praktischen Gebrauch der Sprache in Lebensformen.
Was bedeutet das Konzept der „Familienähnlichkeiten“?
Statt einer festen Definition für Begriffe wie „Sprache“ gibt es ein Netz von sich überschneidenden Ähnlichkeiten, so wie Familienmitglieder sich ähnlich sehen, ohne ein einziges gemeinsames Merkmal zu teilen.
Wie hängen Sprache und Lebensformen zusammen?
Sprache ist für Wittgenstein kein isoliertes System, sondern Teil einer Lebensform – also der sozialen Praktiken und kulturellen Hintergründe, in denen Menschen agieren.
Warum kritisiert Wittgenstein die Sprachauffassung von Augustinus?
Augustinus sah Sprache primär als Benennung von Objekten. Wittgenstein kritisiert dies als zu vereinfacht, da Sprache weit mehr Funktionen als nur das reine Bezeichnen von Dingen erfüllt.
Was ist ein Beispiel für ein Sprachspiel in Wittgensteins Werk?
Ein bekanntes Beispiel ist das des Bauarbeiters, der Rufe wie „Platte!“ oder „Säule!“ nutzt, um Tätigkeiten zu koordinieren – hier ist die Sprache direkt an eine Handlung gebunden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Über Ludwig Wittgenstein und das "Sprachspiel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1126167