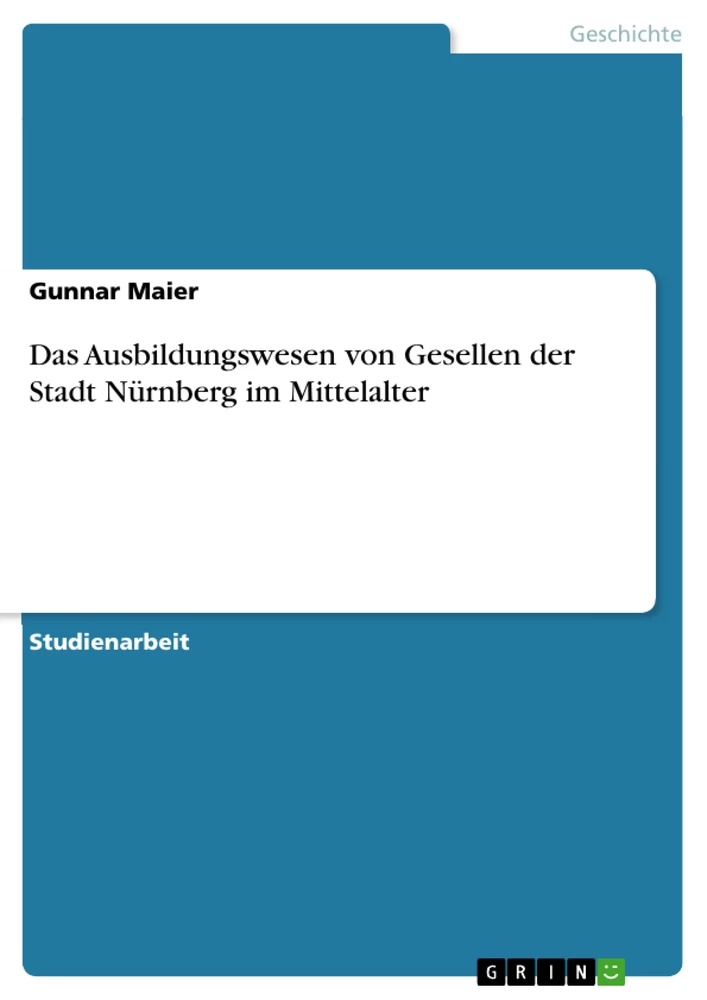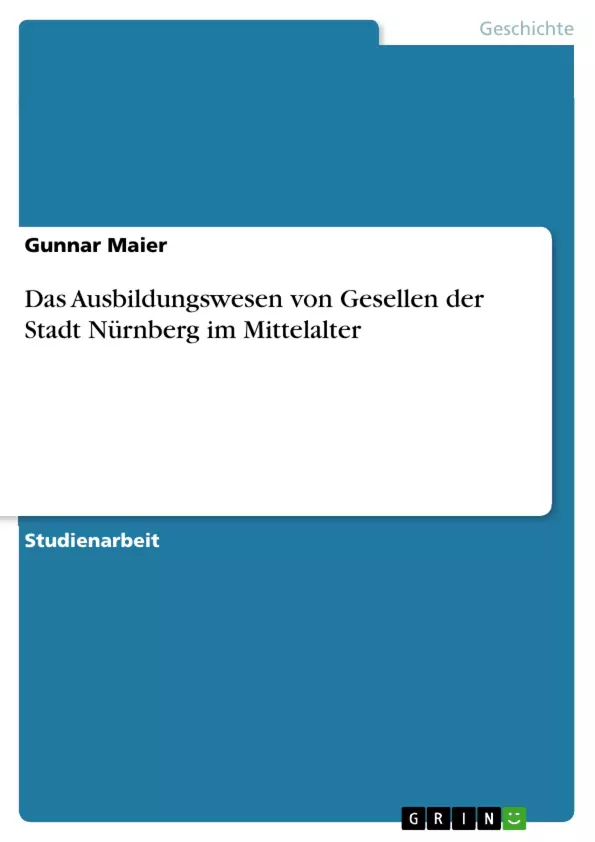Im Verlauf dieser Arbeit soll geklärt werden, wie Nürnberg seinen Sonderstatus als Handwerkerstadt erlangte, worin die Besonderheiten einer Ausbildung als Geselle bestanden und ob sich der Sonderstatus Nürnbergs auch über die spezielle Form der Gesellenbildung begründete.
Bei der Untersuchung der Entwicklung des Handwerkswesens für den Raum des Heiligen Römischen Reiches ist im Spätmittelalter der massive Bedeutungsgewinn der Stadt Nürnberg für Metall verarbeitende Handwerke besonders auffällig. Insbesondere bei der Eisenverarbeitung existieren Schätzungen, nach denen sich die Anzahl von Meistern in Eisen verarbeitenden Gewerben von ca. 500 Meistern 1420 n. Chr. auf ca. 2000 Meister 1550 n.Chr. gesteigert hat . Auch als einer der ersten Produktionsorte von Gewehrbüchsen, für deren Fertigung ebenfalls besondere Kenntnisse in der Metallbearbeitung erforderlich sind, wird eine Sonderbedeutung Nürnbergs bereits ab ca. 1356 angenommen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Regelungen bezüglich der Ausübung und des Einstieges in das Handwerk in Nürnberg anders waren und nicht etwa durch Zünfte, sondern primär durch die Stadtverwaltung selbst geregelt wurden. Zwar hatte es kurzzeitig, während des sog. Handwerkeraufstandes von Juni 1348 bis Oktober 1349, zunftähnliche Vereinigungen gegeben, allerdings wurden aufgrund des damit einhergehenden Zerwürfnisses der vorübergehenden Handwerkszünfte mit der Führung des Heiligen Römischen Reiches zunftähnliche Vereinigungen in Nürnberg für die gesamte spätere Zeit verboten. Die Regelung von Angelegenheiten, die üblicherweise durch Zünfte geregelt wurden, fiel in Nürnberg in die Zuständigkeit eines hierzu eingerichteten sog. Rugamtes. Auf der einen Seite lässt sich der Vorteil Nürnbergs im Vergleich zu anderen Städte in erheblichem Maße durch diese zentrale Lenkung der Handwerker durch die Stadtverwaltung erklären. Auf der anderen Seite bedeutete dies aber auch, dass die Stadtverwaltung sich mit vollkommen neuen Aufgaben befassen musste. Speziell für Handwerksgesellen bedeutete dies, dass sie in Nürnberg, z. B. für eine Prüfungszulassung zum Meister, direkt in Kontakt mit der Stadtverwaltung treten mussten. Auch die Vereinigung von Gesellen in eigenständigen Gruppierungen war den Gesellen, wie den Meistern in den Zünften, verboten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Frühe Berichte über die Stadt Nürnberg
- a) Gründung und frühe Entwicklung
- b) Herausbildung einer eigenen Verfassung und individueller Strukturen
- III. Der Handwerkeraufstand von 1348/49
- IV. Neuordnung der Nürnberger Gesellschaft
- a) Lenkung und Kontrolle der Handwerke über den Stadtrat
- b) Ausbildung und Gesellenstatus in Nürnberg
- V. Überregionaler Bedeutungsgewinn Nürnbergs
- VI. Zusammenfassung
- VII. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Ausbildungswesens für Gesellen in Nürnberg im Mittelalter. Sie beleuchtet die Besonderheiten des Nürnberger Systems im Vergleich zu anderen Städten des Heiligen Römischen Reiches, in denen die Handwerksorganisation meist durch Zünfte erfolgte. Die Arbeit analysiert die Rolle der Stadtverwaltung bei der Regulierung des Handwerks und den Einfluss dieser Regulierung auf die Ausbildung und den Status der Gesellen.
- Die Entwicklung des Handwerks in Nürnberg im Spätmittelalter
- Der Einfluss der Stadtverwaltung auf das Ausbildungswesen der Gesellen
- Der Vergleich des Nürnberger Systems mit dem zünftigen System anderer Städte
- Der Status der Gesellen in Nürnberg und seine Besonderheiten
- Die Bedeutung Nürnbergs als Handwerkerstadt
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und hebt die besondere Bedeutung Nürnbergs im spätmittelalterlichen Handwerk, insbesondere in der Metallverarbeitung, hervor. Sie stellt die Frage nach den Besonderheiten der Nürnberger Gesellen-Ausbildung im Vergleich zu anderen Städten und kündigt die Zielsetzung der Arbeit an: die Klärung der Entwicklung Nürnbergs zu einer Sonderposition als Handwerkerstadt, der Besonderheiten der Gesellen-Ausbildung und des Zusammenhangs zwischen dem Sonderstatus und der speziellen Form der Gesellenbildung.
II. Frühe Berichte über die Stadt Nürnberg: Dieses Kapitel befasst sich mit den Schwierigkeiten der Rekonstruktion der frühen Geschichte Nürnbergs, insbesondere der Bestimmung des Gründungsdatums. Es analysiert die erste urkundliche Erwähnung Nürnbergs im 11. Jahrhundert und beleuchtet die Funktion Nürnbergs als Kaiserliche Festung. Der Fokus liegt auf der frühen Entwicklung der Siedlung und der Herausbildung dauerhafter Strukturen, die den späteren Aufstieg Nürnbergs als Handwerkszentrum vorbereitet haben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entwicklung des Nürnberger Gesellenwesens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Ausbildungswesens für Gesellen in Nürnberg im Mittelalter. Sie beleuchtet die Besonderheiten des Nürnbergs Systems im Vergleich zu anderen Städten des Heiligen Römischen Reiches, in denen die Handwerksorganisation meist durch Zünfte erfolgte. Die Arbeit analysiert die Rolle der Stadtverwaltung bei der Regulierung des Handwerks und den Einfluss dieser Regulierung auf die Ausbildung und den Status der Gesellen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des Handwerks in Nürnberg im Spätmittelalter, den Einfluss der Stadtverwaltung auf das Ausbildungswesen der Gesellen, einen Vergleich des Nürnbergs Systems mit dem zünftigen System anderer Städte, den Status der Gesellen in Nürnberg und dessen Besonderheiten sowie die Bedeutung Nürnbergs als Handwerkerstadt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Frühe Berichte über die Stadt Nürnberg (mit Fokus auf Gründung und Entwicklung sowie die Herausbildung eigener Strukturen), Der Handwerkeraufstand von 1348/49, Neuordnung der Nürnberger Gesellschaft (inkl. Lenkung der Handwerke und Ausbildung der Gesellen), Überregionaler Bedeutungsgewinn Nürnbergs, Zusammenfassung und Anhang.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein und hebt die besondere Bedeutung Nürnbergs im spätmittelalterlichen Handwerk, insbesondere in der Metallverarbeitung, hervor. Sie stellt die Frage nach den Besonderheiten der Nürnberger Gesellen-Ausbildung im Vergleich zu anderen Städten und kündigt die Zielsetzung der Arbeit an: die Klärung der Entwicklung Nürnbergs zu einer Sonderposition als Handwerkerstadt, der Besonderheiten der Gesellen-Ausbildung und des Zusammenhangs zwischen dem Sonderstatus und der speziellen Form der Gesellenbildung.
Was wird im Kapitel "Frühe Berichte über die Stadt Nürnberg" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit den Schwierigkeiten der Rekonstruktion der frühen Geschichte Nürnbergs, insbesondere der Bestimmung des Gründungsdatums. Es analysiert die erste urkundliche Erwähnung Nürnbergs im 11. Jahrhundert und beleuchtet die Funktion Nürnbergs als Kaiserliche Festung. Der Fokus liegt auf der frühen Entwicklung der Siedlung und der Herausbildung dauerhafter Strukturen, die den späteren Aufstieg Nürnbergs als Handwerkszentrum vorbereitet haben.
Wie unterscheidet sich das Nürnberger System von anderen Städten?
Die Arbeit untersucht die Besonderheiten des Nürnberger Systems im Vergleich zu anderen Städten des Heiligen Römischen Reiches, wo die Handwerksorganisation meist durch Zünfte erfolgte. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Stadtverwaltung bei der Regulierung des Handwerks und dem Einfluss dieser Regulierung auf die Ausbildung und den Status der Gesellen. Nürnberg entwickelte sich zu einer Sonderposition als Handwerkerstadt mit einer spezifischen Form der Gesellenbildung.
- Quote paper
- Gunnar Maier (Author), 2013, Das Ausbildungswesen von Gesellen der Stadt Nürnberg im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1126210