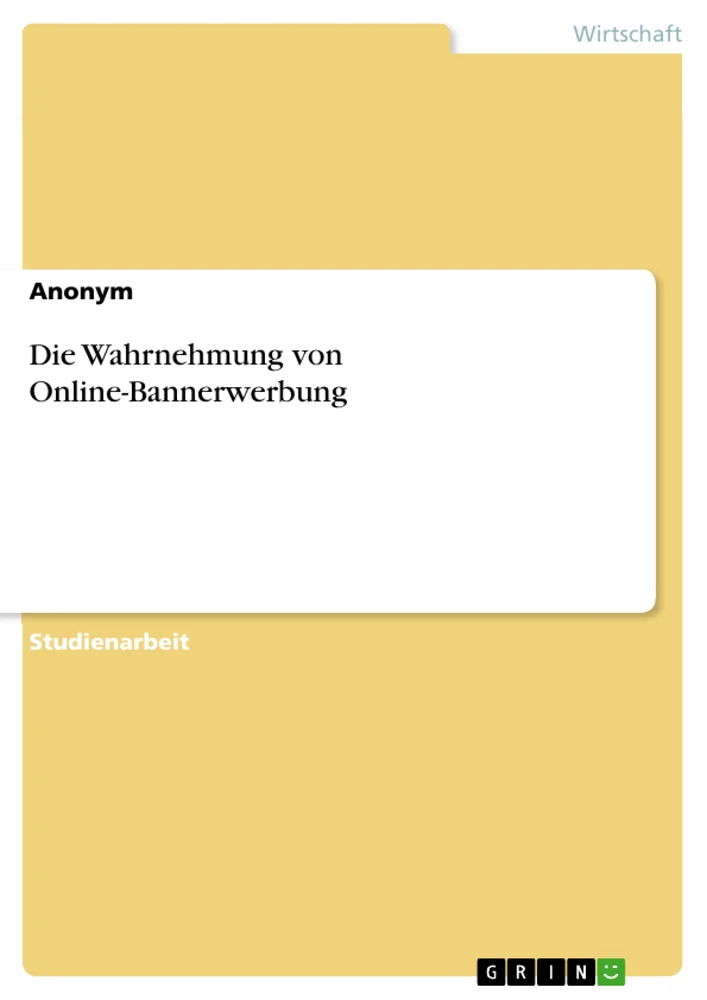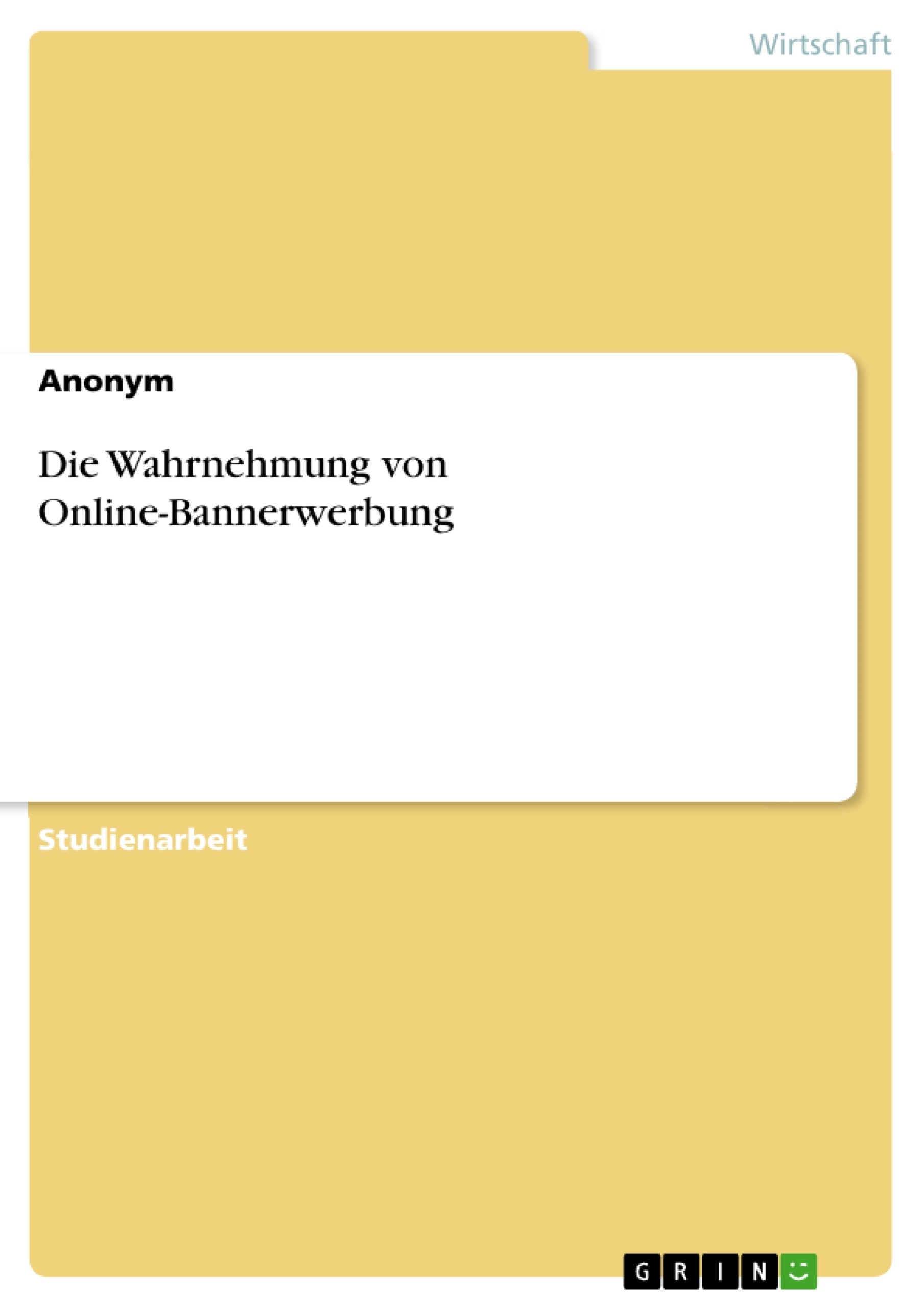Das Internet hat sich als fester Bestandteil mit rund 4,13 Milliarden Nutzern weltweit in unseren Alltag integriert. Da dies 63 % der Bevölkerung entspricht, stellt es für Werbetreibende eine gute Möglichkeit dar, ihre Produkte und Dienstleistungen auf demselben Kanal zu präsentieren. Jedoch steigt mit wachsender Kontaktchance auf potenzielle Konsumenten auch die Anzahl an Mittbewerbern. Allein im letzten Jahr sind global 325,02 Milliarden US-Dollar in die Investition von Online-Werbung geflossen. Somit werden wir im World Wide Web nahezu überschüttet mit Informationen aus Online-Werbung jeglicher Art, die aufgrund des Umfangs dieser Arbeit jedoch nur die Bannerwerbung näher darstellt.
Alle Banner in seinen Einzelheiten oder als Ganzes, wahrnehmen und auffassen zu können ist aufgrund der limitierten Kapazität des menschlichen Gehirns jedoch nicht möglich. Die erste Hürde stellt dabei die sogenannte Wahrnehmungsschwelle dar. Um diese zu überbrücken, greifen viele Unternehmen bei der Erstellung auf bereits erfolgreiche Banner von Wettbewerbern zurück. Oftmals ist hier keine wissenschaftliche Grundlage dahinter. Hierbei wird die Multivariate Test-Methode häufig in Gebrauch genommen, um herauskristallisieren zu können welcher Entwurf sich am besten einigt, um die Wahrnehmung steigern zu können und der Banner-Blindheit zu entgehen. Aufgrund
dessen lässt sich die folgende Forschungsfrage ableiten: Kann man durch den bewussten Einsatz von Designelementen die Wahrnehmung von Online-Bannern erhöhen?
Hierbei wird in der vorliegenden Arbeit eine Online-Umfrage die die quantitative Methode, des Multivariate Tests inkludiert mit ca. 100 Probanden durchgeführt. Diese Primärforschung mit stützender Sekundärliteratur soll Unternehmen bei der Erstellung von Bannerwerbung entlasten sowie unterstützen. In Kapitel zwei wird die Wahrnehmung
eines Menschen näher betrachtet. Im dritten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Bannerwerbung definiert und dient lediglich dem Verständnis des Untersuchungsgegenstandes. Im vierten Kapitel wird das methodische Vorgehen vorgestellt, um die aus dem vorherigen Kapitel abgeleiteten Informationen zu bestätigen oder widerlegen zu
können. Hierbei werden die Ergebnisse der Primärforschung analysiert und verglichen.
Anschließend folgt in der Diskussion die Hypothesenprüfung. Zum Schluss resultiert ein Fazit indessen die gesammelten Kenntnisse und Ergebnisse zusammengefasst werden und eine Handlungsempfehlung ausgesprochen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Wahrnehmung
- 3 Bannerwerbung
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 3.2 Bannerblindheit
- 3.3 Formate
- 3.4 Gestaltungselemente
- 3.4.1 Texte
- 3.4.2 Farben
- 3.4.3 Motive
- 4 Methodisches Vorgehen
- 4.1 Methodenauswahl
- 4.2 Durchführung
- 4.3 Ergebnisse
- 5 Diskussion
- 6 Fazit und Handlungsempfehlung
- 7 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Wirkung von Designelementen auf die Wahrnehmung von Online-Bannerwerbung. Ziel ist es, herauszufinden, ob und wie der bewusste Einsatz von Gestaltungselementen die Wahrnehmung von Online-Bannern verbessern kann und somit der Bannerblindheit entgegenwirken kann. Die Ergebnisse sollen Unternehmen bei der Gestaltung effektiver Bannerwerbung unterstützen.
- Wahrnehmung von Online-Bannern
- Bannerblindheit und deren Überwindung
- Einfluss von Gestaltungselementen (Texte, Farben, Motive)
- Methodische Vorgehensweise (Online-Umfrage, Multivariate Tests)
- Praktische Handlungsempfehlungen für die Bannergestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Online-Bannerwerbung ein und stellt die zunehmende Bedeutung von Online-Werbung im Kontext der hohen Anzahl an Internetnutzern und dem damit verbundenen Wettbewerbsdruck heraus. Sie verdeutlicht die Herausforderung, die Aufmerksamkeit der Nutzer angesichts der Informationsüberflutung zu gewinnen und die Problematik der Bannerblindheit. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann man durch bewussten Einsatz von Designelementen die Wahrnehmung von Online-Bannern erhöhen? Die Arbeit beschreibt die durchgeführte Online-Umfrage mit ca. 100 Probanden als Methode zur Beantwortung dieser Frage und benennt den Fokus auf die Bannerwerbung innerhalb des breiten Spektrums der Online-Werbung.
3 Bannerwerbung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema Online-Bannerwerbung. Es beinhaltet eine genaue Begriffsbestimmung, beleuchtet das Phänomen der Bannerblindheit und beschreibt verschiedene Bannerformate. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Gestaltungselementen wie Text, Farbe und Motiv, wobei der Einfluss dieser Elemente auf die Wahrnehmung der Banner detailliert analysiert wird. Die Kapitelteile führen den Leser systematisch in die theoretischen Grundlagen der Bannergestaltung ein und bereiten den Weg für die methodische Untersuchung der Arbeit.
4 Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die methodische Herangehensweise der Arbeit. Es beinhaltet eine Begründung der gewählten Methodenauswahl (Online-Umfrage mit quantitativen Methoden, einschließlich des Multivariate Tests) sowie die Darstellung der Durchführung der Umfrage. Die Erläuterung der Ergebnisse wird hier nur angerissen, die detaillierte Analyse der Ergebnisse erfolgt in einem späteren Kapitel. Die Kapitelteile beschreiben den gesamten methodischen Ablauf von der Konzeption bis zur Datenerhebung und schaffen Transparenz bezüglich des wissenschaftlichen Ansatzes der Arbeit.
Schlüsselwörter
Online-Bannerwerbung, Wahrnehmung, Bannerblindheit, Gestaltungselemente, Multivariate Tests, Online-Umfrage, Designelemente, Marketing, Effektivität, User-Experience
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Wirkung von Designelementen auf die Wahrnehmung von Online-Bannerwerbung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Wirkung von Designelementen auf die Wahrnehmung von Online-Bannerwerbung. Im Fokus steht die Frage, ob und wie der bewusste Einsatz von Gestaltungselementen (Texte, Farben, Motive) die Wahrnehmung von Online-Bannern verbessern und der Bannerblindheit entgegenwirken kann.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, herauszufinden, wie Unternehmen die Wahrnehmung ihrer Online-Banner verbessern und somit effektivere Bannerwerbung gestalten können. Die Ergebnisse sollen Unternehmen bei der Gestaltung ihrer Banner unterstützen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Wahrnehmung von Online-Bannern, Bannerblindheit und deren Überwindung, Einfluss von Gestaltungselementen (Texte, Farben, Motive), methodische Vorgehensweise (Online-Umfrage, Multivariate Tests) und praktische Handlungsempfehlungen für die Bannergestaltung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Wahrnehmung, Bannerwerbung (inkl. Begriffsbestimmung, Bannerblindheit, Formate und Gestaltungselemente), Methodisches Vorgehen (Methodenauswahl, Durchführung, Ergebnisse), Diskussion, Fazit und Handlungsempfehlung sowie Quellenverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Online-Umfrage mit ca. 100 Probanden und verwendet quantitative Methoden, einschließlich multivariater Tests. Das methodische Vorgehen wird detailliert im entsprechenden Kapitel beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die detaillierte Analyse der Ergebnisse der Online-Umfrage wird in einem separaten Kapitel vorgestellt. Das Kapitel "Methodisches Vorgehen" gibt einen ersten Überblick über die Datenerhebung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Online-Bannerwerbung, Wahrnehmung, Bannerblindheit, Gestaltungselemente, Multivariate Tests, Online-Umfrage, Designelemente, Marketing, Effektivität, User-Experience.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen werden im letzten Kapitel präsentiert. Es wird zusammengefasst, inwieweit der bewusste Einsatz von Designelementen die Wahrnehmung von Online-Bannern verbessert und welche praktischen Empfehlungen sich daraus für Unternehmen ableiten lassen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Unternehmen, die Online-Bannerwerbung einsetzen, Marketingfachleute, Webdesigner und alle, die sich mit der Optimierung von Online-Werbung und User-Experience beschäftigen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden sich im vollständigen Text der Seminararbeit, inklusive der detaillierten Ergebnisse und der vollständigen Literaturangaben im Quellenverzeichnis.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die Wahrnehmung von Online-Bannerwerbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1126425