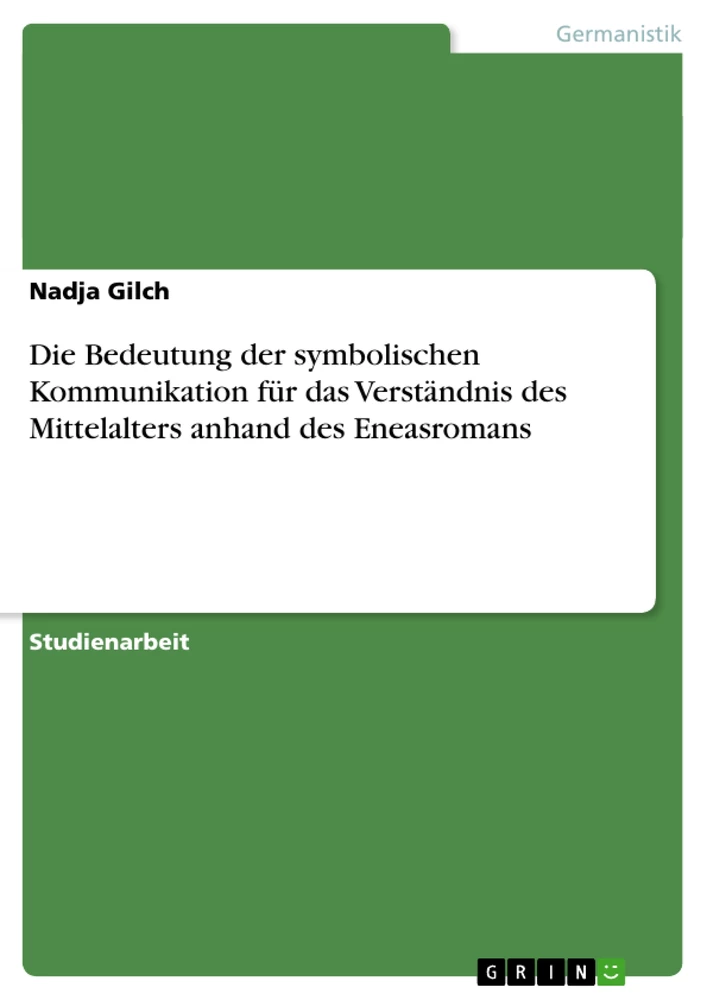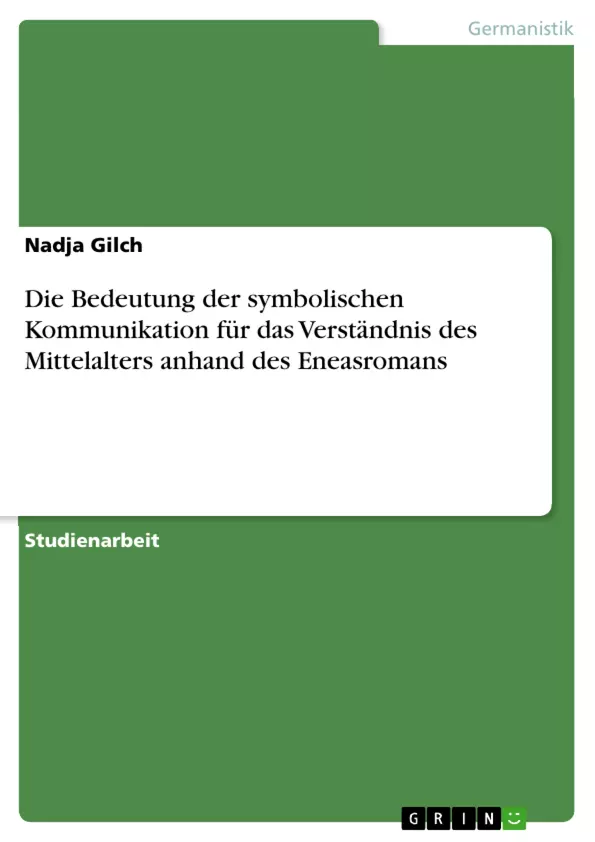In der heutigen Zeit ist es üblich, dass für Abmachungen und rechtliche Schritte eine schriftliche Fixierung stattfindet. Dies findet meist in Formen von Verträgen in jeglicher Art statt. Im Mittelalter war diese Vorgehensweise in dieser Form noch nicht möglich. Aus diesem Grund muss „die symbolische Kommunikation als die im Mittelalter dominante Form angesehen werden.“ [...] Im Mittelalter unterschied man drei verschiedene Formen von symbolischer Kommunikation. Das öffentliche Bitten, wurde durch Fürsprecher inszeniert, dabei wurde die Bitte an den Adressaten herangebracht, was diesem ermöglichte als gnädig angesehen zu werden, wenn der Bitte nachgegangen wurde. Durch den Einsatz der Fürsprecher wurde eine große Machtfülle und Entscheidungsfreiheit der Mächtigen suggeriert. Öffentliche Bitten liefen nach einem festen Schema ab. Dabei musste der Bittsteller eine unterwürfige Haltung, in Form eines in die Kniesinkens oder eines wortlosen Fußfalls, einnehmen. Darauf folgte dann das gnädige Gewähren, das sich darin äußert, dass „der Bittsteller vom Boden [aufgehoben wurde, an der Hand zu einem Ehrenplatz geleitet wurde und ihm die Erlaubnis zum Vortragen seiner Bitte gewährt wurde]“.
Das öffentliche Scherzen „signalisierte Frieden und symbolisierte Freundschaft“, und fand meist bei Mählern und Gelagen statt. Die öffentliche Unterwerfung diente dazu, das eigene Leben nach einer militärischen Niederlage zu retten. Das war für den Unterlegenen ein entwürdigendes Szenario, in dem er „barfuß und halbnackt, […], flehen[d] unter Tränen und stammelnd um Gnade, dabei Selbstbezichtigung und Formeln der Selbstaufgabe [dem siegreichen Kontrahenten vorbrachte]“. In der folgenden Arbeit wird auf die symbolische Kommunikation und ihre verschiedenen Formen anhand entsprechender Stellen im Eneasroman näher eingegangen. Hierbei wird auf die von Althoff vorgegebene Struktur geachtet und versucht zu analysieren, warum Heinrich von Veldeke meistens eine abgeänderte und oft stark reduzierte Handlung gewählt hat. Auch wird auf die unterschiedlichen äußeren, politischen und standesgesellschaftlichen Änderungen, vor allem bei den öffentlichen Bitten eingegangen. In der folgenden Arbeit werden jedoch die privaten Bitten die vorgetragen werden weggelassen, da von Althoff für diese keine festen Regeln aufgeführt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Das öffentliche Bitten im Eneasroman
- 1.1 Bitte um Aufnahme bei Dido
- 1.2 Bitte um Aufnahme bei Latinus
- 1.3 Bitte des Turnus um Unterstützung und Rat
- 1.4 Bitte des Eneas für freien Abzug seines Sohnes Ascanius
- 1.5 Bitte des Turnus am Leben bleiben zu dürfen
- 2. Das öffentliche Scherzen im Eneasroman
- 2.1 Spott wegen des Briefs von Lavinia
- 2.2 Spott über aufkommende Liebe zwischen Eneas und Lavinia
- 3. Die öffentliche Unterwerfung des Turnus im Eneasroman
- 1. Das öffentliche Bitten im Eneasroman
- III. Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die symbolische Kommunikation im mittelalterlichen Eneasroman von Heinrich von Veldeke. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Kommunikationsform für das Verständnis des Mittelalters zu beleuchten und die von Althoff beschriebenen Formen (öffentliches Bitten, Scherzen, Unterwerfung) im Roman zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Abweichungen von Veldekes Darstellung im Vergleich zu den von Althoff beschriebenen idealtypischen Formen gelegt.
- Symbolische Kommunikation im Mittelalter
- Analyse der öffentlichen Bitten im Eneasroman
- Vergleich von Veldekes Darstellung mit den von Althoff beschriebenen idealtypischen Formen
- Der Einfluss politischer und gesellschaftlicher Faktoren auf die symbolische Kommunikation
- Die Rolle der Fürsprecher und die Inszenierung der Bitten
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der symbolischen Kommunikation im Mittelalter ein und stellt die Bedeutung schriftlicher Fixierung im Gegensatz zur mittelalterlichen Praxis heraus. Sie definiert symbolische Kommunikation nach Althoff und beschreibt deren Funktion zur Herstellung von Konsens und zur Vermeidung von Konflikten. Die Arbeit fokussiert auf die öffentlichen Formen der symbolischen Kommunikation, die im Eneasroman untersucht werden sollen, im Gegensatz zu den privaten Bitten, für die Althoff keine festen Regeln beschreibt. Der Fokus liegt auf der Analyse der von Heinrich von Veldeke gewählten, oft abgewandelten und reduzierten Darstellung der öffentlichen Bitten und deren Kontext.
II. Hauptteil, 1. Das öffentliche Bitten im Eneasroman: Dieser Abschnitt analysiert verschiedene Beispiele für öffentliche Bitten im Eneasroman. Die einzelnen Unterabschnitte befassen sich jeweils mit einer spezifischen Bitte, beleuchten die beteiligten Akteure, den Kontext der Bitte, die verwendeten Strategien und die Folgen. Der Abschnitt untersucht, wie weit die dargestellten Bitten dem von Althoff beschriebenen idealtypischen Modell entsprechen, und welche Abweichungen existieren, unter Berücksichtigung der politischen und gesellschaftlichen Umstände. Die Analyse umfasst z.B. die Bitte um Aufnahme bei Dido, wo Eneas durch einen Fürsprecher seine Bitte vorträgt und Didos Hilfe erhält. Trotz der Abwesenheit eines körperlichen Unterwerfungsaktes, wird die Bitte erfolgreich vorgetragen und erfüllt. Die Analyse betont dabei den strategischen Einsatz des Bittens durch Eneas, um seine Mission zu sichern. Weitere Beispiele werden analog analysiert und in ihrer Bedeutung für die Handlung des Romans eingeordnet.
Schlüsselwörter
Symbolische Kommunikation, Mittelalter, Eneasroman, Heinrich von Veldeke, öffentliches Bitten, öffentliches Scherzen, öffentliche Unterwerfung, Althoff, Fürsprecher, Strategie, Politik, Gesellschaft, Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen zum mittelalterlichen Eneasroman von Heinrich von Veldeke
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die symbolische Kommunikation im mittelalterlichen Eneasroman von Heinrich von Veldeke, insbesondere die öffentlichen Formen des Bitten, Scherzens und der Unterwerfung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen Veldekes Darstellung und den von Althoff beschriebenen idealtypischen Formen dieser Kommunikationsakte.
Welche Formen der symbolischen Kommunikation werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei Formen öffentlicher symbolischer Kommunikation, wie sie von Althoff beschrieben werden: öffentliches Bitten, öffentliches Scherzen und öffentliche Unterwerfung. Private Bitten werden hingegen nicht betrachtet.
Wie wird die symbolische Kommunikation im Eneasroman analysiert?
Die Analyse erfolgt anhand verschiedener Beispiele aus dem Eneasroman. Für jede Form der Kommunikation werden spezifische Szenen untersucht, die beteiligten Akteure, der Kontext, die verwendeten Strategien und die Folgen der Kommunikation werden analysiert und mit den von Althoff definierten idealtypischen Formen verglichen.
Welche Beispiele für öffentliches Bitten werden im Detail untersucht?
Der Hauptteil der Arbeit analysiert verschiedene Bitten im Eneasroman, darunter die Bitte um Aufnahme bei Dido, die Bitte um Aufnahme bei Latinus, die Bitte des Turnus um Unterstützung und Rat, die Bitte des Aeneas um den freien Abzug seines Sohnes Ascanius und die Bitte des Turnus um sein Leben.
Wie werden Abweichungen von Althoffs idealtypischen Formen behandelt?
Die Arbeit legt besonderen Wert auf die Abweichungen zwischen Veldekes Darstellung und den von Althoff beschriebenen idealtypischen Formen öffentlicher Kommunikation. Diese Abweichungen werden im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Umstände des Mittelalters interpretiert.
Welche Rolle spielen politische und gesellschaftliche Faktoren?
Die Analyse berücksichtigt den Einfluss politischer und gesellschaftlicher Faktoren auf die symbolische Kommunikation im Eneasroman. Die Strategien der Akteure und die Folgen ihrer Kommunikation werden in diesem Kontext interpretiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Unterkapiteln zu öffentlichen Bitten, Scherzen und Unterwerfung) und eine Zusammenfassung/Schlussfolgerung. Der Hauptteil analysiert verschiedene Beispiele für öffentliche Bitten im Detail.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung symbolischer Kommunikation für das Verständnis des Mittelalters zu beleuchten und die spezifische Darstellung dieser Kommunikation im Eneasroman von Heinrich von Veldeke zu analysieren. Der Vergleich mit Althoffs Modell soll neue Erkenntnisse über die mittelalterliche Kommunikationskultur liefern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Symbolische Kommunikation, Mittelalter, Eneasroman, Heinrich von Veldeke, öffentliches Bitten, öffentliches Scherzen, öffentliche Unterwerfung, Althoff, Fürsprecher, Strategie, Politik, Gesellschaft, Literaturanalyse.
- Quote paper
- Nadja Gilch (Author), 2007, Die Bedeutung der symbolischen Kommunikation für das Verständnis des Mittelalters anhand des Eneasromans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112671