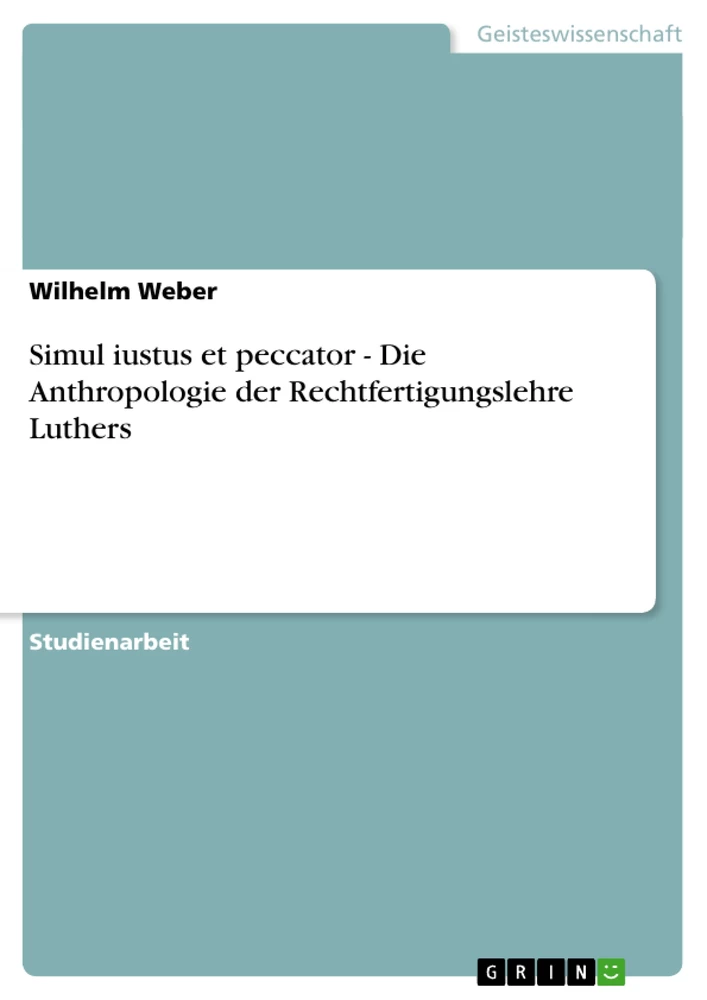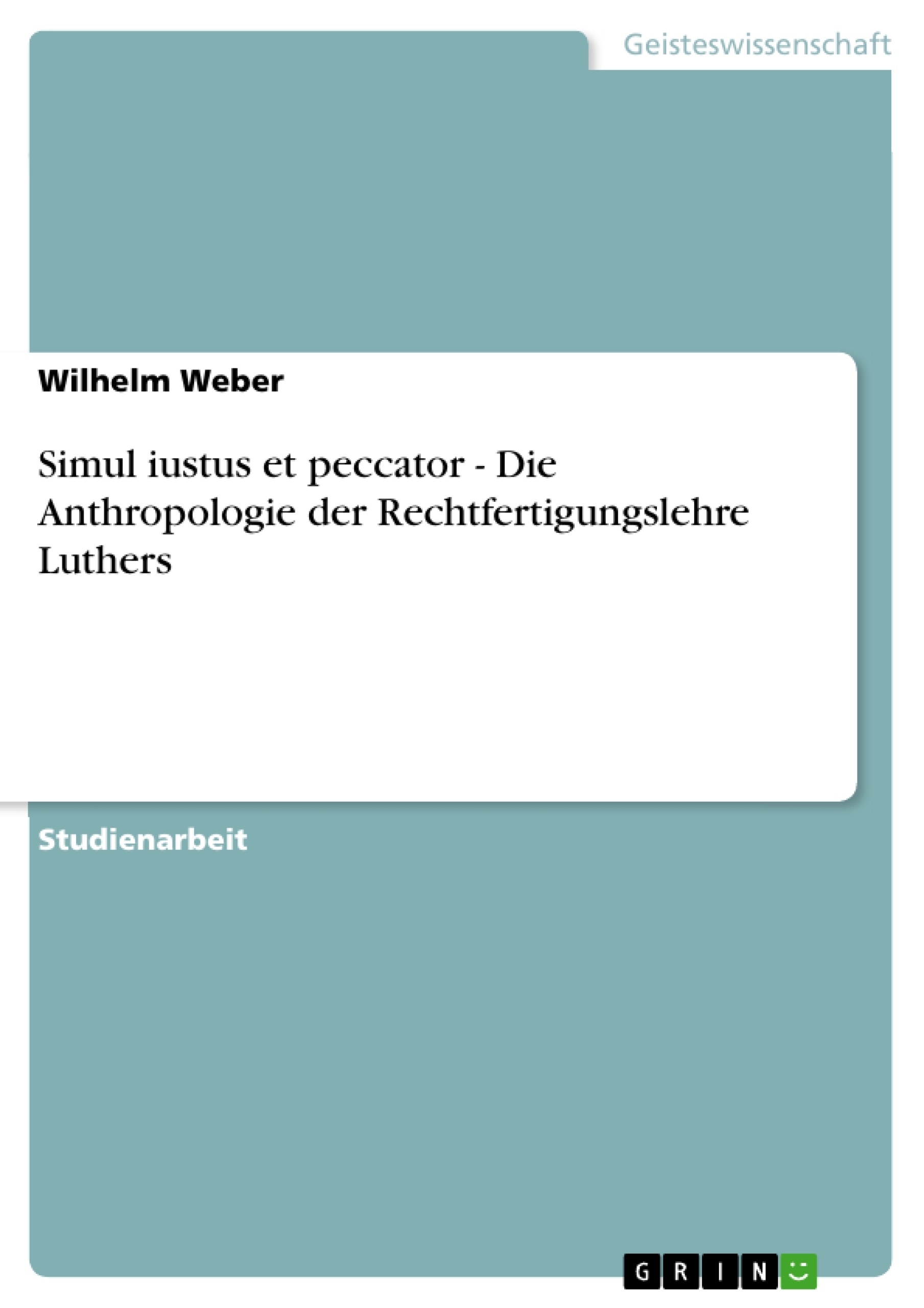In der vorliegenden Proseminararbeit wird die Rechtfertigungslehre Martin Luthers aus anthropologischer Sicht betrachtet. Die dazu analysierende These, was auch Kern der Lutherischen Rechtfertigung ist, ist folgende: “Simul iustus et peccator“. Dieser lateinische Satz drückt aus, dass der Mensch ein Gerechter und ein Sünder zugleich ist. Er bildet das Kernstück der lutherischen Freiheitsschrift, die davon handelt, dass der Mensch nicht durch seine Werke gerecht vor Gott wird, sondern durch seinen Glauben. Die Rechtfertigungslehre setzt sich damit auseinander, wie ein Mensch vor Gott gerecht werden kann und, wie das rechte Verhältnis zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt werden kann, welches durch die Sünde gestört ist. Diese Proseminararbeit hat sich nun zum Thema gemacht, welche Rolle der Mensch in der lutherischen Rechtfertigungslehre einnimmt und, inwiefern der Mensch unter der Macht der Sünde steht und, wie die Trennung des Menschen von Gott infolge der Sünde durchbrochen wird. Ein weiteres Anliegen der Proseminararbeit ist es, inwieweit sich die Anthropologie der lutherische Rechtfertigungslehre sich in der Rechtfertigungstheologie Pauli, in der Lehre des Pelagianismus’ sowie in der augustinischen Gnadenlehre widerspiegelt, weil diese Lehren als Vorläufer der Rechtfertigungstheologie Luthers gesehen werden können. Nicht unerheblich für die Proseminararbeit ist, welche aktuelle Bedeutung der Anthropologie von Luthers Rechtfertigungstheologie, was das Zentrum der persönlichen Stellungsnahme sein wird. Die Basis der Quellenbezüge bilden im Wesentlichen Luthers Werk “Von der Freiheit eines Christenmenschen“, der Römerbrief des Apostels Paulus sowie mit dazugehörigen Bibelkommentaren, ebenfalls Eberhard Jüngels Buch “Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens“, sowie Udo Hahns Buch über die Rechtfertigung in seinem Band “Grundbegriffe Christentum“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand der Proseminararbeit
- Methodisches Vorgehen
- Die Rechtfertigungslehre allgemein und ihre Formen
- Die Rechtfertigungslehre allgemein
- die augustinische Gnadenlehre
- Der Pelagianismus
- Die paulinische Rechtfertigungslehre
- Schlussfolgerungen zu den Rechtfertigungslehren vor Luther
- Die Lutherische Rechtfertigungslehre
- Biografischer Kontext
- Auslegung von Römer 1, 16-17
- Die Anthropologie in der Lutherischen Rechtfertigungslehre
- Der Mensch als Sünder
- Persönliche Stellungsnahme
- Die Lutherische Rechtfertigungslehre im Spiegel der heutigen Zeit
- Fazit
- Literaturrecherche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Proseminararbeit befasst sich mit der anthropologischen Perspektive der Rechtfertigungslehre Martin Luthers, insbesondere mit der These "Simul iustus et peccator". Ziel ist es, die Rolle des Menschen in Luthers Rechtfertigungslehre zu untersuchen, seine Sündhaftigkeit und die Überwindung der Trennung von Gott durch die Sünde zu beleuchten. Die Arbeit analysiert, inwieweit die Anthropologie der lutherischen Rechtfertigungslehre in anderen Rechtfertigungstheologien, wie der paulinischen, der augustinischen und der pelagianischen, ihre Wurzeln findet.
- Die Rolle des Menschen in der lutherischen Rechtfertigungslehre
- Die Sündhaftigkeit des Menschen
- Die Überwindung der Trennung von Gott durch die Sünde
- Die anthropologischen Wurzeln der lutherischen Rechtfertigungslehre
- Die Bedeutung der lutherischen Rechtfertigungslehre für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Gegenstand der Proseminararbeit vor, die sich mit der anthropologischen Perspektive der Rechtfertigungslehre Martin Luthers befasst. Sie erläutert das methodische Vorgehen, das die Analyse der These "Simul iustus et peccator" im Kontext verschiedener Rechtfertigungslehren beinhaltet.
Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über die Rechtfertigungslehre allgemein und ihre verschiedenen Formen. Es beleuchtet die augustinische Gnadenlehre, den Pelagianismus und die paulinische Rechtfertigungslehre, die als Vorläufer der lutherischen Rechtfertigungslehre betrachtet werden können.
Das dritte Kapitel widmet sich der lutherischen Rechtfertigungslehre und analysiert die These "Simul iustus et peccator". Es untersucht den biografischen Kontext Luthers, seine Auslegung von Römer 1, 16-17 und die Anthropologie in seiner Rechtfertigungslehre.
Das vierte Kapitel beinhaltet eine persönliche Stellungnahme des Verfassers, die die Bedeutung der lutherischen Rechtfertigungslehre für die heutige Zeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rechtfertigungslehre, die Anthropologie, Martin Luther, "Simul iustus et peccator", die Sündhaftigkeit des Menschen, die Erbsünde, die Gnade Gottes, die Rechtfertigung durch den Glauben, die paulinische Rechtfertigungslehre, die augustinische Gnadenlehre, der Pelagianismus, die Bedeutung der lutherischen Rechtfertigungslehre für die heutige Zeit.
- Quote paper
- Wilhelm Weber (Author), 2008, Simul iustus et peccator - Die Anthropologie der Rechtfertigungslehre Luthers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112675