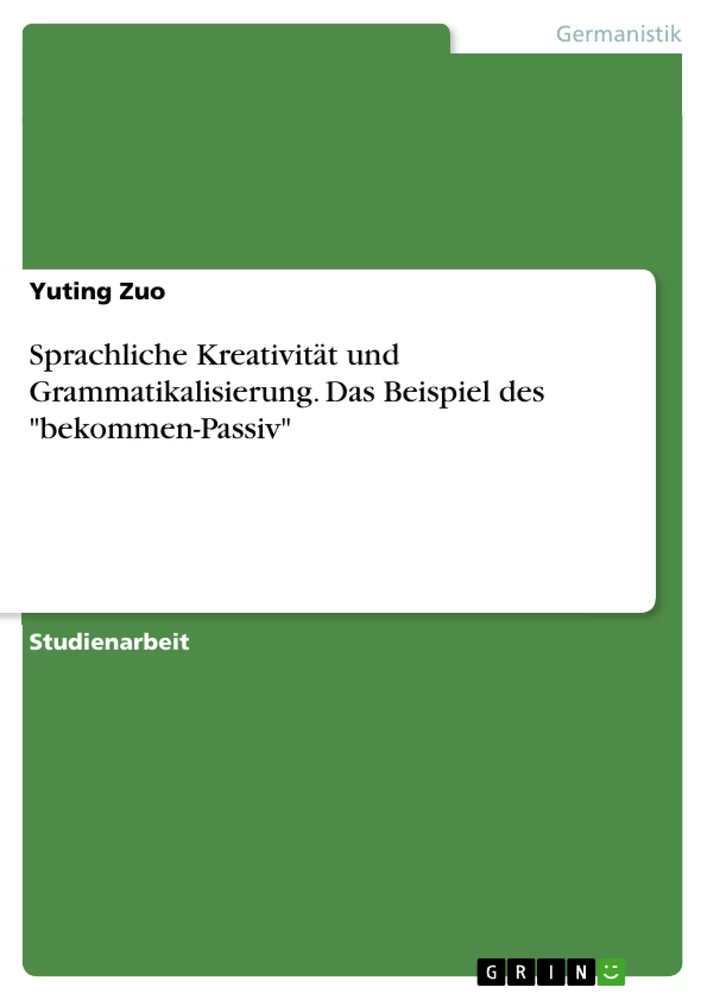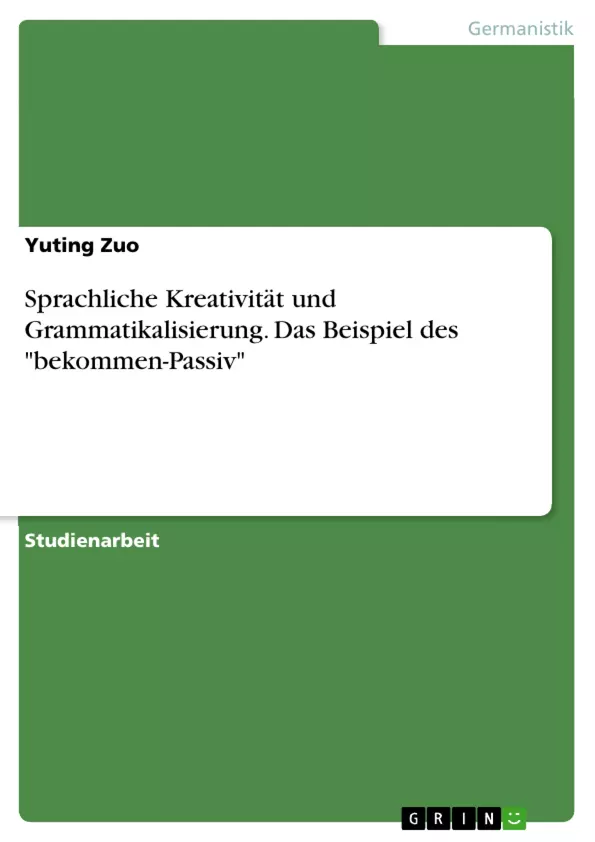Der Sprachwandel ist nichts anderes als die ständige historische Objektivierung des schöpferischen Charakters der Sprache, in dem eine Reihe von Grammatikalisierungs- und Lexiklalisierungsprozessen stattfinden. In dieser Arbeit möchte ich mich mit dem Zusammenhang der sprachlichen Kreativität und Grammatikalisierung als einen entscheidenden Prozess des Sprachwandels beschäftigen.
Zunächst fange ich mit der Fragestellung an, was mit sprachlicher Kreativität gemeint ist, indem die Chomskys rule-goverend und rule-changing creativity eingeführt wird. Darüber hinaus versuche ich, den Begriff der sprachlichen Kreativität in de Saussure zu verorten. Im zweiten Teil werden die grundsätzlichen Begrifflichkeiten der Grammatikalisierung thematisiert. Dabei werde ich den Fokus auf zwei wichtigen Mechanismen – Reanalyse und Analogie – legen, die mittels des Beispiels ,,bekommen-Passiv‘‘ deutlicher dargestellt werden. Im dritten Teil versuche ich die Grammatikalisierung in Zusammenhang mit sprachlicher Kreativität zu stellen und zu beantworten, inwiefern ein Grammatikalisierungsprozess wie ,,bekommen-Passiv‘‘ sich mit der sprachlichen Kreativität verhält.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachliche Kreativität in der Sprachtheorie
- Chomskys regelgeleitete vs. regelveränderte Kreativität
- Die Kreativität in Saussure
- Konzepte in der Grammatikalisierungsforschung
- Reanalyse und Analogie als Grammatikalisierungsmechanismen
- Das Beispiel „bekommen-Passiv“
- Zusammenhang zwischen sprachlicher Kreativität und Grammatikalisierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen sprachlicher Kreativität und Grammatikalisierung, wobei der Fokus auf dem „bekommen-Passiv“ als ein Beispiel für einen Grammatikalisierungsprozess liegt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die verschiedenen Ansätze zur sprachlichen Kreativität in der Sprachtheorie zu beleuchten, insbesondere Chomskys Regelgeleitete vs. Regelveränderte Kreativität, sowie die Kreativität im Sinne von Saussure. Darüber hinaus werden die zentralen Konzepte der Grammatikalisierungsforschung, wie Reanalyse und Analogie, im Detail erläutert und am Beispiel des „bekommen-Passiv“ veranschaulicht. Schließlich wird der Zusammenhang zwischen sprachlicher Kreativität und Grammatikalisierung untersucht, um zu zeigen, inwiefern ein Grammatikalisierungsprozess wie „bekommen-Passiv“ mit der sprachlichen Kreativität in Verbindung steht.
- Sprachliche Kreativität in der Sprachtheorie
- Chomskys Regelgeleitete vs. Regelveränderte Kreativität
- Grammatikalisierungsforschung: Reanalyse und Analogie
- Das „bekommen-Passiv“ als Beispiel für Grammatikalisierung
- Zusammenhang zwischen sprachlicher Kreativität und Grammatikalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff der sprachlichen Kreativität in verschiedenen Kontexten vor und beleuchtet die Bedeutung der Kreativität im Sprachgebrauch. Sie führt die Arbeit ein und beschreibt die Struktur sowie den Fokus der Untersuchung.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der sprachlichen Kreativität in der Sprachtheorie. Es behandelt Chomskys Ansätze zur „regelgeleiteten“ und „regelveränderten“ Kreativität und verortet den Begriff der sprachlichen Kreativität im Werk von Ferdinand de Saussure.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Konzepte der Grammatikalisierungsforschung. Es erklärt die beiden wichtigen Mechanismen der Reanalyse und Analogie, die als Grammatikalisierungsmechanismen gelten, und veranschaulicht diese am Beispiel des „bekommen-Passiv“.
Schlüsselwörter
Sprachliche Kreativität, Grammatikalisierung, Regelgeleitete Kreativität, Regelveränderte Kreativität, Reanalyse, Analogie, „bekommen-Passiv“, Sprachwandel, Sprachsystem.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Gegenstand dieser sprachwissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sprachlicher Kreativität und dem Prozess der Grammatikalisierung am konkreten Beispiel des "bekommen-Passivs" im Deutschen.
Welche Arten der Kreativität unterscheidet Noam Chomsky?
Es wird zwischen der "rule-governed creativity" (regelgeleitete Kreativität innerhalb bestehender Regeln) und der "rule-changing creativity" (regelverändernde Kreativität, die zu Sprachwandel führt) unterschieden.
Was versteht man unter Reanalyse und Analogie in der Grammatikalisierung?
Reanalyse ist eine Änderung der zugrunde liegenden Struktur eines Ausdrucks ohne Änderung der Oberfläche. Analogie ist die Übertragung eines Musters auf neue Kontexte. Beides sind Hauptmechanismen des Sprachwandels.
Warum wird das "bekommen-Passiv" als Beispiel herangezogen?
Das "bekommen-Passiv" (z.B. "Er bekommt das Buch geschenkt") illustriert den Übergang eines Vollverbs (bekommen) zu einem grammatischen Hilfsverb, was ein klassischer Grammatikalisierungsprozess ist.
Wie hängen Kreativität und Sprachwandel zusammen?
Sprachwandel wird als historische Objektivierung des schöpferischen Charakters der Sprache gesehen, wobei kreative Abweichungen im Gebrauch über Zeit zu neuen festen Grammatikregeln werden können.
- Quote paper
- Yuting Zuo (Author), 2021, Sprachliche Kreativität und Grammatikalisierung. Das Beispiel des "bekommen-Passiv", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1126862