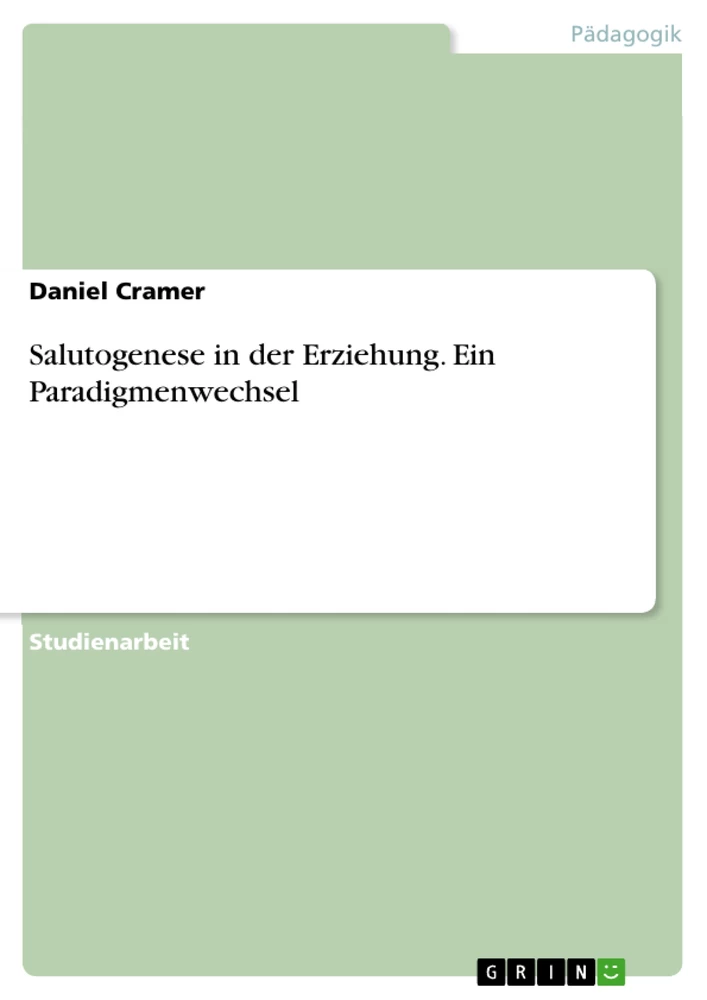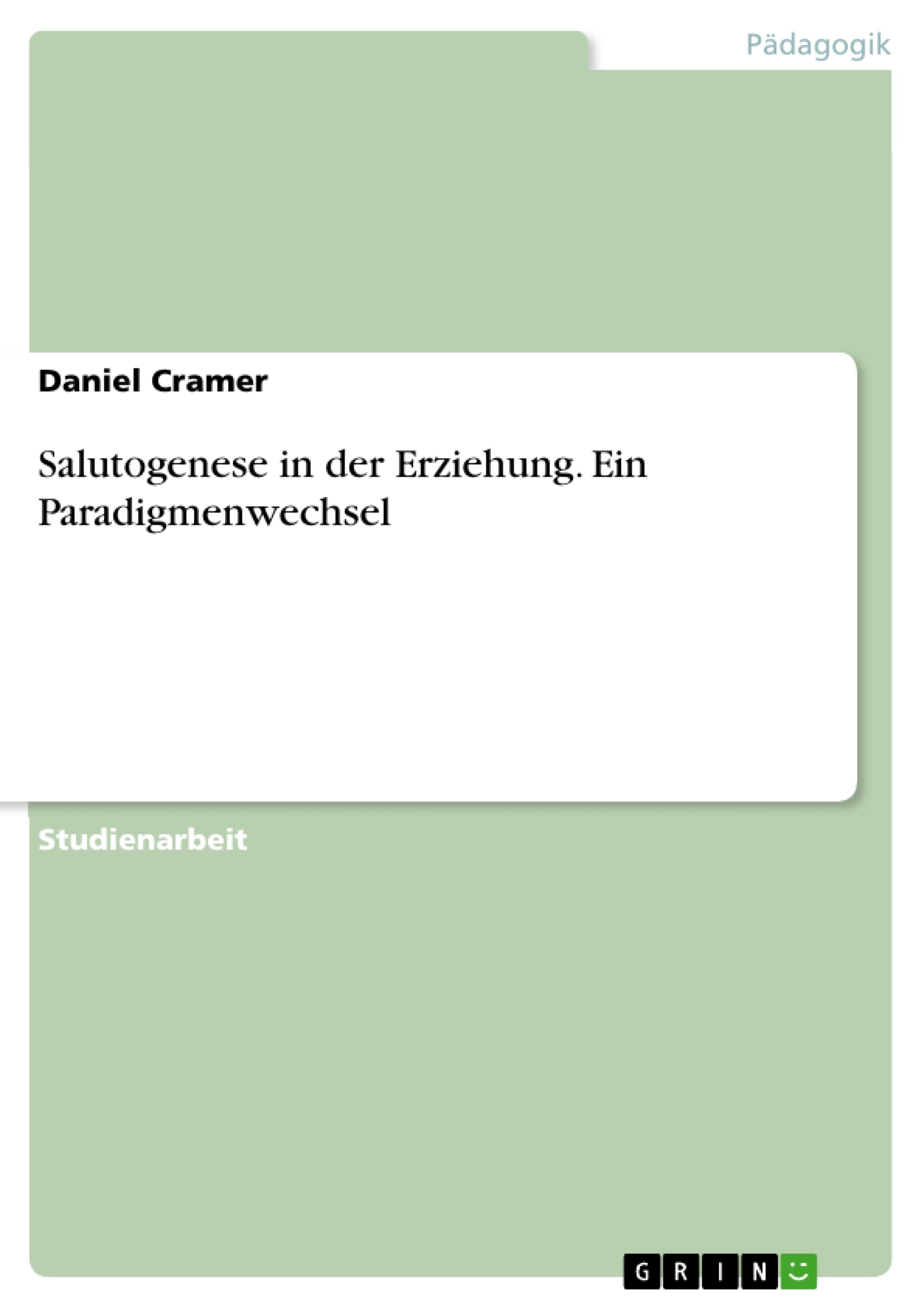Diese Arbeit stellt sich der Frage, ob das gesundheitliche Konzept und die dahinterstehende Fragestellung der Salutogenese auch eine berechtigte Anwendung in der Erziehung hätte. Um dies zu beantworten, wird zunächst das Konzept der Salutogenese mit seinen einzelnen Komponenten kurz vorgestellt. Darauffolgend werden Definitionen von Erziehung dargestellt und deren grundlegenden Gemeinsamkeiten für diese Arbeit vorgestellt. Anschließend wird versucht, das Konzept der Salutogenese auf die Erziehung anzuwenden und im Fazit wird Resümee gezogen, ob die Anwendung des Konzepts der Salutogenese auch in der Erziehung sinnvoll ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Konzept der Salutogenese
- 2.1. Die Fragestellung der Salutogenese
- 2.2. Gesundheits- und Risikofaktoren
- 2.3. Das Kohärenzgefühl und dessen Komponenten
- 3. Einige Definitionen der Erziehung
- 3.1. Grundlegende Ziele von Erziehung
- 3.2. Die Angsterziehung und Helikopter-Eltern
- 4. Salutogenese in der Erziehung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des salutogenetischen Konzepts auf den Bereich der Erziehung. Ziel ist es, zu klären, ob und wie die salutogenetische Perspektive einen Beitrag zu einem gesunden Erziehungsverständnis leisten kann. Die Arbeit analysiert die Prinzipien der Salutogenese und setzt sie in Beziehung zu gängigen Erziehungsansätzen.
- Das salutogenetische Konzept und seine zentralen Elemente (Kohärenzgefühl, Ressourcenorientierung).
- Definitionen und Ziele von Erziehung im Kontext der Arbeit.
- Die Anwendung der Salutogenese in der Erziehungspraxis.
- Vergleich salutogener und pathogener Erziehungsansätze.
- Bewertung der Sinnhaftigkeit eines salutogenetischen Ansatzes in der Erziehung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Anwendbarkeit des salutogenetischen Konzepts auf die Erziehung. Sie führt in die Thematik ein, indem sie den Gegensatz zwischen dem Vermeiden von Leid und dem Umgang mit Leid beleuchtet und die beiden Herangehensweisen einander gegenüberstellt. Die Arbeit strukturiert sich in die Vorstellung der Salutogenese (Kapitel 2), Definitionen der Erziehung (Kapitel 3), die Anwendung der Salutogenese in der Erziehung (Kapitel 4) und das Fazit (Kapitel 5).
2. Das Konzept der Salutogenese: Dieses Kapitel erläutert das salutogenetische Konzept von Aaron Antonovsky. Im Fokus steht das Verständnis von Gesundheit als Prozess der Gesundheitsentstehung ("Salutogenese"), im Gegensatz zum krankheitsorientierten Ansatz der Pathogenese. Die zentrale Frage der Salutogenese lautet: "Was erhält Menschen gesund?". Das Kapitel beschreibt das Kohärenzgefühl als zentralen Bestandteil des salutogenetischen Modells und beleuchtet die Unterscheidung zwischen generalisierten Widerstandressourcen (Gesundheitsfaktoren) und generalisierten Widerstandsdefiziten (Risikofaktoren). Es wird auf das Gesundheitskontinuum eingegangen und die Metapher des Flusses als bildhafte Darstellung des Konzepts verwendet.
Schlüsselwörter
Salutogenese, Pathogenese, Kohärenzgefühl, Erziehung, Gesundheitsförderung, Risikofaktoren, Widerstandressourcen, Prävention, Wohlbefinden, Gesundheitskontinuum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Salutogenese in der Erziehung
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht die Anwendbarkeit des salutogenetischen Konzepts auf den Bereich der Erziehung. Das zentrale Thema ist die Frage, ob und wie die salutogenetische Perspektive zu einem gesunden Erziehungsverständnis beitragen kann. Es wird ein Vergleich zwischen salutogenen und pathogenen Erziehungsansätzen vorgenommen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt das salutogenetische Konzept von Aaron Antonovsky, insbesondere das Kohärenzgefühl und seine Komponenten. Es werden verschiedene Definitionen von Erziehung beleuchtet und die Ziele von Erziehung im Kontext der Salutogenese diskutiert. Die Anwendung der Salutogenese in der Erziehungspraxis sowie ein Vergleich mit pathologischen Erziehungsansätzen werden ebenfalls thematisiert.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung des Textes besteht darin, die Anwendbarkeit des salutogenetischen Konzepts auf die Erziehung zu klären. Es soll untersucht werden, wie die salutogenetische Perspektive zu einem besseren Verständnis von Erziehung und zur Förderung von Gesundheit im Erziehungsbereich beitragen kann.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das Konzept der Salutogenese, Einige Definitionen der Erziehung, Salutogenese in der Erziehung und Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau des Textes vor. Kapitel 2 erläutert die Salutogenese nach Antonovsky. Kapitel 3 definiert Erziehung. Kapitel 4 untersucht die Anwendung der Salutogenese in der Erziehung und Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist das Kohärenzgefühl und seine Bedeutung im Kontext des Textes?
Das Kohärenzgefühl ist ein zentraler Bestandteil des salutogenetischen Modells. Es beschreibt das Gefühl von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit des Lebens. Im Kontext des Textes wird untersucht, wie ein starkes Kohärenzgefühl bei Kindern und Jugendlichen durch erzieherische Maßnahmen gefördert werden kann.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Salutogenese, Pathogenese, Kohärenzgefühl, Erziehung, Gesundheitsförderung, Risikofaktoren, Widerstandressourcen, Prävention und Wohlbefinden.
Wie wird der salutogenetische Ansatz in der Erziehung beschrieben?
Der salutogenetische Ansatz in der Erziehung konzentriert sich auf die Stärkung von Ressourcen und die Förderung des Kohärenzgefühls bei Kindern und Jugendlichen. Im Gegensatz zu einem pathogenetischen Ansatz, der sich auf die Vermeidung von Problemen konzentriert, liegt der Fokus auf der Entwicklung von Fähigkeiten und der Stärkung der persönlichen Widerstandsfähigkeit.
Wie unterscheidet sich der Text von anderen Arbeiten zum Thema Erziehung?
Der Text zeichnet sich durch seinen Fokus auf die salutogenetische Perspektive aus. Im Gegensatz zu vielen anderen Arbeiten zum Thema Erziehung, die sich auf pathogene Aspekte konzentrieren, legt dieser Text den Schwerpunkt auf die Stärkung von Ressourcen und die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden.
- Citar trabajo
- Daniel Cramer (Autor), 2020, Salutogenese in der Erziehung. Ein Paradigmenwechsel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1126868