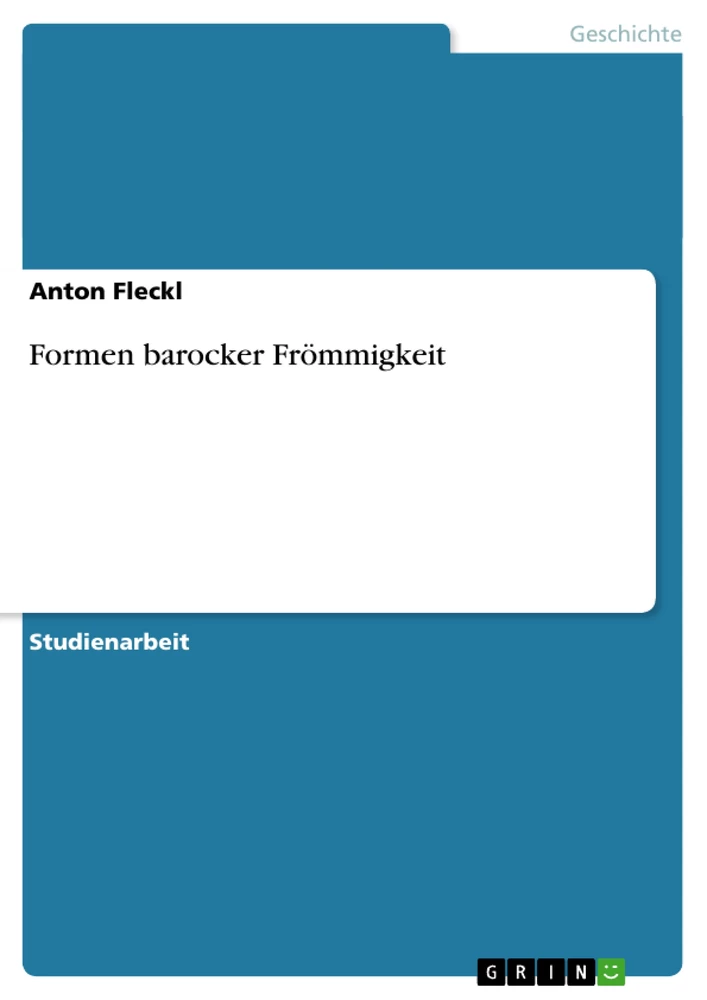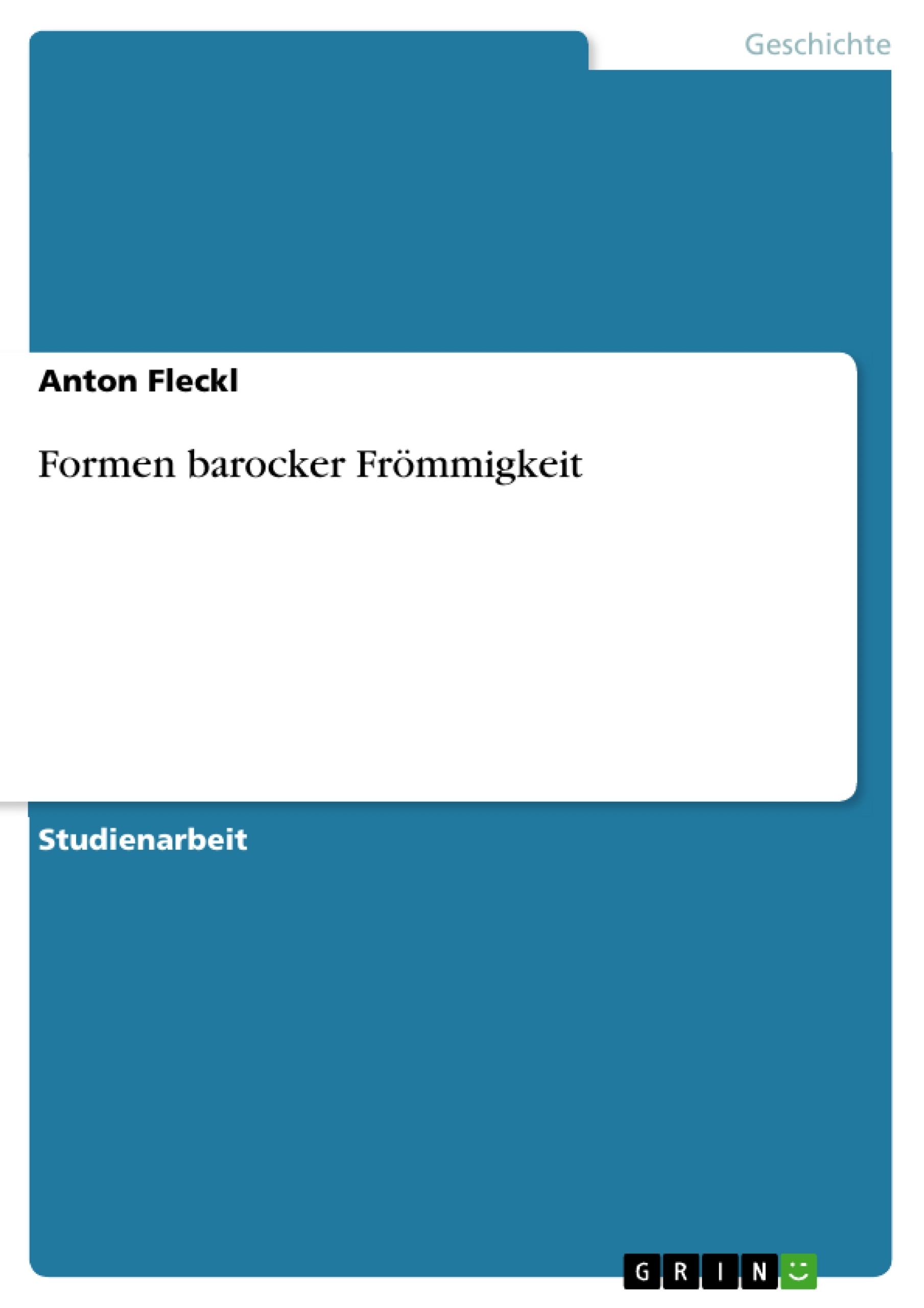Die vorliegende Arbeit trägt den Titel Barocke Frömmigkeit. Durch den Titel ist die zeitliche Begrenzung dieses Seminarthemas vorgegeben, also das späte 16. Jahrhundert bis einschließlich der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Räumlich habe ich das Thema auf das Gebiet des heutigen Österreich eingeschränkt. Dies ergibt sich auch aus den Standorten der beschriebenen Kunst- und Bauwerke die auch als Quellen dienen, und die sich auf dem Gebiet des gegenwärtigen Österreich befinden. Am Beginn der Arbeit versuche ich die Begriffe Frömmigkeit, Volksfömmigkeit und Barock zu definieren. Im ersten Kapitel gehe ich der Frage nach, ob Volksfrömmigkeit in der Barockzeit auch ein Mittel zur Sozialdisziplinierung darstellte. Dazu gehört auch das Verhältnis zwischen Volkskultur und Elitenkultur. Das zweite Kapitel soll klären ob und wie Barocke Kunst gezielt als Propagandamittel der Gegenreformation eingesetzt werden konnte.
Als Beispiele und Quellen dienen hier die Wiener Universitätskirche (Jesuitenkirche), die Bergkirche in Eisenstadt sowie die Kalvarienberganlage in St. Radegund bei Graz. Auf den in der Barockzeit so bedeutenden Aspekt der Marianischen Frömmigkeit wird in dieser Arbeit ebenfalls eingegangen.
Der Begriff der Frömmigkeit bezeichnet das religiöse Verhalten eines Menschen, seine Gesinnung und sein Handeln in der Beziehung zu Gott. Der fromme Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass sein Denken und Tun den religiösen Vorschriften entsprechen. Wenn dies nur vorgetäuscht wird, um den Eindruck der Frömmigkeit zu erreichen, spricht man von Frömmelei, Bigotterie und Scheinheiligkeit.
Das Wort fromm leitet sich vom althochdeutschen fruma her, was soviel bedeutet wie Nutzen oder Vorteil, und wurde zu mittelhochdeutsch frum. Frum bedeutet voranstehend, bevorzugt, aber auch förderlich und tüchtig . Diese Bedeutung hielt sich bis ins 16. Jahrhundert. Noch Martin Luther benutzte es in diesem Sinne. Luther benutzte das Wort „gottseelig“, wenn er das heute gebräuchliche fromm meinte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Frömmigkeit
- Volksfrömmigkeit
- Barock
- Volksfrömmigkeit als Mittel der Sozialdisziplinierung
- Religiöse Volkskultur versus Elitekultur
- Mariannische Frömmigkeit
- Lorettokapelle
- Kalvarienberg
- St. Radegund bei Graz
- Kalvarienbergkirche Eisenstadt
- Barocke Kunst als Mittel der Propaganda
- Der barocke Farbraum als Propagandamittel der Gegenreformation am Beispiel der Wiener Universitätskirche
- Schlussbemerkung
- Abbildungen
- Abbildungsnachweis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der barocken Frömmigkeit im heutigen Österreich und untersucht, wie sich diese in Kunst, Architektur und Volkskultur manifestiert hat. Die Arbeit analysiert die Rolle der Volksfrömmigkeit als Mittel der Sozialdisziplinierung und beleuchtet das Verhältnis zwischen Volkskultur und Elitenkultur im Kontext der Gegenreformation.
- Definition und Analyse der Begriffe Frömmigkeit, Volksfrömmigkeit und Barock
- Untersuchung der Rolle der Volksfrömmigkeit als Mittel der Sozialdisziplinierung
- Analyse des Verhältnisses zwischen Volkskultur und Elitenkultur im Kontext der Gegenreformation
- Bedeutung der Marianischen Frömmigkeit im Barock
- Einsatz barocker Kunst als Propagandamittel der Gegenreformation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zeitliche und räumliche Begrenzung des Themas vor und erläutert die Forschungsfrage. Sie definiert die zentralen Begriffe Frömmigkeit, Volksfrömmigkeit und Barock.
Das Kapitel über Volksfrömmigkeit als Mittel der Sozialdisziplinierung untersucht, wie die katholische Kirche durch die Förderung von Volksfrömmigkeit die soziale Ordnung stabilisieren und die Bevölkerung kontrollieren konnte.
Das Kapitel über religiöse Volkskultur versus Elitekultur analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der religiösen Praxis der einfachen Bevölkerung und der Kleriker.
Das Kapitel über die Marianische Frömmigkeit beleuchtet die besondere Bedeutung der Marienverehrung im Barock und untersucht die Rolle von Kapellen und Wallfahrtsorten wie der Lorettokapelle.
Das Kapitel über den Kalvarienberg analysiert die Bedeutung von Kalvarienbergkirchen als Orte der Andacht und der Buße. Es untersucht die Kalvarienberganlage in St. Radegund bei Graz und die Kalvarienbergkirche in Eisenstadt.
Das Kapitel über barocke Kunst als Mittel der Propaganda untersucht, wie die katholische Kirche die Kunst als Mittel der Gegenreformation einsetzte, um die Bevölkerung zu beeinflussen. Es analysiert den Einsatz des barocken Farbraums als Propagandamittel am Beispiel der Wiener Universitätskirche.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die barocke Frömmigkeit, die Volksfrömmigkeit, die Gegenreformation, die Marienverehrung, die Kunst als Propagandamittel, die Wiener Universitätskirche, die Kalvarienbergkirche Eisenstadt und die Kalvarienberganlage in St. Radegund bei Graz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Frömmigkeit“ im barocken Kontext?
Frömmigkeit bezeichnet das religiöse Verhalten, die Gesinnung und das Handeln eines Menschen in Beziehung zu Gott, wobei das Tun den religiösen Vorschriften entsprechen muss.
Inwiefern diente Volksfrömmigkeit der Sozialdisziplinierung?
Die katholische Kirche nutzte die Förderung religiöser Praktiken, um die soziale Ordnung zu stabilisieren und das Verhalten der Bevölkerung im Sinne der Gegenreformation zu kontrollieren.
Welche Rolle spielte die Marienverehrung (Marianische Frömmigkeit)?
Sie war ein zentraler Aspekt des Barocks, was sich in der Errichtung zahlreicher Lorettokapellen und Wallfahrtsorte manifestierte, um die Bindung der Gläubigen an die Kirche zu stärken.
Wie wurde barocke Kunst als Propaganda eingesetzt?
Durch prachtvolle Architektur und den gezielten Einsatz von Farben (z. B. in der Wiener Jesuitenkirche) sollten die Gläubigen beeindruckt und von der Macht und Wahrheit des katholischen Glaubens überzeugt werden.
Was ist die Bedeutung von Kalvarienbergen in dieser Zeit?
Kalvarienberganlagen (wie in St. Radegund oder Eisenstadt) dienten als Orte der öffentlichen Andacht, der Buße und der Visualisierung des Leidens Christi für das einfache Volk.
- Citar trabajo
- Anton Fleckl (Autor), 2008, Formen barocker Frömmigkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112697