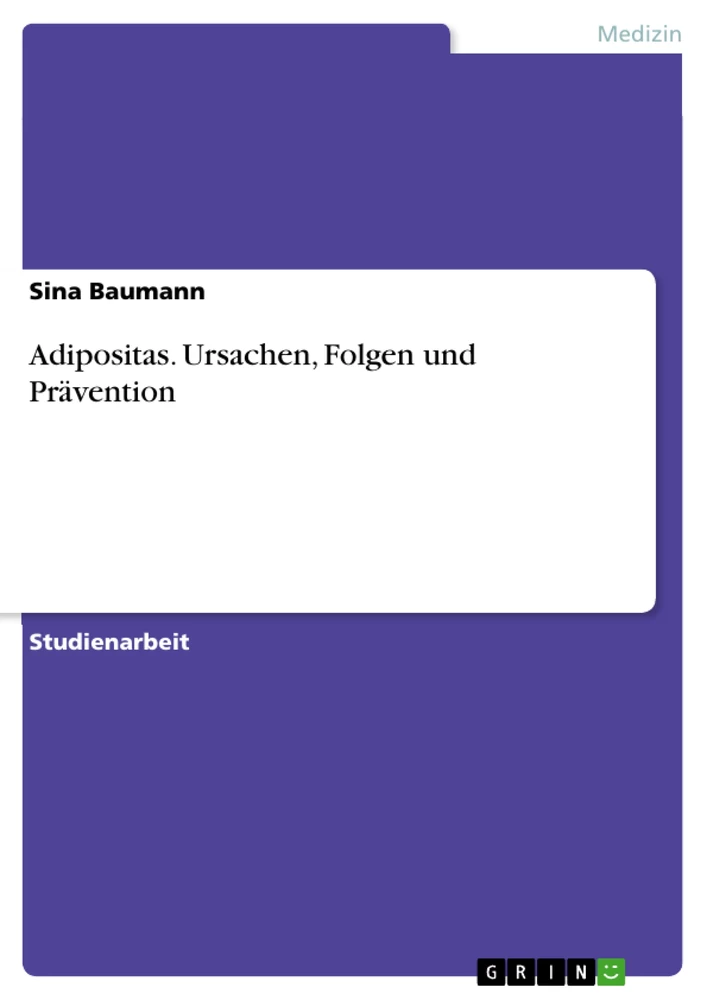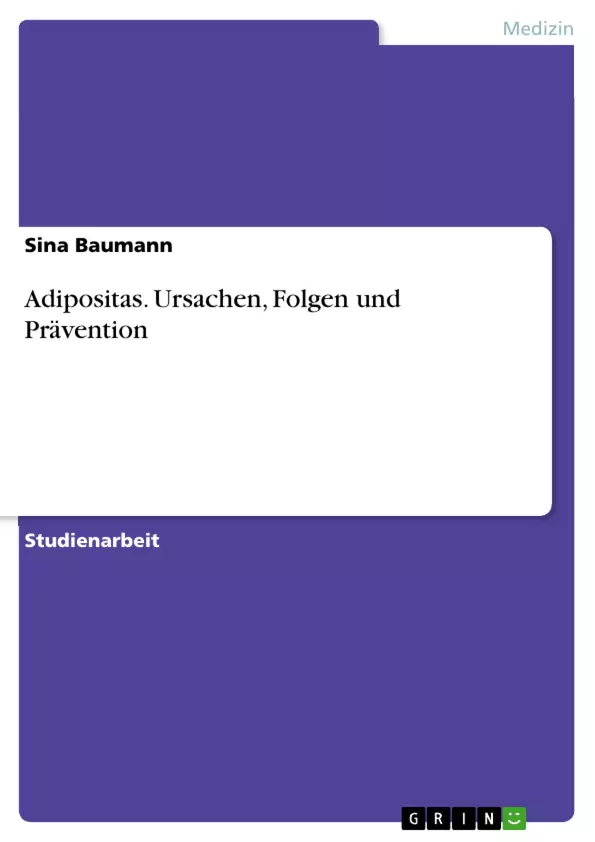Adipositas ist derzeit ein sehr aktuelles Thema im Gesundheitssektor. Lebensbedrohliche Krankheiten und andere Folgen von Adipositas sind schwerwiegend. Daher gilt es, Übergewicht und Adipositas entgegenzuwirken. Laut der KiGGs-Studie hat sich die Anzahl von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren seit den 1980er und 1990er Jahren verdoppelt.
Diese Arbeit begrenzt sich auf Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahre, da die Jugendlichen in diesem Zeitpunkt am besten verstehen, dass Übergewicht das Risiko für Folgen erhöht. Übergewicht und Adipositas haben viele Ursachen, die im Verlauf dieser Arbeit ausgeführt werden. Zunächst werden die genetischen Faktoren beleuchtet. Die Genetik macht einen eher kleineren Grund für Übergewicht aus. Jedoch können Fehlangewohnheiten und Fehlverhalten der Eltern das Risiko für Übergewicht der Jugendlichen erhöhen. Oftmals beginnt dies schon in den jungen Jahren. Hauptursache von Übergewicht ist der soziale Status, durch den das grundlegende Gesundheitsverhalten oftmals nicht richtig von den Eltern gezeigt wird. Dabei spielt die Bildung, das soziale Umfeld und der Lebensstil eine Rolle, in der das Kind hineingeboren wird.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Definition und Epidemiologie
- III. Ursachen und Folgen
- III.I Genetische Faktoren von Übergewicht
- III.II Soziokulturelle Faktoren und Migrationshintergrund
- III.III Psychosoziale Faktoren von Übergewicht
- III.IV Folgen und Folgeerkrankungen
- IV. Präventionsmaßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Problem von Übergewicht und Adipositas bei Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren in Deutschland. Ziel ist es, die Ursachen und Folgen von Übergewicht zu beleuchten und mögliche Präventionsmaßnahmen zu diskutieren.
- Definition und Epidemiologie von Übergewicht und Adipositas
- Genetische, soziokulturelle und psychosoziale Faktoren als Ursachen von Übergewicht
- Gesundheitliche Folgen und Folgeerkrankungen von Übergewicht und Adipositas
- Mögliche Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Übergewicht
- Entwicklung der Übergewichts- und Adipositasraten in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Die Einleitung stellt Adipositas als ein dringliches Gesundheitsproblem dar und verweist auf die Verdoppelung übergewichtiger und adipöser Kinder und Jugendlicher seit den 1980er und 90er Jahren, basierend auf der KiGGs-Studie. Die Arbeit konzentriert sich auf Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren, da diese Altersgruppe ein besseres Verständnis für die Risiken von Übergewicht hat. Die Einleitung skizziert die verschiedenen Ursachen von Übergewicht (genetische, soziokulturelle, psychosoziale Faktoren), die im weiteren Verlauf der Arbeit detaillierter behandelt werden, und betont die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen.
II. Definition und Epidemiologie: Dieses Kapitel differenziert zwischen Übergewicht und Adipositas, wobei Übergewicht eine leichte Erhöhung des Körpergewichts im Verhältnis zur Körpergröße beschreibt, während Adipositas eine übermäßige Vermehrung der Körperfettmasse darstellt. Der Body Mass Index (BMI) wird als Messinstrument zur Definition beider Zustände erläutert, inklusive seiner Geschichte und der Problematik seiner Anwendung, besonders bei Kindern und Jugendlichen, wo Alters- und geschlechtsspezifische Perzentilen berücksichtigt werden müssen. Das Kapitel beleuchtet die epidemiologischen Ausmaße von Adipositas als ein globales Problem, das in Industrieländern wie Deutschland stark ausgeprägt ist, und präsentiert Daten zur Verbreitung von Übergewicht und Adipositas in Deutschland basierend auf der KiGGs-Studie, inklusive einer Analyse der Entwicklung über die Zeit und regionaler Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Übergewicht und Adipositas bei Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das Thema Übergewicht und Adipositas bei Jugendlichen (13-18 Jahre) in Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und wichtige Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf den Ursachen (genetisch, soziokulturell, psychosozial), Folgen und Präventionsmaßnahmen von Übergewicht.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: I. Einführung, II. Definition und Epidemiologie, III. Ursachen und Folgen (mit Unterkapiteln zu genetischen, soziokulturellen, psychosozialen Faktoren und Folgeerkrankungen) und IV. Präventionsmaßnahmen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen von Übergewicht und Adipositas bei Jugendlichen in Deutschland (13-18 Jahre) und diskutiert mögliche Präventionsmaßnahmen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse genetischer, soziokultureller und psychosozialer Einflussfaktoren.
Wie werden Übergewicht und Adipositas definiert?
Das Dokument differenziert zwischen Übergewicht (leichte Erhöhung des Körpergewichts im Verhältnis zur Körpergröße) und Adipositas (übermäßige Vermehrung der Körperfettmasse). Der Body Mass Index (BMI) wird als Messinstrument erläutert, wobei die Problematik seiner Anwendung bei Jugendlichen (Alters- und geschlechtsspezifische Perzentilen) hervorgehoben wird.
Welche epidemiologischen Daten werden präsentiert?
Das Dokument präsentiert Daten zur Verbreitung von Übergewicht und Adipositas in Deutschland, basierend auf der KiGGs-Studie. Es werden die Entwicklung über die Zeit und regionale Unterschiede analysiert, wobei Adipositas als globales Problem mit starker Ausprägung in Industrieländern dargestellt wird.
Welche Ursachen für Übergewicht werden behandelt?
Die Arbeit untersucht genetische, soziokulturelle und psychosoziale Faktoren als Ursachen von Übergewicht. Die einzelnen Faktoren werden in separaten Unterkapiteln detailliert behandelt.
Welche Folgen und Folgeerkrankungen von Übergewicht werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt die gesundheitlichen Folgen und Folgeerkrankungen von Übergewicht und Adipositas bei Jugendlichen. Diese werden im Kapitel "Ursachen und Folgen" detailliert erläutert.
Welche Präventionsmaßnahmen werden diskutiert?
Das Dokument diskutiert mögliche Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Übergewicht bei Jugendlichen. Diese werden im Kapitel "Präventionsmaßnahmen" behandelt.
Welche Datenquelle wird hauptsächlich verwendet?
Die KiGGs-Studie dient als Hauptdatenquelle für die epidemiologischen Daten zur Verbreitung von Übergewicht und Adipositas in Deutschland.
Welche Altersgruppe steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren.
- Arbeit zitieren
- Sina Baumann (Autor:in), 2020, Adipositas. Ursachen, Folgen und Prävention, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127150