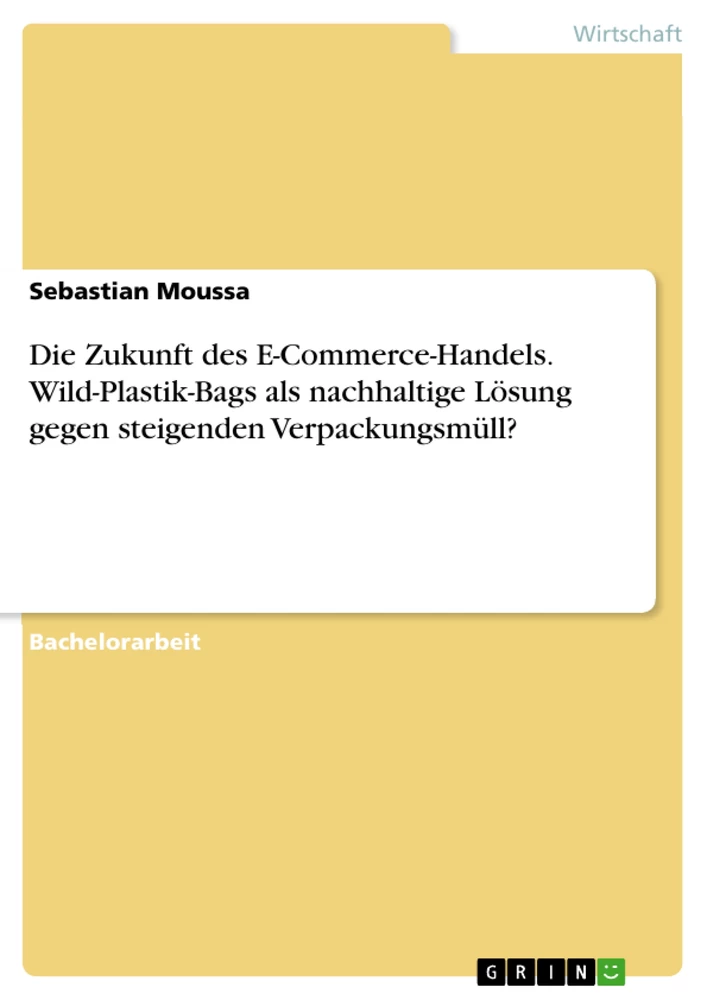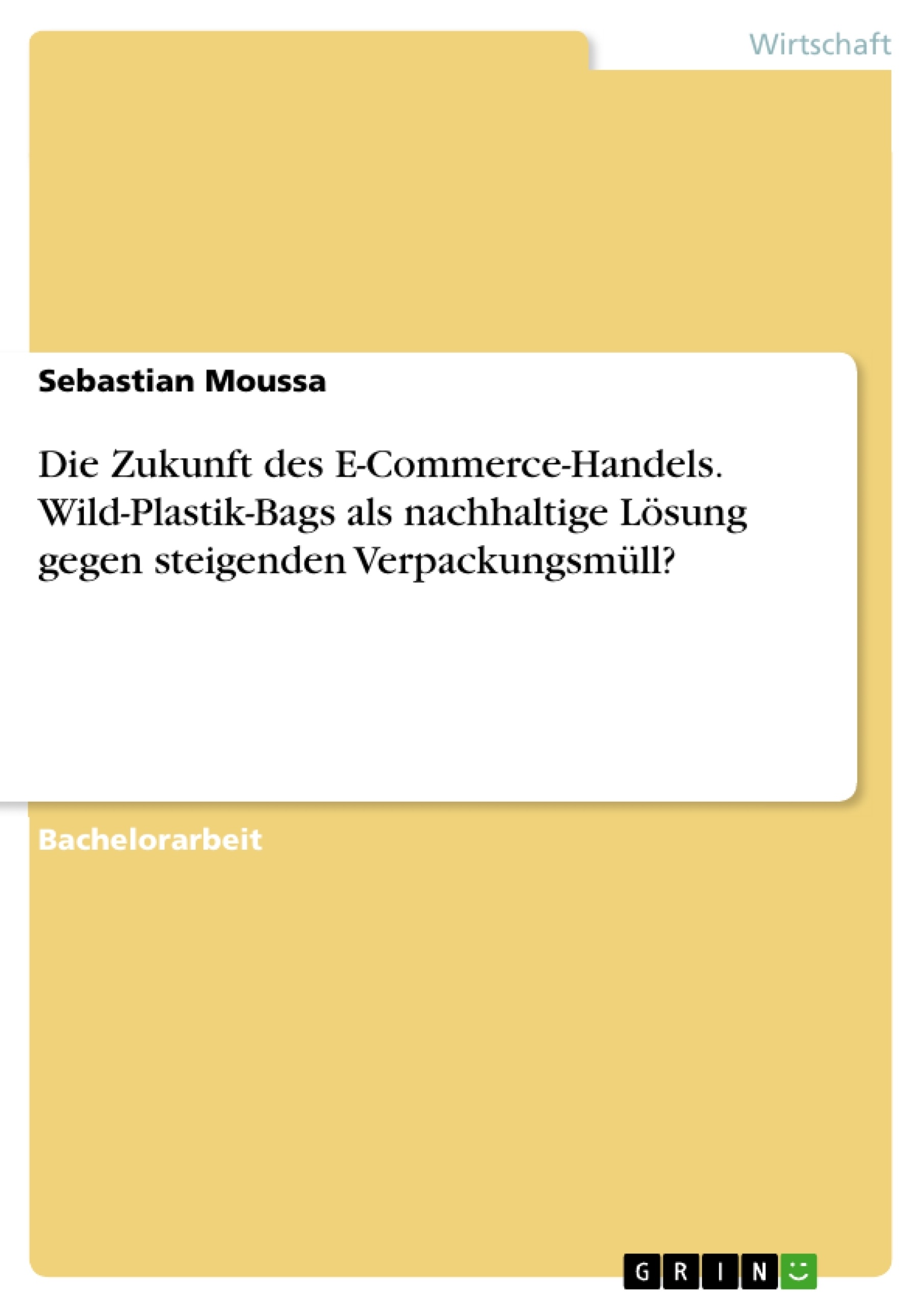Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema des E-Commerce-Handels und nachhaltigen Verpackungen und führt zu folgender Forschungsfrage: "Die Zukunft des E-Commerce-Handels – Wild-Plastik-Bags als nachhaltige Lösung gegen steigenden Verpackungsmüll?" Um diese Forschungsfrage umfassend zu beantworten, müssen im Vorfeld folgende Bedingungen geklärt werden:Wie lassen sich Kunststoffproduktionen nachhaltiger gestalten? Wie weit haben sich Kunststoffteilchen bereits in Ökosystemen ausgebreitet? Wie lässt sich weiteres Mikroplastik verhindern? Welchen Beitrag leisten E-Commerce-Händler, um ihren Plastikverbrauch zu reduzieren?
Zu Beginn werden Definitionen zu Nachhaltigkeit sowie Corporate Social Responsibility an die Hand gegeben. Es folgen weitere grundlegende Definitionen, um klare Abgrenzungen zu schaffen. Danach beschäftigt sich die Arbeit mit Recycling und erläutert Kunststoffe und ihre Verwendung. Zudem wird auf erste praktische Untersuchungen zu Recycling eingegangen. Im Anschluss wird das Unternehmen Wildplastic GmbH, sowie ihr Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt, gefolgt von einer Analyse zu den vorhandenen Fertigungsprozessen, vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation und Problemstellung
- Zielsetzung
- Aufbau der Bachelorarbeit
- Theoretische Grundlagen
- Nachhaltigkeit
- Geschichtliche Entstehung der Nachhaltigkeit
- Agenda 2030
- Kritik der Beschlüsse zur nachhaltigen Entwicklung
- Dimensionen der Nachhaltigkeit
- Nachhaltige Entwicklung
- Instrumente für nachhaltige Entwicklung
- Konsumenten
- Konsum
- Nachhaltiger Konsum
- E-Commerce
- Nachhaltiger E-Commerce Handel
- Corporate Social Responsibility
- Kritikpunkte CSR
- Corporate Social Responsiveness
- Corporate Governance
- Greenwashing
- Messung der Nachhaltigkeit
- Abfälle und Recycling
- Entstehung von Abfällen
- Abgrenzung Recycling und Verwertung
- Europäisches Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Mülltrennung
- Kunststoffe
- Kunststoffabfälle
- Mikroplastik
- Mikroplastik im Menschlichen-Organismus
- Export von Plastikabfällen
- Recycling
- Recycling von Kunststoffen
- LDPE
- Wildplastic GmbH
- Produktion einer Wildbag
- Auswirkung einer Wildbag
- Ausblick
- E-Commerce
- Kunststoffverpackungen
- Konsumenten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob Wild-Plastik-Bags eine nachhaltige Lösung für die steigende Verpackungsmüllproblematik im E-Commerce darstellen können. Sie analysiert die Relevanz nachhaltiger Entwicklung im Kontext des E-Commerce und untersucht die Rolle von Corporate Social Responsibility (CSR) und Greenwashing in diesem Bereich. Des Weiteren werden die Auswirkungen von Plastikabfällen und Mikroplastik auf die Umwelt und den menschlichen Organismus beleuchtet.
- Nachhaltigkeit im E-Commerce
- Die Rolle von CSR und Greenwashing
- Die Problematik von Plastikabfällen und Mikroplastik
- Die Nachhaltigkeit von Wild-Plastik-Bags
- Mögliche Auswirkungen auf Konsumenten und die E-Commerce-Branche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik des steigenden Verpackungsmülls im E-Commerce ein und definiert die Zielsetzung der Bachelorarbeit. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen der Nachhaltigkeit, beleuchtet den Konsumenten und den E-Commerce sowie die Bedeutung von Corporate Social Responsibility (CSR) und Greenwashing. Kapitel 3 fokussiert sich auf die Entstehung von Abfällen und Recycling mit besonderem Augenmerk auf Kunststoffe, Mikroplastik und den Export von Plastikabfällen. Kapitel 4 untersucht die Produktion und Auswirkungen von Wild-Plastik-Bags. Der Ausblick in Kapitel 5 beleuchtet die Zukunft des E-Commerce und die Rolle von Kunststoffverpackungen in diesem Kontext sowie die potentiellen Auswirkungen auf Konsumenten.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, E-Commerce, Verpackungsmüll, Wild-Plastik-Bags, CSR, Greenwashing, Plastikabfälle, Mikroplastik, Recycling, Konsumenten, Umwelt, Nachhaltigkeit im E-Commerce.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Wild-Plastik-Bags?
Das sind Versandtaschen aus Kunststoff, der aus der Umwelt (Wildplastic) gesammelt und recycelt wurde, um den Plastikmüll in Ökosystemen zu reduzieren.
Warum ist Verpackungsmüll im E-Commerce ein Problem?
Durch den boomenden Online-Handel steigen die Mengen an Einwegverpackungen massiv an, was zu einer hohen Umweltbelastung durch Plastik führt.
Was versteht man unter Greenwashing?
Greenwashing bezeichnet PR-Maßnahmen, die ein Unternehmen umweltfreundlicher darstellen, als es tatsächlich ist, ohne substanzielle ökologische Verbesserungen.
Welche Rolle spielt Mikroplastik für den Menschen?
Mikroplastik verbreitet sich in der Nahrungskette und kann so in den menschlichen Organismus gelangen, wobei die langfristigen gesundheitlichen Folgen noch erforscht werden.
Wie trägt das Kreislaufwirtschaftsgesetz zum Umweltschutz bei?
Es priorisiert die Vermeidung und das Recycling von Abfällen vor der energetischen Verwertung (Verbrennung), um Ressourcen zu schonen.
- Citation du texte
- Sebastian Moussa (Auteur), 2021, Die Zukunft des E-Commerce-Handels. Wild-Plastik-Bags als nachhaltige Lösung gegen steigenden Verpackungsmüll?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127350