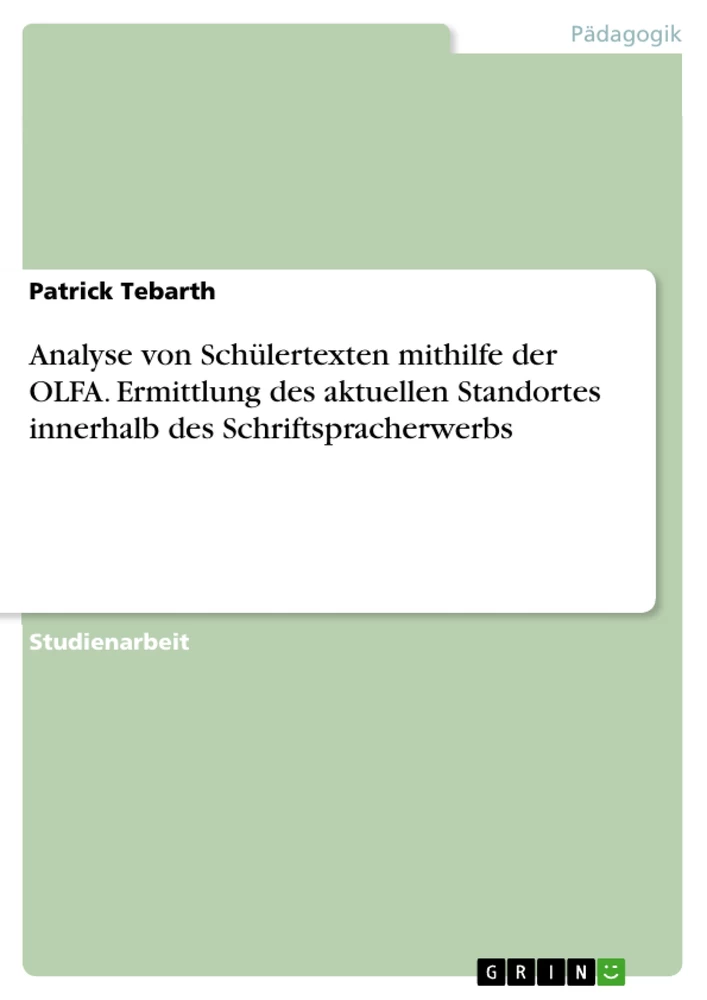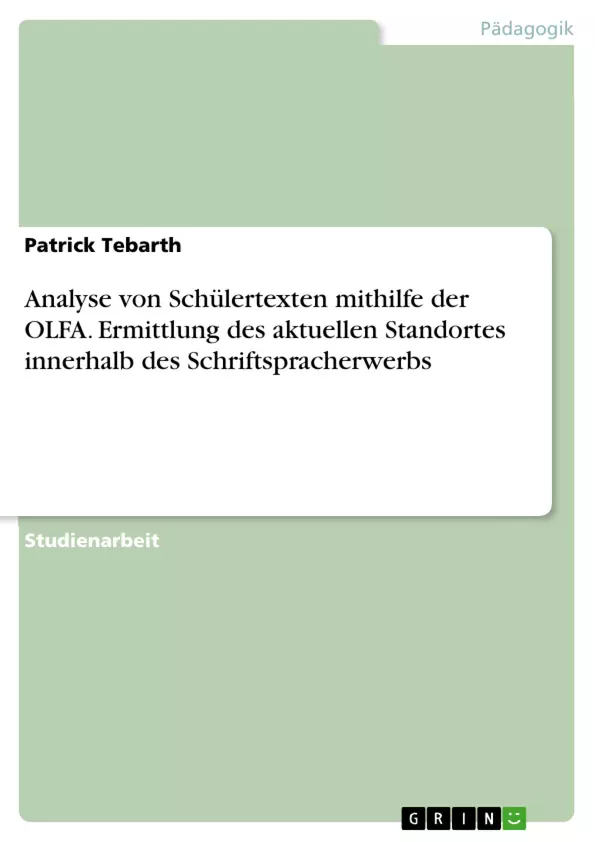Betrachtet man den Deutschunterricht der Schule in der heutigen Zeit, wird deutlich, dass dieser auf vielfältige Weise herausgefordert wird. Hierzu zählen u. a. Aspekte wie die Regulierung des Unterrichts durch die Kompetenzen des Lehrplans bzw. durch die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK), die das Bild eines durchschnittlichen Lernenden darstellen und so besonders schwächere und stärkere Schüler*innen (SuS) nicht so fördern, wie es durch andere Formate möglich wäre.
Auch das heterogene Klassenzimmer, das sich nicht nur hinsichtlich sozialer Milieus und des ggf. vorhandenen Migrationshintergrundes unterscheidet, sondern auch durch SuS geprägt ist, die durch die geringe Kenntnis der deutschen Sprache Probleme haben können, kann eine Herausforderung darstellen, da zum einen die Herkunft aus einem sozial schwächeren Milieu sowie ein Migrationshintergrund gemäß der PISA-Studie, einer internationalen Studie zur Untersuchung der Leistung innerhalb diverser Schulfächer, Gründe für mangelnde Kompetenzen gegenüber Mitschüler*innen sein können. Zum anderen ist auch das Beherrschen der deutschen Sprache essentiell für das Erreichen von schulischem Erfolg in allen schulischen Fächern, da diese es ermöglicht, dem Unterricht folgen zu können und erwartete, fachliche und fachübergreifende Kompetenzen aufbauen zu können. Um diesen Herausforderungen entgegentreten zu können, ist es wichtig, den Kompetenzstand der SuS (regelmäßig) zu ermitteln, um besonders schwächeren SuS Fördermöglichkeiten anbieten zu können, die sich an ihren vorliegenden Problemen orientieren.
Ein geeignetes Instrument stellt in diesem Zusammenhang die Oldenburger Fehleranalyse (OLFA) dar, weshalb diese Arbeit die Frage thematisiert, ob die OLFA zur Ermittlung der Rechtschreibkompetenzen von drei exemplarischen SuS und zur Überprüfung, ob und in welchen Bereichen ihrer Entwicklung Förderungen nötig sind, genutzt werden kann und soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Einführung
- 2.1 Standardlautung und Standardschreibung im Deutschen
- 2.2 Die Phasen des Schriftspracherwerbs
- 3. Die OLFA als Instrument der qualitativen Rechtschreibanalyse
- 4. Analyse der Schülertexte
- 5. Abschließendes Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
- 7. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert mithilfe der Oldenburger Fehleranalyse (OLFA) die Rechtschreibkompetenzen von drei Schüler*innen, um festzustellen, ob und in welchen Bereichen ihrer Entwicklung Förderungen nötig sind. Die Arbeit befasst sich mit der Anwendung der OLFA als Instrument zur Ermittlung des aktuellen Standortes im Schriftspracherwerb. Darüber hinaus werden die theoretischen Grundlagen der OLFA, insbesondere Günther Thomés Modell der Rechtschreibung und die Phasen des Schriftspracherwerbs, erläutert.
- Die Herausforderungen des heutigen Deutschunterrichts
- Die Bedeutung der Rechtschreibkompetenz für den schulischen Erfolg
- Die OLFA als Instrument zur Analyse der Rechtschreibkompetenz
- Die Anwendung der OLFA auf Schülertexte
- Die Bewertung der OLFA als geeignetes Instrument zur Feststellung der Rechtschreibkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik des heutigen Deutschunterrichts dar, insbesondere die Herausforderungen, die durch unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schüler*innen entstehen. Hierbei wird die Bedeutung der Rechtschreibkompetenz für den schulischen Erfolg hervorgehoben. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die OLFA als Instrument zur Ermittlung der Rechtschreibkompetenz von drei Schüler*innen zu untersuchen.
2. Theoretische Einführung
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der OLFA beleuchtet. Der Fokus liegt auf Günther Thomés Modell der Rechtschreibung, welches das Verhältnis von Standardlautung und Standardschreibung im Deutschen sowie die Phasen des Schriftspracherwerbs beinhaltet.
- Das Verhältnis von Phonemen und Graphemen im Deutschen
- Basisgrapheme und Orthographeme
- Die Phasen des Schriftspracherwerbs nach Thomé
- Protoalphabetische-phonetische Phase
- Alphabetische Phase
3. Die OLFA als Instrument der qualitativen Rechtschreibanalyse
Dieses Kapitel befasst sich mit der Vorstellung der OLFA als Instrument der qualitativen Rechtschreibanalyse. Es werden die Grundlagen, die Durchführung und die Auswertung der Analyse erläutert.
4. Analyse der Schülertexte
In diesem Kapitel werden die Schüler*innen kurz vorgestellt und ihre Texte gemäß der OLFA analysiert und ausgewertet. Die Ergebnisse werden festgehalten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Rechtschreibkompetenz, Schriftspracherwerb, qualitative Rechtschreibanalyse, Oldenburger Fehleranalyse (OLFA), Günther Thomé, Phasen des Schriftspracherwerbs, Standardlautung, Standardschreibung, Phoneme, Grapheme, Basisgrapheme, Orthographeme, Schülertexte, Förderung.
- Arbeit zitieren
- Patrick Tebarth (Autor:in), 2021, Analyse von Schülertexten mithilfe der OLFA. Ermittlung des aktuellen Standortes innerhalb des Schriftspracherwerbs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127592