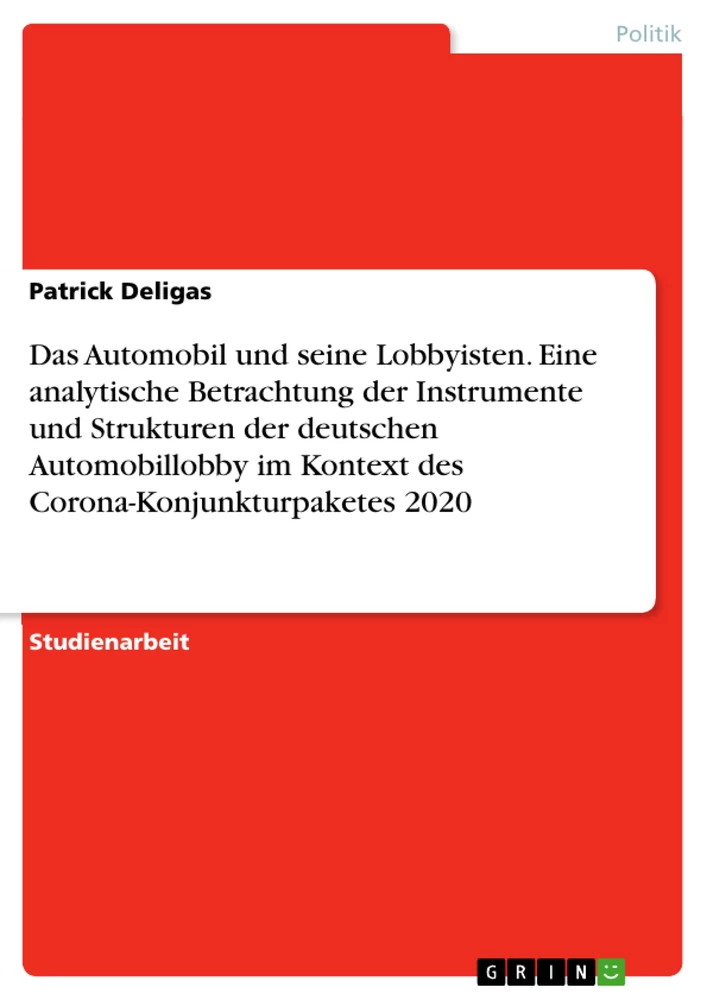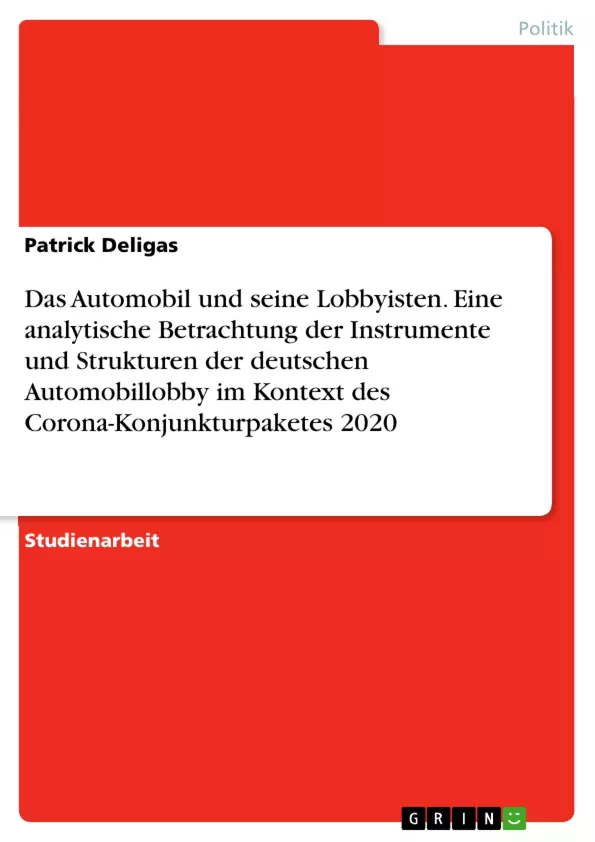Der Deutsche Carl Benz revolutionierte 1885 mit seiner Erfindung des Automobils die Mobilität der Welt nachhaltig. Im Jahr 2020 waren bereits knapp 1,2 Milliarden Pkw weltweit unterwegs. Das moderne Automobil basiert bis heute auf dem Grundprinzip von Carl Benz‘ Erfindung. Allein in Deutschland sind 48,2 Millionen Pkw registriert. Hinzuzurechnen sind Nutzfahrzeuge, Omnibusse, Lkw, Sattelzugmaschinen und übrige Kraftfahrzeuge. Das Automobil ist eine Erfolgsgeschichte und eines der wichtigsten Wirtschafts- und Exportgüter Deutschlands. Die drei Autokonzerne Volkswagen AG (VW), Daimler AG (Daimler) und Bayerische Motoren Werke AG (BMW) spielen sowohl in Deutschland, Europa als auch global in der ersten Liga mit. Es scheint daher wenig verwunderlich, dass die starke Automobilbranche eine ebenso starke, schlagkräftige und einflussreiche Lobby für ihre Interessenvertretung auf bundesdeutscher, europäischer und globaler Ebene etabliert hat.
Interessensvertretungen sind in einer pluralistischen Gesellschaft und einem korporatistischen Staat unabdingbar und legitim. Ein unregulierter und übermäßiger Lobbyismus einzelner mächtiger Akteure birgt jedoch die Gefahr der direkten, einseitigen Einflussnahme auf die Gesetzgebung und Ministerialbürokratie, um unternehmerische (Partikular-)interessen und Ziele zu verwirklichen. Die Lasten werden auf die Gesellschaft übertragen und laufen oftmals dem Gemeinwohl zuwider. Schaden können hierbei sowohl die Repräsentanten der exekutiven und legislativen Staatsgewalt, das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen sowie das politische System an sich nehmen.
Diese Abhandlung stellt die Struktur der deutschen Automobillobby auf deutscher und europäischer Ebene und deren Beeinflussung politischer Entscheidungsvorgänge dar. Beispielgebend für eine politische Entscheidung wird das im Juni 2020 verabschiedete 130 Milliarden Euro schweren Konjunktur- und Zukunftspakets des Bundes, nachfolgend Corona-Konjunkturpaket genannt, sein. Die Strukturen auf europäischer Ebene werden hierbei verkürzt betrachtet, da sie für das bundesdeutsche Paket keine tragende Rolle einnehmen. Zur weiteren Eingrenzung, fokussiert die Ausarbeitung die maßgeblich einflussreichsten Lobbyakteure der Automobilindustrie, namentlich VW, BMW und Daimler, wenngleich die Branche eine Vielzahl weiterer Unternehmen und Verbände umfasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Blaupause Lobbyismus
- Das Automobil und seine Lobbyisten
- Deutschlands Wirtschaftsgut par excellence
- Lobbystrukturen der Automobilindustrie in Deutschland
- Europäische Lobbystrukturen
- Lobbying um Corona-Konjunktur-Milliarden
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Struktur der deutschen Automobillobby auf nationaler und europäischer Ebene sowie deren Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse. Im Fokus steht dabei das im Juni 2020 verabschiedete Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung, wobei der Schwerpunkt auf der Rolle der deutschen Automobillobby bei der Durchsetzung ihrer Interessen im Kontext dieses Pakets liegt.
- Analyse der Lobbystrukturen der deutschen Automobilindustrie
- Untersuchung der Einflussnahme der Automobillobby auf politische Entscheidungen
- Bewertung der Rolle des Corona-Konjunkturpakets für die deutsche Automobilindustrie
- Diskussion der potenziellen Folgen des Lobbyismus für die Gesellschaft und das politische System
- Einordnung der deutschen Automobillobby in den Kontext des europäischen Lobbyismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Dieses Kapitel stellt die Relevanz des Automobils als Wirtschaftsgut und dessen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft heraus. Es werden zudem die Herausforderungen durch übermäßigen Lobbyismus und dessen potenzielle Auswirkungen auf die politische Entscheidungsfindung beleuchtet.
- Blaupause Lobbyismus: Hier wird das Konzept des Lobbyismus erläutert und seine Bedeutung in einer pluralistischen Gesellschaft und einem korporatistischen Staat beleuchtet.
- Das Automobil und seine Lobbyisten: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Lobbystrukturen der deutschen Automobilindustrie. Es werden die wichtigsten Akteure und ihre Einflussnahme auf nationaler und europäischer Ebene vorgestellt. Es werden auch die wichtigen deutschen Autokonzerne VW, BMW und Daimler im Detail beleuchtet.
- Lobbying um Corona-Konjunktur-Milliarden: Hier werden die Strategien der Automobillobby bei der Durchsetzung ihrer Interessen im Kontext des Corona-Konjunkturpaketes analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die deutschen Automobilkonzerne VW, BMW und Daimler, ihre Lobbystrukturen auf nationaler und europäischer Ebene, die Einflussnahme auf politische Entscheidungen, das Corona-Konjunkturpaket 2020, die Folgen von Lobbyismus für die Gesellschaft und das politische System.
Häufig gestellte Fragen
Wie einflussreich ist die deutsche Automobillobby?
Die Automobilindustrie ist ein zentrales Wirtschaftsgut Deutschlands. Entsprechend stark sind Akteure wie VW, BMW und Daimler sowie Verbände vernetzt, um politische Entscheidungen zu beeinflussen.
Welche Rolle spielte die Automobillobby beim Corona-Konjunkturpaket 2020?
Die Lobby versuchte massiv, Kaufprämien für Pkw (auch mit Verbrennungsmotor) durchzusetzen, um die Branche während der Pandemie zu stützen.
Ist Lobbyismus in Deutschland legitim?
In einer pluralistischen Gesellschaft ist Interessenvertretung legitim, jedoch birgt unregulierter Lobbyismus die Gefahr einseitiger Einflussnahme zulasten des Gemeinwohls.
Wer sind die wichtigsten Akteure der Automobillobby?
Zu den einflussreichsten Akteuren gehören die großen Autokonzerne (VW, BMW, Daimler) sowie der Verband der Automobilindustrie (VDA).
Wie wirkt sich Lobbyismus auf die Gesetzgebung aus?
Durch direkten Kontakt zur Ministerialbürokratie und Politikern können Lobbyisten versuchen, Partikularinteressen in Gesetzestexten oder Förderprogrammen zu verankern.
- Quote paper
- Patrick Deligas (Author), 2021, Das Automobil und seine Lobbyisten. Eine analytische Betrachtung der Instrumente und Strukturen der deutschen Automobillobby im Kontext des Corona-Konjunkturpaketes 2020, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127676