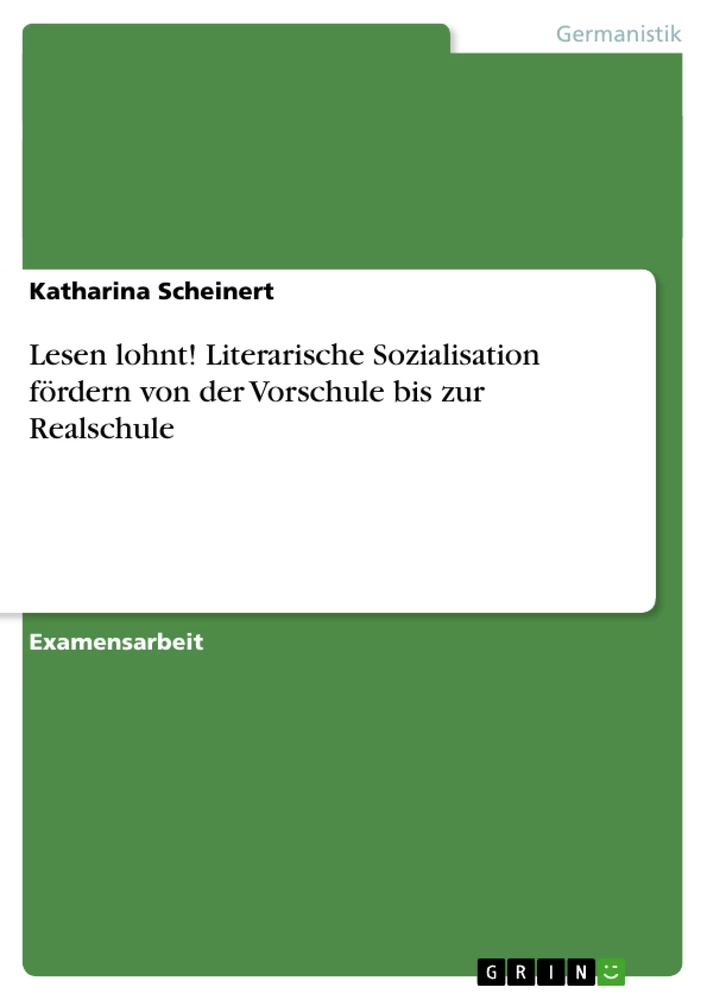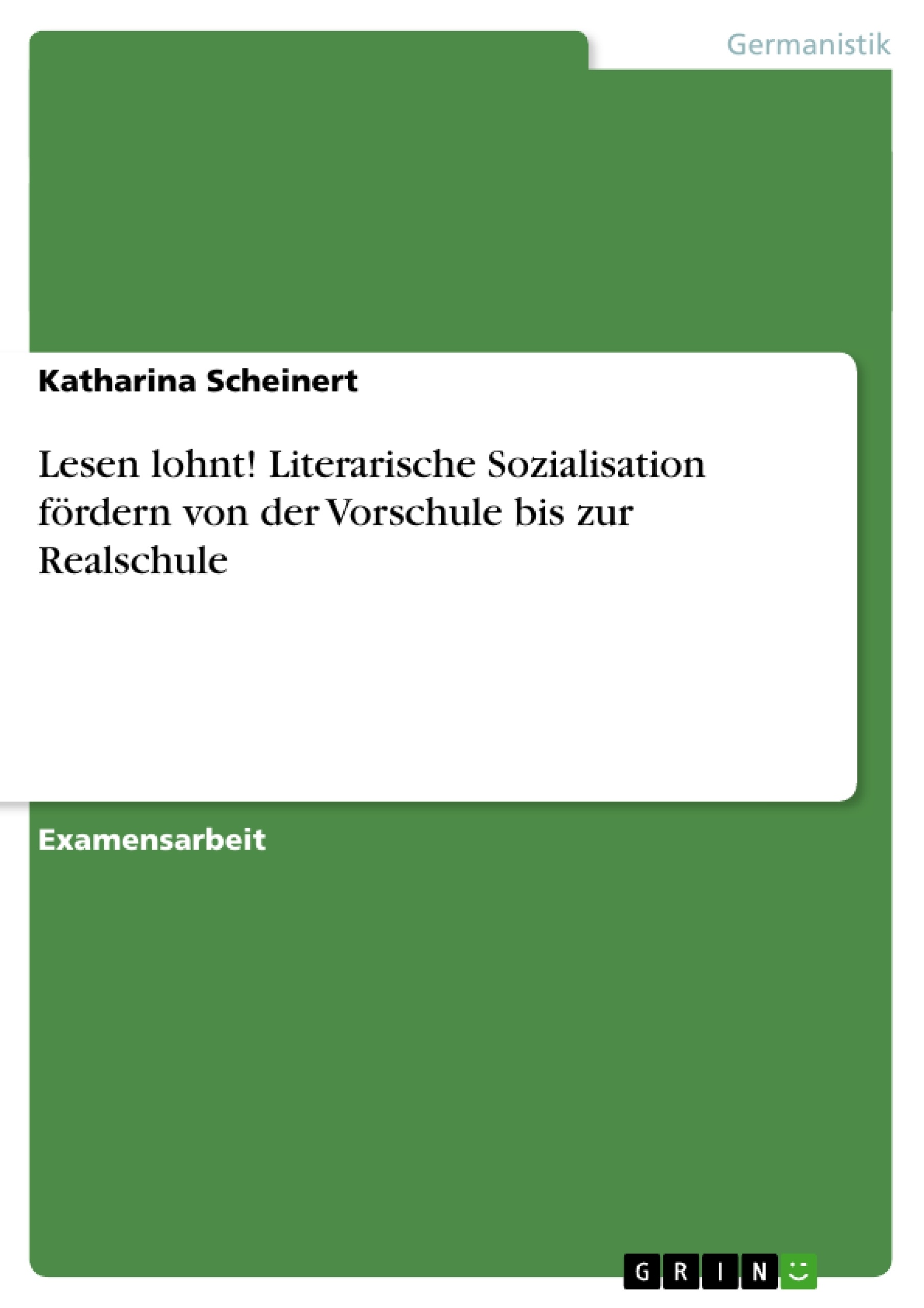Diese Arbeit, eine so genannte Wissenschaftliche Hausarbeit, entstand im Rahmen der ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und besteht aus theoretischen und praktischen Teilen, die jedoch oftmals fließend ineinander übergehen. Als Lehramtsstudentin beruht mein persönliches Interesse an der vorliegenden Arbeit auf eigenen Leseerfahrungen, die mich auch dazu brachten, am „Vorleseprojekt“ der Pädagogischen Hochschule Weingarten teilzunehmen. Das „Vorleseprojekt“ faszinierte und erschütterte mich zugleich. Zum einen war es eine sehr schöne Erfahrung den Kindern Freude im Umgang mit Büchern zu vermitteln, zum andern ließen sich bereits in diesem sehr frühen Entwicklungsstadium der Kinder erhebliche Differenzen bezüglich ihrer Kompetenz im Umgang mit Büchern feststellen. Dies kann leider überwiegend auf eine mangelnde Förderung von literarischen Kompetenzen im Elternhaus zurückgeführt werden und war sogleich Anlass mich mit diesem Thema näher zu befassen. Es interessierte mich herauszufinden wann der optimale Zeitpunkt einer frühkindlichen Förderung, bezogen auf das spätere Leseverhalten, ist und mit welchen Methoden und unter welchen Bedingungen diese durchgeführt werden kann. Zunächst galt es aber sich darüber klar zu werden, was unter literarischer Kompetenz eigentlich zu verstehen ist, weshalb zu Beginn dieser Arbeit ein recht ausführlicher Überblick über grundlegende Begriffe wie Lesefertigkeit, Lesefähigkeit, Lesekompetenz, Lesemotivation und Lese- bzw. literarische Sozialisation gegeben wird.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Grundlegungen
- Lesefertigkeit und Lesefähigkeit
- Lesekompetenz
- Lesemotivation
- Literarische Kompetenz
- Lesesozialisation vs. Literarische Sozialisation
- Förderung von literarischer Sozialisation im Kindergarten
- Vorliterarische Erfahrungen im Kindergarten
- Das „Vorleseprojekt“ der Pädagogischen Hochschule Weingarten
- Zielsetzungen
- Durchführung des Vorleseprojektes
- Erkenntnisse
- Probleme bei der Durchführung
- Zusammenfassung und Ausblick
- Lesesozialisation in der Schule
- Tendenzen und Ergebnisse der Schulleistungsstudie IGLU
- Didaktische Begründungen und Lehrplaninhalte der Grundschule
- Aufgaben und Ziele des Literaturunterrichts
- Konsequenzen für den Lese- und Literaturunterricht in der Grundschule
- Das Märchen im Literaturunterricht
- Tendenzen und Ergebnisse der Schulleistungsstudie PISA
- Didaktische Begründungen und Lehrplaninhalte der Hauptschule
- Aufgaben und Ziele des Literaturunterrichts
- Konsequenzen für den Lese- und Literaturunterricht in der Hauptschule
- Der Einsatz von Paratexten im Deutschunterricht
- Zusammenfassung
- Folgerungen für die Sekundarstufe I
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten
- Didaktische Begründungen, Lehrplaninhalte und Konsequenzen für den Lese- und Literaturunterricht in der Realschule
- Unterrichtsbeispiele für die Sekundarstufe I
- Aufwärmübung „Katz und Maus“
- Der Einsatz von Lektüre im Unterricht - „Die Welle“ von Morton Rhue
- Unterrichtsmodell zum Roman „Die Welle“
- Zusammenfassung und Ausblick
- Exkurs: Lesen als Flow-Erlebnis
- Wolfgang Isers „Akt des Lesens“
- Flow beim Lesen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Förderung von literarischer Sozialisation von der Vorschule bis zur Realschule zu untersuchen und die Bedeutung des Lesens für die Entwicklung von Kompetenzen in der Gesellschaft zu beleuchten. Sie analysiert die unterschiedlichen Phasen der literarischen Sozialisation, die Rolle des Elternhauses, der Schule und des Unterrichts sowie die Herausforderungen und Möglichkeiten der Leseförderung in verschiedenen Altersstufen.
- Die Entwicklung von Lesefertigkeit und Lesekompetenz
- Der Einfluss von Lesemotivation und literarischer Sozialisation auf das Leseverhalten
- Die Bedeutung von frühkindlicher Leseförderung und deren Auswirkungen auf die spätere Entwicklung von Lesekompetenz
- Die Rolle von Literatur im Unterricht und die didaktische Gestaltung von Lese- und Literaturunterricht
- Die Herausforderungen und Chancen der Leseförderung in der heutigen Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer grundlegenden Betrachtung von Begriffen wie Lesefertigkeit, Lesekompetenz und Lesemotivation. Sie stellt dar, wie diese Komponenten zusammenwirken und wie sie im Rahmen der literarischen Sozialisation eine wichtige Rolle spielen. Im zweiten Kapitel wird die Förderung von literarischer Sozialisation im Kindergarten beleuchtet. Das „Vorleseprojekt“ der Pädagogischen Hochschule Weingarten dient hier als exemplarisches Beispiel, um die Bedeutung von frühkindlicher Leseförderung zu verdeutlichen. In Kapitel drei werden die Tendenzen und Ergebnisse der Schulleistungsstudien IGLU und PISA in Bezug auf Lesekompetenz vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet didaktische Begründungen und Lehrplaninhalte der Grundschule und der Hauptschule sowie die Aufgaben und Ziele des Literaturunterrichts in diesen Schulformen.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den Themen Lesekompetenz, Lesesozialisation, literarische Sozialisation, Leseförderung, Literaturunterricht, frühkindliche Bildung, Schulleistungsstudien, didaktische Konzepte, Unterrichtsgestaltung und Rezeptionsästhetik.
- Arbeit zitieren
- Katharina Scheinert (Autor:in), 2008, Lesen lohnt! Literarische Sozialisation fördern von der Vorschule bis zur Realschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112768