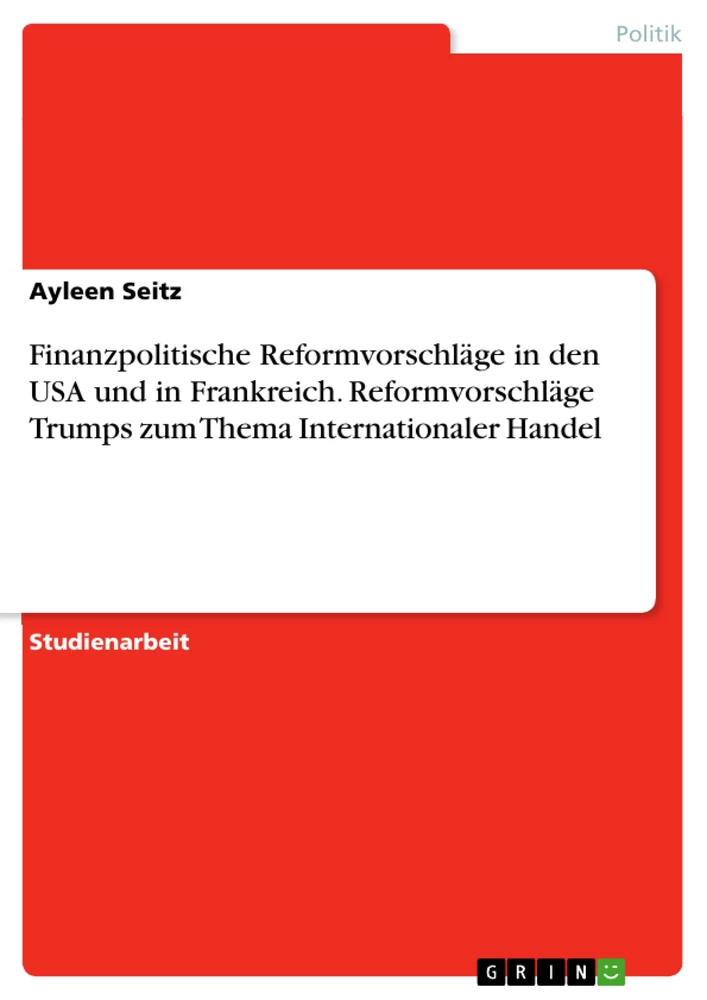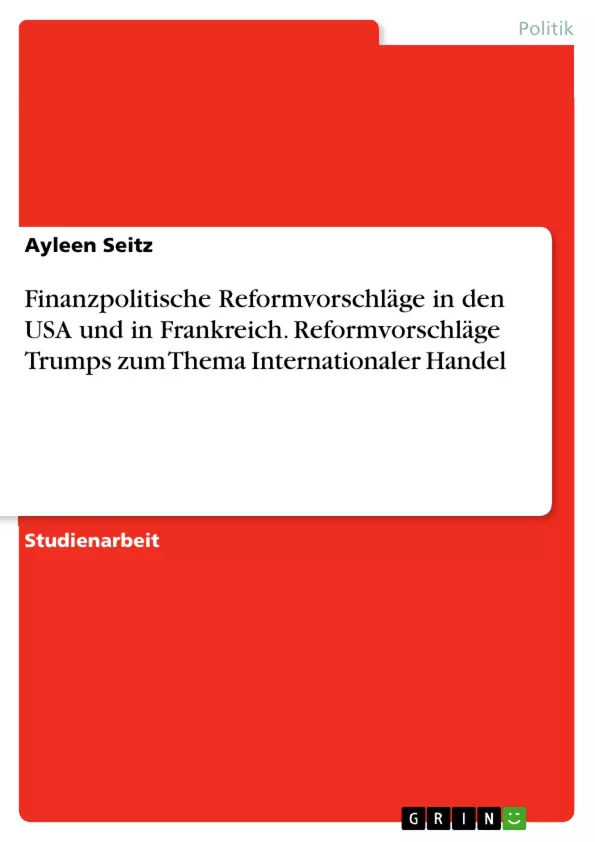Auf dem heutigen Weltmarkt spielt der internationale Handel eine große Rolle, welcher von dem Austausch von Gütern und Dienstleistungen geprägt ist. In diesem Handel haben sich Zölle als gängiges Handelshemmnis manifestiert und daher an Bedeutung gewonnen. Als Rechtsgrundlage für den Handel unter Gebrauch von Zöllen dient zum einen das
Zollrecht und zum anderen die Welthandelsorganisation WTO, welche spezielle Regeln im Welthandel festlegt und zugleich einen hohen Stellenwert genießt. Doch in der Entwicklung der WTO lassen sich negative Tendenzen abzeichnen.
Demgemäß wird in Kapitel 2 sowohl der Einstieg in das Thema durch Klärung grundlegender Begriffe der Zollpolitik
erleichtert und der Zusammenhang zwischen der WTO und der Zollpolitik betrachtet.
Am 20. Januar 2017 wurde der Nachfolger von Barack Obama, Donald John Trump, als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Mit dieser Präsidentschaft sollte nicht nur ein neuer Präsident in das Amt eingeführt, sondern vor allem ein Richtungswechsel in unterschiedlichen Bereichen in den USA vollzogen werden. Der unter dem Wahlspruch America First stehende US-amerikanische Politikstil sticht hervor: Die neue US-Regierung sieht scheinbar eine Abkehr vom Leitbild des Freihandels für die USA vor.
Neben zahlreichen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels stellen die seit dem 23. März 2018 verhängten Importzölle, insbesondere auf Stahl- und Aluminium, einen zentralen Punkt der protektionistisch ausgelegten Handelspolitik dar. Die Grundidee von tarifären Handelshemmnissen in Form von Einfuhrzöllen bildet keine Neuerung ab, jedoch der Bezug Trumps auf eine andere Rechtsgrundlage. Was dabei der Gegenstand der neuen Handelspolitik ist und was Trumps genaue Vorhaben sind wird im dritten Kapitel geklärt.
Als viertgrößtes Land der Welt sind die USA in einem breiten Netzwerk aus verschiedenen Handelspartnern verankert, welche unterschiedlich auf die verhängten Zölle reagieren. Demnach könnten die Folgen nicht nur den Bereich des Handels berühren, sondern auch auf zwischenstaatliche Außenbeziehungen übergreifen. Im vierten Kapitel wird analysiert, welche nationalen und weltweiten Folgen daraus resultieren könnten und ob diese förderlich für den internationalen Handel, besonders für die US-amerikanische Stahl- und Aluminiumindustrie, sind. Mit Hilfe einer Reflektion der zuvor gewonnenen Erkenntnisse und einer Prognose für die Zukunft im Fazit, wird diese Seminararbeit beendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zölle als handelspolitisches Instrument
- Begriffliche Grundlagen
- Die Rolle der Welthandelsorganisation
- Die Handelspolitik der USA in Bezug auf Zölle
- Grundlage der US-amerikanischen Handelspolitik
- Protektionistische Maßnahmen des US-Präsidenten Trump
- Die Lage der US-amerikanischen Stahl- und Aluminiumindustrie
- Ökonomische Analyse der Trump'schen Maßnahmen in den USA
- Auswirkungen auf die US-Wirtschaft am Beispiel der Stahl- und Aluminiumindustrie
- Der sich entwickelnde transatlantische Handelskrieg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die handelspolitischen Maßnahmen des US-Präsidenten Donald Trump, insbesondere die Einführung von Zöllen auf Stahl und Aluminium. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche ökonomischen Auswirkungen diese Maßnahmen auf die US-Wirtschaft und den internationalen Handel haben.
- Zölle als Instrument der Handelspolitik
- Die Rolle der Welthandelsorganisation
- Die US-amerikanische Handelspolitik unter Präsident Trump
- Die Auswirkungen der Trump'schen Maßnahmen auf die US-Wirtschaft
- Der transatlantische Handelskrieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der handelspolitischen Reformvorschläge Trumps ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Zölle als Instrument der Handelspolitik, wobei sowohl die begrifflichen Grundlagen als auch die Rolle der Welthandelsorganisation erläutert werden. Kapitel 3 widmet sich der Handelspolitik der USA, insbesondere den protektionistischen Maßnahmen Trumps und der Lage der US-amerikanischen Stahl- und Aluminiumindustrie. In Kapitel 4 wird eine ökonomische Analyse der Trump'schen Maßnahmen durchgeführt, wobei die Auswirkungen auf die US-Wirtschaft am Beispiel der Stahl- und Aluminiumindustrie im Vordergrund stehen. Darüber hinaus wird der sich entwickelnde transatlantische Handelskrieg beleuchtet.
Schlüsselwörter
Zölle, Handelspolitik, Protektionismus, Welthandelsorganisation (WTO), US-amerikanische Wirtschaft, Stahl- und Aluminiumindustrie, transatlantischer Handelskrieg.
Häufig gestellte Fragen
Welches Ziel verfolgte Donald Trump mit seiner "America First"-Handelspolitik?
Ziel war ein Richtungswechsel weg vom Freihandel hin zu protektionistischen Maßnahmen, um die heimische Industrie, insbesondere Stahl und Aluminium, zu stärken.
Welche Rolle spielt die Welthandelsorganisation (WTO) in diesem Konflikt?
Die WTO legt Regeln für den Welthandel fest; Trumps Zölle wurden jedoch oft auf Basis nationaler Sicherheitsinteressen verhängt, was zu Spannungen mit WTO-Prinzipien führte.
Was waren die konkreten Maßnahmen ab März 2018?
Es wurden Importzölle auf Stahl (25 %) und Aluminium (10 %) verhängt, die viele Handelspartner, einschließlich der EU, betrafen.
Welche Folgen hatte diese Politik für die internationalen Beziehungen?
Sie führte zu Gegenreaktionen der Handelspartner und löste einen transatlantischen Handelskrieg aus, der die Außenbeziehungen belastete.
Waren die Zölle förderlich für die US-Stahlindustrie?
Die Arbeit analysiert die nationalen Folgen und kommt zu einer differenzierten Bewertung, ob diese protektionistischen Maßnahmen langfristig die gewünschten Effekte erzielten.
- Citar trabajo
- Ayleen Seitz (Autor), 2018, Finanzpolitische Reformvorschläge in den USA und in Frankreich. Reformvorschläge Trumps zum Thema Internationaler Handel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127736