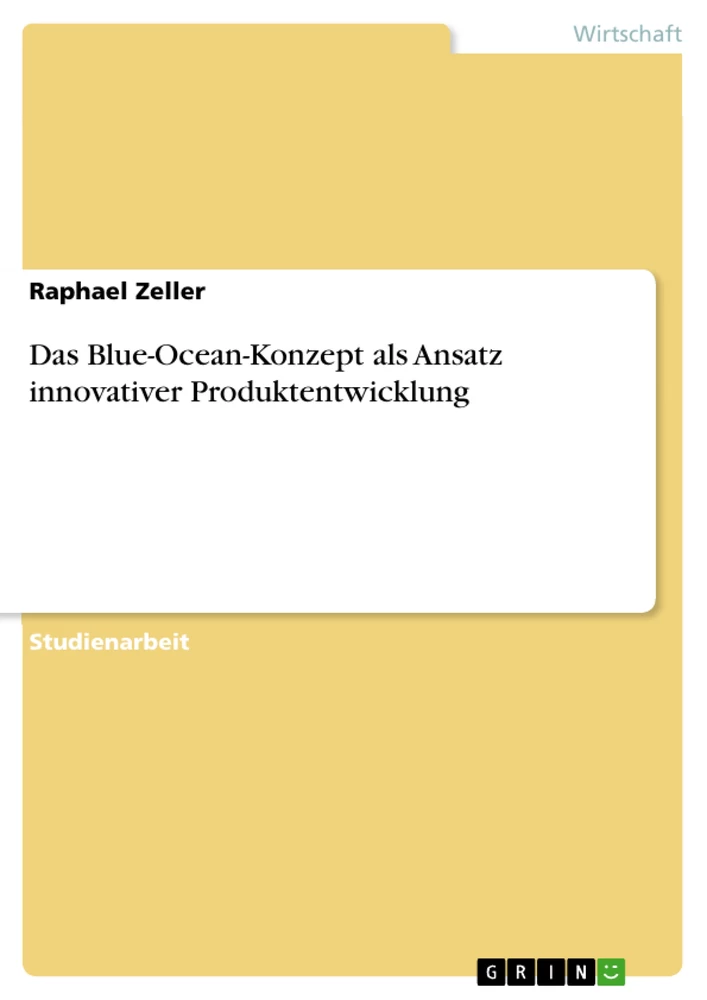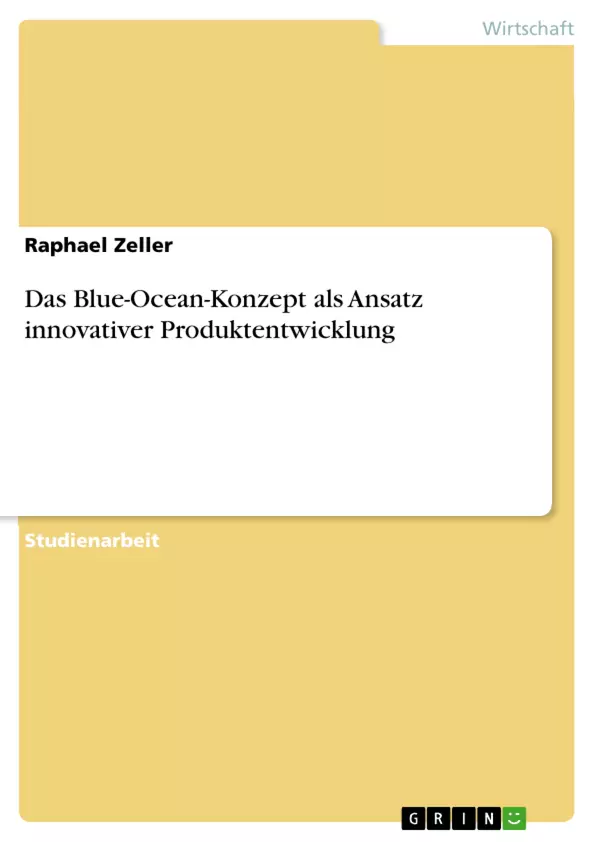Der Konkurrenzkampf auf den Märkten unserer Welt wird immer größer. Eine immer größer werdende Konkurrenz durch die fortschreitende Globalisierung sowie die abnehmende Käuferschaft tragen nicht zuletzt einen erheblichen Teil dazu bei. Letztendlich bestehen völlig übersättigte Märkte. Unternehmen versuchen sich durch innovative Produkte und erhebliche Investitionen im Bereich des Marketings gegen ihre Konkurrenz durchzusetzen und Marktanteile für sich zu gewinnen. Dies verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern auch erhebliches Engagement. Die Blue-Ocean-Strategy (BOS) bietet einen möglichen Ansatzpunkt um diese Gegebenheiten hinter sich zu lassen. Sie bietet einen Ansatz zur innovativen Produktentwicklung ohne die Aspekte der übersättigten Märkte und harten Konkurrenzkämpfe.
Diese Arbeit setzt sich als Ziel zu untersuchen, wie sich die BOS zur Entwicklung innovativer Lösungen in der Praxis umsetzen lässt und ob sie einen praktischen Nutzen aufweist. In den Ausführungen zur Umsetzung der Strategie sollen die konstitutiven Merkmale als Subziel aufgezeigt werden. Um den praktischen Nutzen aufzuzeigen, sollen konkrete Beispiele recherchiert werden.
Im Aufbau dieser Arbeit soll zunächst der Grundbegriff des Innovationsmanagements definiert werden, sowie die BOS. Im Darauffolgenden sollen die konstitutiven Merkmale angeführt werden. In einer kritischen Auseinandersetzung soll neben allgemeinen Ausführungen auch auf die Ausführungen der Entwickler der BOS eingegangen werden. In einer abschließenden Zusammenfassung werden die Ergebnisse nochmals abschließend reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition und Grundlagen
- Innovationsmanagement
- BOS
- Konstitutive Merkmale der BOS
- Grundprinzipien des Blue Ocean Konzeptes
- Die Prinzipien zur Eroberung blauer Ozeane
- Grundlegende Tools und Formate zur Analyse
- Formulierung von blaue Ozeane
- Umsetzung von blauen Ozeanen
- Kritische Auseinandersetzung und die Praxis
- Kritik und praktischer Nutzen allgemein
- Anwendungsbeispiele und praktischer Nutzen aus Kim und Mauborgne
- Der praktische Nutzen bei kleinen und mittleren Unternehmen
- Der praktische Nutzen für Dienstleistungen
- Der praktische Nutzen für Großunternehmen
- Fazit und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, zu untersuchen, wie sich die Blue-Ocean-Strategy (BOS) in der Praxis zur Entwicklung innovativer Lösungen einsetzen lässt und ob sie einen konkreten Nutzen bietet. Die Arbeit soll die konstitutiven Merkmale der BOS als Teilziel beleuchten. Um den praktischen Nutzen aufzuzeigen, werden konkrete Beispiele recherchiert.
- Definition und Grundzüge des Innovationsmanagements
- Beschreibung der BOS und ihrer Kernprinzipien
- Analyse der konstitutiven Merkmale der BOS
- Untersuchung der Prinzipien zur Eroberung von blauen Ozeanen
- Bewertung des praktischen Nutzens der BOS anhand von Beispielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den zunehmenden Konkurrenzkampf auf den Märkten und stellt die Blue-Ocean-Strategy (BOS) als einen möglichen Ansatz zur innovativen Produktentwicklung ohne harten Wettbewerb vor. Die Arbeit fokussiert auf die praktische Umsetzung der BOS und die Analyse ihres Nutzens.
- Begriffsdefinition und Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Innovationsmanagements und erläutert die grundlegenden Prinzipien der BOS. Es werden verschiedene Ansätze zur Untergliederung von Innovationen sowie der Stage-Gate-Prozess als etablierter Prozess im Innovationsmanagement vorgestellt.
- Konstitutive Merkmale der BOS: Das Kapitel konzentriert sich auf die zentralen Merkmale der BOS. Es werden die Grundprinzipien, Strategien und Ziele des Konzeptes erläutert und anschließend die Prinzipien zur Eroberung der blauen Ozeane sowie die dazugehörigen Tools, Formate, Vorgehensweisen und Ideen vorgestellt.
- Kritische Auseinandersetzung und die Praxis: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kritik an der BOS und ihrem praktischen Nutzen. Es werden sowohl allgemeine kritische Punkte als auch konkrete Anwendungsbeispiele aus Kim und Mauborgne betrachtet. Darüber hinaus wird der praktische Nutzen der BOS für kleine und mittlere Unternehmen, Dienstleistungen und Großunternehmen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Innovationsmanagement, Blue-Ocean-Strategy, Produktentwicklung, Wettbewerbsvorteile, Nutzen-Innovation, Red Oceans, Blue Oceans, und die Umsetzung der BOS in der Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Blue-Ocean-Strategy (BOS)?
Die BOS ist ein Ansatz zur innovativen Produktentwicklung, bei dem Unternehmen neue, konkurrenzfreie Märkte („Blaue Ozeane“) erschaffen, anstatt in gesättigten Märkten („Rote Ozeane“) zu kämpfen.
Was versteht man unter „Nutzen-Innovation“?
Nutzen-Innovation bedeutet, dass ein Unternehmen gleichzeitig die Kosten senkt und den Nutzen für den Kunden massiv erhöht, wodurch der Wettbewerb irrelevant wird.
Wie lässt sich die BOS in der Praxis umsetzen?
Durch Analyse-Tools wie das Strategie-Kontinuum und das 4-Aktionen-Format (Eliminieren, Reduzieren, Steigern, Kreieren) werden neue Marktgrenzen definiert.
Ist die Blue-Ocean-Strategy auch für KMU geeignet?
Ja, die Arbeit untersucht den praktischen Nutzen der Strategie sowohl für Großunternehmen als auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Dienstleister.
Welche Kritik gibt es an der Blue-Ocean-Strategy?
Kritiker bemängeln oft die retrospektive Analyse erfolgreicher Fälle und die Schwierigkeit, die Theorie prospektiv auf komplexe Märkte anzuwenden.
- Arbeit zitieren
- Raphael Zeller (Autor:in), 2020, Das Blue-Ocean-Konzept als Ansatz innovativer Produktentwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127770