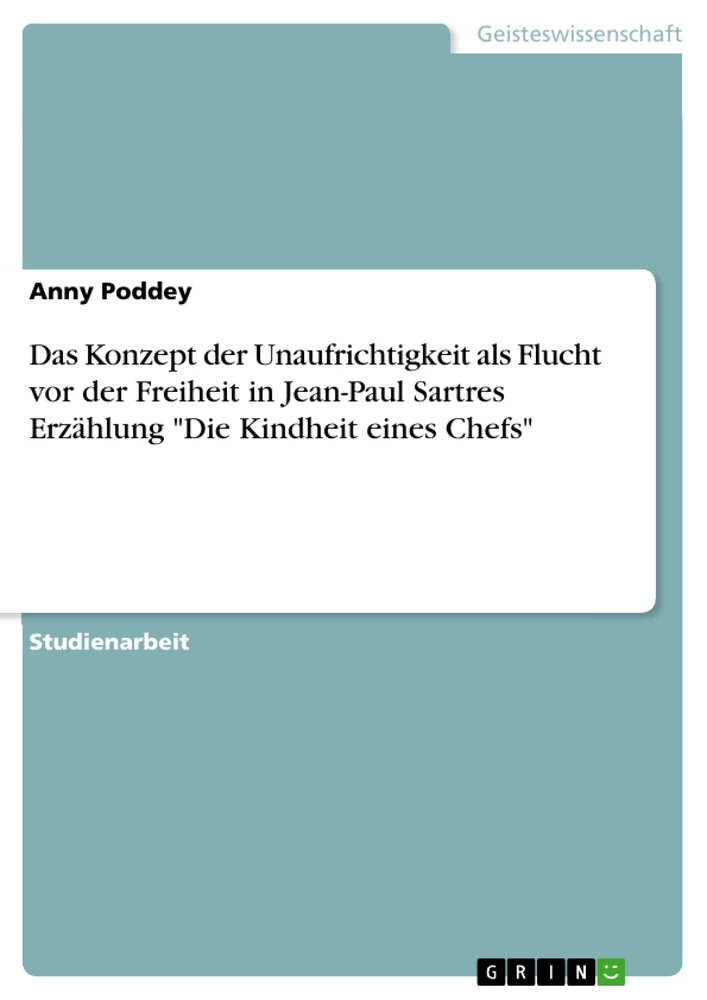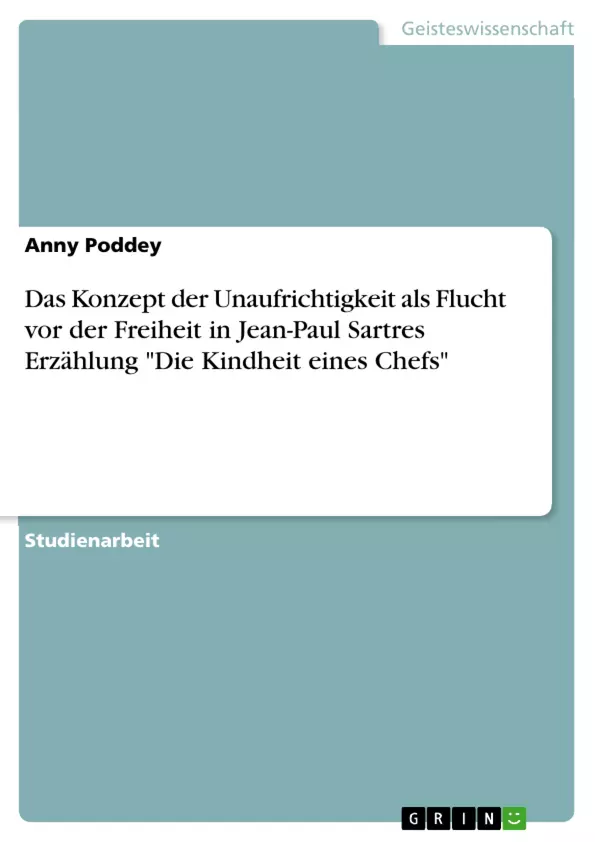Die Freiheit als Grund zur Verzweiflung trifft in der Literatur nicht nur den jungen Werther – auch eine andere Romanfigur sieht sich vor der eigenen Freiheit stehen und der Frage, was damit anzufangen sei. Lucien Fleurier, Protagonist der Erzählung "Die Kindheit eines Chefs" von Jean-Paul Sartre, wählt den Weg in die Unaufrichtigkeit. Indem er sich selbst verdinglicht, zu einem Rechtsextremen wird, scheint er den Ausweg aus dieser immer wiederkehrenden unbehaglichen Ungeduld gefunden zu haben. Warum dieser Weg jedoch einer der Unaufrichtigkeit ist, ist Gegenstand dieser Arbeit.
Jean-Paul Sartre, einer der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, gründet mit der Frage nach der grundlegenden Freiheit des Menschen eine neue philosophische Strömung – den Existenzialismus. In dieser Philosophie geht es um nichts weniger, als den zur Freiheit verurteilten Menschen, der sich vor seiner eigenen Existenz wiederfindet,
mit der Verantwortung, sich selbst zu entwerfen. Grundlage dieser Arbeit wird Sartres Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“ sowie die Erzählung "Die Kindheit eines Chefs" sein.
Zunächst wird allgemein der Versuch einer phänomenologischen Ontologie Sartres vorgestellt, der sich in einer Differenzierung zweier Seinsbereiche gründet – dem "An-Sich-Sein" und dem "Für-Sich-Sein". Aus der Bestimmung des Für-Sich-Seins ergibt sich der Freiheitsbegriff Sartres, der sich aus der Faktizität und Transzendenz der menschlichen Realität speist. Offenbart in dem Gefühl der Angst, wird die Freiheit zu einem Zustand, dem beispielsweise durch die Unaufrichtigkeit zu entgehen versucht wird. Diese Kernaspekte der existenzialistischen Philosophie Sartres werden schließlich auf den Werde-, Verhaltens-, und Gedankengang des Lucien Fleurier angewendet, um ihn als Illustration der Unaufrichtigkeit nachzuzeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Phänomenologische Ontologie
- 2.1 An-Sich-Sein und Für-Sich-Sein
- 2.2 Freiheit
- 2.3 Freiheitsbewusstsein
- 2.4 Unaufrichtigkeit
- 3. Die Kindheit eines Chefs
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Sartres Konzept der Unaufrichtigkeit als Flucht vor der Freiheit, anhand der Erzählung "Die Kindheit eines Chefs". Ziel ist es, Sartres existenzialistische Philosophie, insbesondere seine phänomenologische Ontologie, zu erläutern und deren Anwendung auf den Protagonisten Lucien Fleurier zu analysieren.
- Sartres phänomenologische Ontologie und die Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein
- Der Freiheitsbegriff bei Sartre und die damit verbundene Angst
- Das Konzept der Unaufrichtigkeit als Fluchtmechanismus vor der Freiheit
- Analyse des Protagonisten Lucien Fleurier und seines Weges in die Unaufrichtigkeit
- Die Relevanz von Sartres Philosophie für das Verständnis menschlicher Existenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Unaufrichtigkeit als Flucht vor der Freiheit bei Lucien Fleurier in Sartres Erzählung "Die Kindheit eines Chefs" vor. Sie verortet die Arbeit im Kontext des Existenzialismus und kündigt die methodische Vorgehensweise an, die auf Sartres phänomenologischer Ontologie und der Analyse des Protagonisten basiert. Goethes Werther wird als literarische Parallele zur Auseinandersetzung mit der Freiheit erwähnt, um die Aktualität des Themas zu verdeutlichen. Die Arbeit verspricht eine Analyse der existenzialistischen Grundprinzipien und deren Illustration durch die Figur Lucien Fleurier.
2. Phänomenologische Ontologie: Dieses Kapitel beschreibt Sartres phänomenologische Ontologie, die auf der Unterscheidung zwischen "An-sich-Sein" und "Für-sich-Sein" basiert. Das "An-sich-Sein" bezeichnet die objektive, in sich ruhende Existenz, während das "Für-sich-Sein" das menschliche Bewusstsein charakterisiert, das sich seiner selbst bewusst ist und in einer ständigen Beziehung zu sich selbst steht. Der Unterschied liegt in der Reflexivität und der Fähigkeit zur Negation, die dem "Für-sich-Sein" eigen sind. Aus dieser Differenzierung leitet Sartre seinen Freiheitsbegriff ab, der untrennbar mit der menschlichen Existenz verbunden ist und als grundlegende Bedingung des menschlichen Daseins verstanden wird. Dieses Kapitel legt die philosophischen Grundlagen für die spätere Analyse von Lucien Fleuriers Verhalten.
2.1 An-Sich-Sein und Für-Sich-Sein: Dieser Abschnitt vertieft die Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein. Das An-sich-Sein wird als reine, unreflektierte Existenz dargestellt, während das Für-sich-Sein durch seine Reflexivität und die Fähigkeit zur Negation charakterisiert wird. Die Nicht-Identität mit sich selbst, die dem Für-sich-Sein eigen ist, wird als Grundlage der menschlichen Freiheit hervorgehoben. Der Abschnitt betont die Bedeutung des "Nichts" als konstitutives Element des menschlichen Bewusstseins und die daraus resultierende Spannung zwischen der menschlichen Freiheit und der Faktizität der Existenz. Die existenzielle Freiheit des Menschen, seine Möglichkeit der Selbstgestaltung und die damit verbundene Verantwortung werden hier fundiert.
2.2 Freiheit: In diesem Abschnitt wird Sartres Freiheitsbegriff im Detail erläutert. Die Freiheit wird nicht als etwas verstanden, das man wählen kann, sondern als eine existenzielle Bedingung des menschlichen Daseins. Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt, er ist frei, auch wenn er diese Freiheit nicht will. Die Freiheit ist untrennbar mit der Zeitlichkeit der menschlichen Existenz verbunden: Sie ist die Möglichkeit, sich selbst in der Zukunft zu wählen und zu gestalten. Die Spannung zwischen der Freiheit und der Faktizität, der Gegebenheit der Existenz, wird als zentrales Thema hervorgehoben. Der Mensch ist frei, aber gleichzeitig auch an seine konkrete Situation gebunden. Diese Spannung bildet den Hintergrund für das spätere Verständnis von Lucien Fleuriers Handeln.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Kindheit eines Chefs" und Sartres Philosophie
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Sartres Konzept der Unaufrichtigkeit als Flucht vor der Freiheit anhand der Erzählung "Die Kindheit eines Chefs" von Sartre. Sie untersucht, wie der Protagonist Lucien Fleurier mit seiner Freiheit umgeht und wie dies mit Sartres existenzialistischen Ideen zusammenhängt.
Welche Aspekte von Sartres Philosophie werden behandelt?
Der Hauptfokus liegt auf Sartres phänomenologischer Ontologie, insbesondere der Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein. Weiterhin wird sein Freiheitsbegriff und das Konzept der Unaufrichtigkeit als Fluchtmechanismus vor der Verantwortung der Freiheit detailliert erläutert.
Wie wird Sartres Philosophie auf die Erzählung angewendet?
Die Arbeit analysiert das Verhalten des Protagonisten Lucien Fleurier im Lichte von Sartres Philosophie. Es wird untersucht, wie sich Fleuriers Entscheidungen und Handlungen im Kontext der existenzialistischen Konzepte von Freiheit, Verantwortung und Unaufrichtigkeit erklären lassen.
Was ist die Bedeutung der Unterscheidung zwischen "An-sich-Sein" und "Für-sich-Sein"?
"An-sich-Sein" beschreibt die objektive, in sich ruhende Existenz, während "Für-sich-Sein" das menschliche Bewusstsein bezeichnet, das sich seiner selbst bewusst ist und reflexiv mit sich selbst in Beziehung steht. Diese Unterscheidung ist grundlegend für Sartres Verständnis von Freiheit und Verantwortung.
Wie definiert Sartre Freiheit?
Sartre versteht Freiheit nicht als optionale Wahlmöglichkeit, sondern als existenzielle Bedingung des menschlichen Daseins. Der Mensch ist "zur Freiheit verurteilt", er ist frei, auch wenn er diese Freiheit nicht will. Diese Freiheit ist mit der Zeitlichkeit und der Verantwortung für die eigenen Entscheidungen verbunden.
Was ist das Konzept der Unaufrichtigkeit bei Sartre?
Unaufrichtigkeit wird als Fluchtmechanismus vor der Angst und der Verantwortung der Freiheit verstanden. Der Mensch versucht, sich der Freiheit zu entziehen, indem er sich in vorgegebenen Rollen und Strukturen versteckt und somit seine authentische Existenz verleugnet.
Welche Rolle spielt Lucien Fleurier in der Analyse?
Lucien Fleurier dient als Fallstudie, um Sartres philosophische Konzepte zu illustrieren. Seine Entwicklung und seine Entscheidungen werden analysiert, um zu zeigen, wie sich die existenzialistischen Prinzipien in der Praxis manifestieren und welche Konsequenzen sie haben.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur phänomenologischen Ontologie (mit Unterkapiteln zu An-sich-Sein/Für-sich-Sein und Freiheit), ein Kapitel zu "Die Kindheit eines Chefs" und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte von Sartres Philosophie und deren Anwendung auf die Erzählung.
Welche weiteren literarischen Bezüge werden hergestellt?
Goethes Werther wird als literarische Parallele zur Auseinandersetzung mit der Freiheit und der damit verbundenen Problematik erwähnt, um die Aktualität des Themas zu verdeutlichen.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
(Der Inhalt des Fazits ist in der gegebenen Vorschau nicht explizit aufgeführt. Das Fazit würde die Ergebnisse der Analyse zusammenfassen und die Relevanz von Sartres Philosophie für das Verständnis menschlicher Existenz bewerten.)
- Quote paper
- Anny Poddey (Author), 2021, Das Konzept der Unaufrichtigkeit als Flucht vor der Freiheit in Jean-Paul Sartres Erzählung "Die Kindheit eines Chefs", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127774