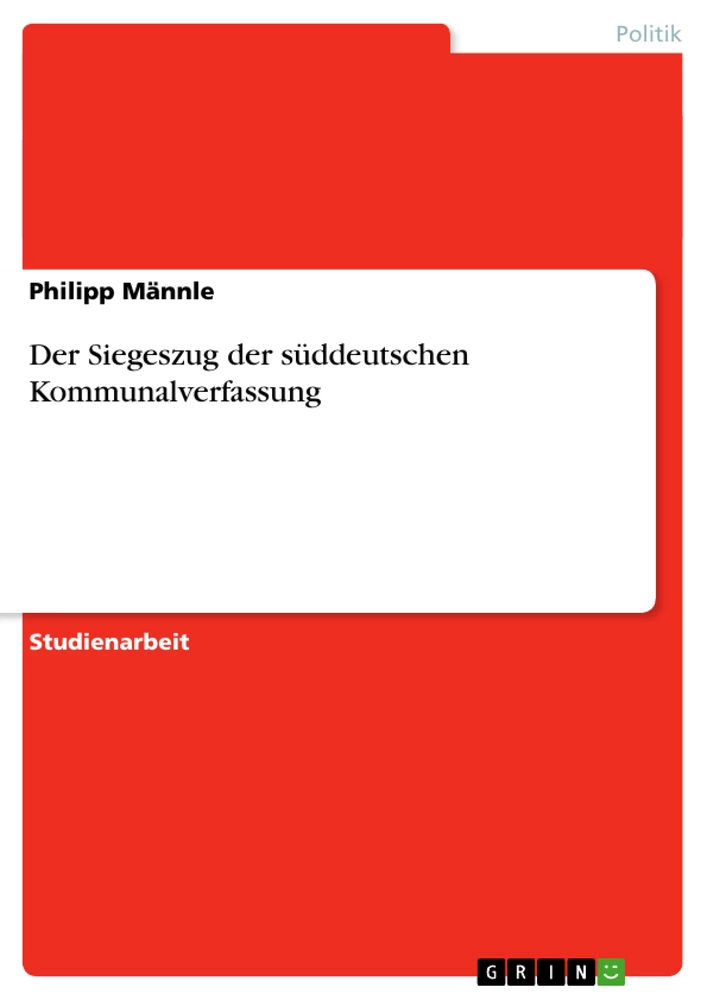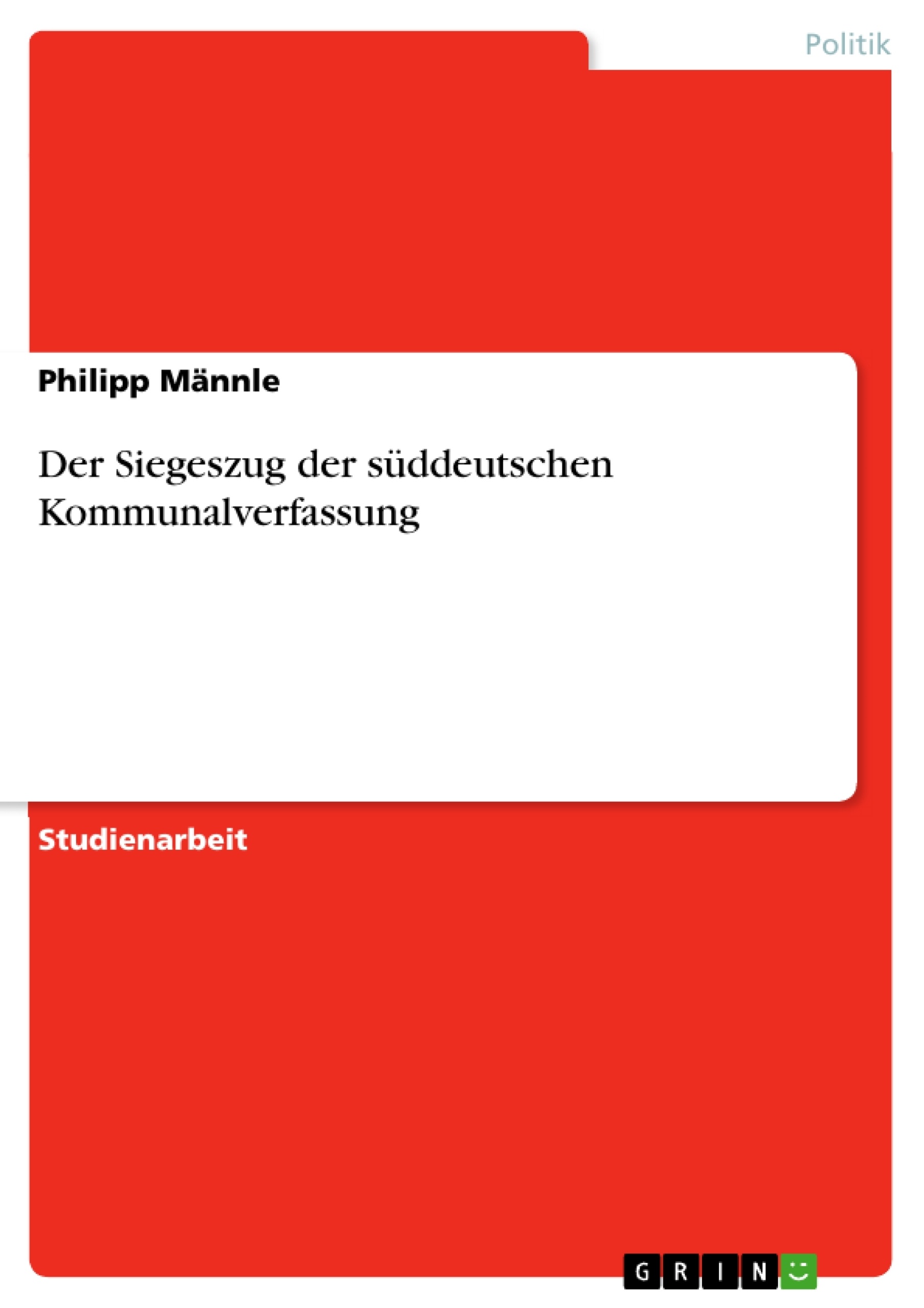Städte und Gemeinden spielten in der deutschen Geschichte stets eine prominente Rolle. Die verfassungsmäßig garantierte Kommunale Selbstverwaltung ist heute für die Organisation der Bundesrepublik ebenso maßgeblich wie der Föderalismus: Die Bundesstaatlichkeit ist historische Folge der Territorialstaatstradition, die Kommunale Selbstverwaltung gilt darüber hinaus gar als die nationale, identitätsstiftende Tradition schlechthin.
Infolge der föderalen Gliederung Deutschlands sind die Kommunen unterschiedlich, abhängig von der jeweiligen Gemeindeordnung des Landes, verfasst. Ab den 1970er Jahren wurde auf diesem Feld ein »Wettbewerb der Kommunalsysteme« virulent, und im Verlauf der 1990er Jahre wurden etliche Gemeindeordnungen in Nord-, Ost- und Westdeutschland reformiert. Die Reformen orientierten sich vor allem an den süddeutschen Gemeindeordnungen. Franz-Ludwig Knemeyer hat dies als »Siegeszug der Süddeutschen Gemeindeverfassung« bezeichnet. Diese institutionellen Reformen der sogenannten »inneren Kommunalverfassung« sind
sozialwissenschaftlich deshalb interessant, weil neben der Frage, warum die Reformen überhaupt vorgenommen wurden, vor allem der angesprochene Siegeszug des süddeutschen Typus bemerkenswert ist.
Im Rahmen einer neo-institutionalistischen Analyse wird dieser »Siegeszug« genauer untersucht, um letztlich zu bestimmen, weshalb alle Reformen ähnliche strukturelle Änderungen vorsahen, und warum heute die sogenannte »duale Rat-Bürgermeister-Verfassung« als vorherrschendes Modell unter den deutschen Gemeindeordnungen ausgemacht
werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- I. Der Siegeszug der süddeutschen Kommunalverfassung - Einführung
- II. Entstehung und Entwicklung der deutschen Kommunalverfassungen
- II.1. Historische Entwicklung der deutschen Gemeindeordnungen
- II.2. Die Kommunalverfassungsreformen der neunziger Jahre
- II.2.1. Kommunale Führungsfunktionen
- II.2.2. Legitimations- und Partizipationsfunktionen
- II.3. Die deutschen Kommunalverfassungen im systematischen Überblick
- II.4. Tendenzen und Hintergründe der Reformen
- III. Rationalität als Mythos - Der Neo-Institutionalismus
- III.1. Die neo-institutionalistische Schule
- III.2. Mythen, Isomorphismus und Heuchelei
- III.3. Neo-institutionalistische Theoriebausteine in der Zusammenfassung
- IV. Rationalität und Heuchelei in der Kommunalpolitik - Synthese
- IV.1. Der Bürgermeister – Charisma und Kompetenzstruktur
- IV.1.1. Bündelung von Führungsfunktionen als Rationalitätsmythos
- IV.1.2. Wahl und Abwahl des (Ober-)Bürgermeisters
- IV.2. Der Rat und die Parteien
- IV.2.1. Rationale Selektion durch Kumulieren und Panaschieren
- IV.2.2. Kommunale Parteipolitik und politische Kultur
- IV.3. Publikum und Partizipation - Demokratisierung vs. >>talk<<
- IV.3.1. Legitimation durch Wahlen
- IV.3.2. Kommunale Referenden
- IV.1. Der Bürgermeister – Charisma und Kompetenzstruktur
- V. Der Siegeszug als Isomorphismus - Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Siegeszug der süddeutschen Kommunalverfassung in den 1990er Jahren. Ziel ist es, die Gründe für die weitreichenden Reformen der Gemeindeordnungen in Nord-, Ost- und Westdeutschland und die Dominanz des süddeutschen Modells zu erklären. Dies geschieht anhand einer Analyse der historischen Entwicklung und unter Einbezug der neo-institutionalistischen Organisationstheorie.
- Historische Entwicklung der deutschen Gemeindeordnungen
- Kommunalverfassungsreformen der 1990er Jahre
- Neo-institutionalistische Organisationstheorie
- Vergleich süddeutscher und norddeutscher Kommunalverfassungen
- Analyse von Rationalität und Heuchelei in der Kommunalpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Der Siegeszug der süddeutschen Kommunalverfassung – Einführung: Dieses einführende Kapitel beschreibt den Kontext der Arbeit. Es hebt die Vielfalt der deutschen Kommunalverfassungen hervor und stellt die Frage nach dem "Siegeszug" der süddeutschen Modelle in den 1990er Jahren. Es werden die zentralen Forschungsfragen formuliert und der Aufbau der Arbeit skizziert, der die historische Entwicklung der Gemeindeordnungen, die neo-institutionalistische Theorie und deren Anwendung auf die Reformen umfasst.
II. Entstehung und Entwicklung der deutschen Kommunalverfassungen: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der deutschen Kommunalverfassungen im Kontext des Föderalismus. Es zeigt, wie die nachnapoleonischen Gemeindeordnungen, beeinflusst von preußischen und bayerischen Modellen, zu einer Vielfalt an Systemen führten, die sich im Norden und Osten eher am preußischen Zweikörpersystem, im Süden und Südwesten am bayerischen Einkörpersystem orientierten. Die Länderkompetenz und die Ausprägungen nach dem Zweiten Weltkrieg werden ebenfalls diskutiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Der Siegeszug der süddeutschen Kommunalverfassung
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Siegeszug der süddeutschen Kommunalverfassung in den 1990er Jahren. Sie erklärt die Gründe für die weitreichenden Reformen der Gemeindeordnungen in Nord-, Ost- und Westdeutschland und die Dominanz des süddeutschen Modells.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der deutschen Kommunalverfassungen und bezieht die neo-institutionalistische Organisationstheorie mit ein, um die Reformen zu erklären.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der deutschen Gemeindeordnungen, die Kommunalverfassungsreformen der 1990er Jahre, die neo-institutionalistische Organisationstheorie, einen Vergleich süddeutscher und norddeutscher Kommunalverfassungen und eine Analyse von Rationalität und Heuchelei in der Kommunalpolitik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel I bietet eine Einführung, Kapitel II behandelt die Entstehung und Entwicklung der deutschen Kommunalverfassungen, Kapitel III beschäftigt sich mit dem Neo-Institutionalismus, Kapitel IV synthetisiert Rationalität und Heuchelei in der Kommunalpolitik und Kapitel V bietet eine Schlussfolgerung.
Welche Aspekte der historischen Entwicklung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die nachnapoleonischen Gemeindeordnungen, den Einfluss preußischer und bayerischer Modelle, die Vielfalt der Systeme im Norden und Süden Deutschlands, die Länderkompetenz und die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg.
Welche Rolle spielt der Neo-Institutionalismus?
Der Neo-Institutionalismus dient als theoretischer Rahmen, um die Reformen und den Erfolg des süddeutschen Modells zu erklären. Die Arbeit analysiert Mythen, Isomorphismus und Heuchelei im Kontext der Kommunalpolitik.
Welche Aspekte der Kommunalpolitik werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Rolle des Bürgermeisters (Führungsfunktionen, Wahl und Abwahl), den Gemeinderat und die Parteien (Kumulieren und Panaschieren, Parteipolitik), sowie das Publikum und die Partizipation (Demokratisierung, Referenden).
Was ist die zentrale Fragestellung?
Die zentrale Frage ist: Warum setzte sich das süddeutsche Kommunalverfassungsmodell in den 1990er Jahren in weiten Teilen Deutschlands durch?
Was ist die Schlussfolgerung der Arbeit (Conclusio)?
Die Schlussfolgerung (Kapitel V) fasst die Ergebnisse zusammen und interpretiert den "Siegeszug" des süddeutschen Modells als Isomorphismus im neo-institutionalistischen Sinne.
- Arbeit zitieren
- Dipl.Verw.wiss.; M.A. Philipp Männle (Autor:in), 2006, Der Siegeszug der süddeutschen Kommunalverfassung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112779