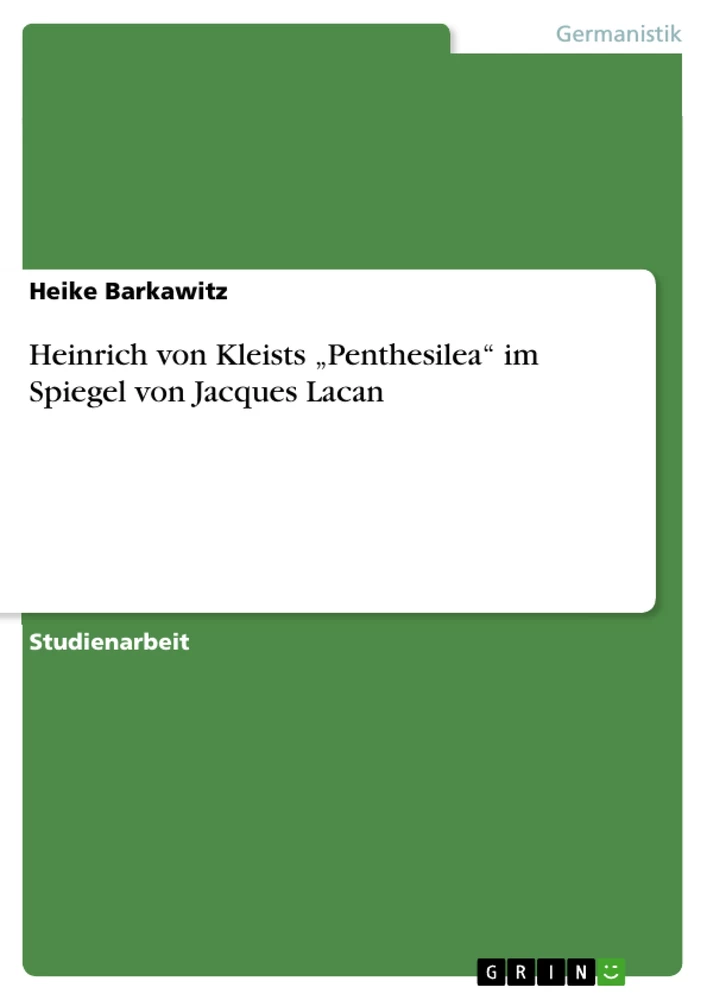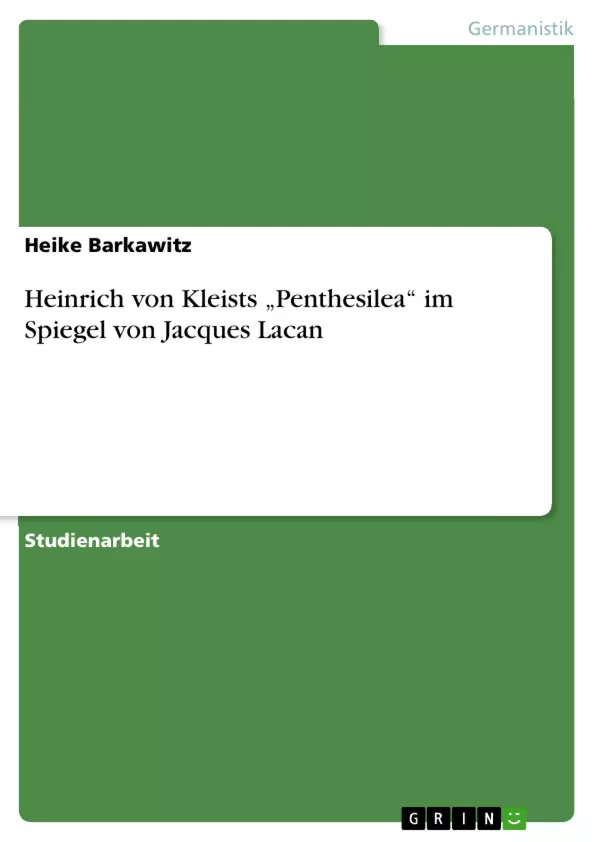Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Heinrich von Kleists Drama „Penthesilea“ in Bezugnahme auf die Psychoanalyse Jacques Lacans. Kleists „Penthesilea“ weist eine tiefenpsychologische Dimension auf, in der kriegerische und erotische Sprachbilder verschränkt sind. Er zeigt auf eindringliche Weise das Drama einer Welt, die durch verschiedene Sprachen gespalten ist und daher keine sinnstiftende Einheit als Grundlage einer Verständigung bietet. Diese Tragik mit sprachanalytischen Thesen von Jacques Lacan zu veranschaulichen, ist das Ziel der Arbeit.
Zentrum der Lacanschen Lesart von Kleists Drama wird die Konstituierung der Identität Penthesileas und Achilles’ über Sprache sein. Diese ist für die Kommunikation der Charaktere untereinander von entscheidender Bedeutung. Sprache in diesem Zusammenhang kann sowohl nonverbale Kommunikation – wie sie beispielsweise in den sich treffenden Blicken der Hauptcharaktere zum Ausdruck kommt –, verbale Kommunikation als auch eine Instrumentalisierung von Sprache als Waffe bedeuten.
Der erste Teil der Arbeit (Kapitel 2.) beschäftigt sich mit Lacans Aufsatz „Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint“ und dient als theoretische Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit Kleists „Penthesilea“ und Lacan. Allerdings sollen darüber hinaus auch folgende Fragen berücksichtigt werden: Wie konstituiert sich die Identität der Hauptcharaktere über die Spiegelung im jeweils anderen? Wie kommunizieren Penthesilea und Achilles über ihre Blicke? Der Aufsatz bereitet außerdem weitere Theorien Lacans vor. So deutet zum Beispiel das Sich-Spiegeln im Blick des anderen darauf hin, dass dieser zum Objekt des Begehrens wird.
Im zweiten Teil der Arbeit (Kapitel 3.) wird eine Analyse vor dem Hintergrund einer Mitschrift von Lacans Vorlesung „Vom Blick als Objekt klein a“ vorgenommen. Hierbei interessiert insbesondere, inwiefern Achilles oder dessen Blick für Penthesilea als „Objekt klein a“ fungiert (Kapitel 3.1) oder ob Achilles doch eher als „großer Anderer“ oder als Vaterersatz für Penthesilea auftritt (Kapitel 3.2).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kleists,,Penthesilea“ und Lacans Spiegelstadium-Aufsatz
- Objekt des Begehrens
- Achilles als „Objekt klein a“
- Achilles als „großer Anderer“
- Die Sprache in Kleists „Penthesilea“
- Sprache als Distinktes
- Tötung durch Sprache
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Drama „Penthesilea“ im Kontext der Psychoanalyse Jacques Lacans. Das Ziel ist es, die tiefenpsychologische Dimension des Dramas zu beleuchten, in der kriegerische und erotische Sprachbilder verschmelzen. Die Arbeit untersucht, wie die gespaltene Welt des Dramas, die durch verschiedene Sprachen geprägt ist, eine tragische Unfähigkeit zur Verständigung erzeugt. Die Analyse konzentriert sich auf die Konstituierung der Identität von Penthesilea und Achilles durch Sprache und die Bedeutung der Kommunikation zwischen den Charakteren.
- Die Rolle des Spiegelstadiums in der Konstituierung der Identität von Penthesilea und Achilles
- Die Bedeutung von Blicken und nonverbale Kommunikation im Drama
- Die Funktion von Achilles als „Objekt klein a“ und „großer Anderer“ für Penthesilea
- Die Rolle der Sprache in der Selbstzerstörung Penthesileas
- Die Bedeutung der „Vaterfrage“ im Kontext der Lacanschen Psychoanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit Lacans Aufsatz „Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint“. Dieser Aufsatz dient als theoretische Grundlage für die Analyse von Kleists „Penthesilea“ und untersucht, wie die Identität der Hauptcharaktere durch die Spiegelung im jeweils anderen konstituiert wird. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung von Blicken als Form der Kommunikation und die Entstehung des Begehrens durch die Spiegelung im Blick des anderen.
Das zweite Kapitel analysiert Kleists „Penthesilea“ vor dem Hintergrund von Lacans Vorlesung „Vom Blick als Objekt klein a“. Es untersucht, inwiefern Achilles oder dessen Blick für Penthesilea als „Objekt klein a“ fungiert und ob Achilles eher als „großer Anderer“ oder als Vaterersatz für Penthesilea auftritt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Sprache im Drama und untersucht, ob Sprache für Penthesilea etwas Distinktes bedeutet und wie sie durch Sprache ihre eigene Existenz als Subjekt aufgibt. Das Kapitel analysiert die Rolle der Sprache in der Selbstzerstörung Penthesileas im Kontext der Lacanschen Psychoanalyse, die die Sprache als Mittel der Konstituierung des Subjekts durch die Instanz des Vaters betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Heinrich von Kleist, Penthesilea, Jacques Lacan, Spiegelstadium, Objekt klein a, großer Anderer, Sprache, Kommunikation, Identität, Selbstzerstörung, Vaterfrage, Psychoanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Kleists „Penthesilea“?
Das Drama handelt von der tragischen Begegnung zwischen der Amazonenkönigin Penthesilea und dem griechischen Helden Achilles, in der Liebe und Krieg gewaltsam verschmelzen.
Was ist Lacans „Spiegelstadium“?
Es beschreibt die Phase der Identitätsbildung, in der sich ein Subjekt erstmals in einem Bild (Spiegel) erkennt und so eine (oft trügerische) Einheit des Ichs konstituiert.
Was bedeutet „Objekt klein a“ bei Lacan?
Es bezeichnet das unerreichbare Objekt des Begehrens. Im Drama fungiert Achilles für Penthesilea als dieses Objekt, das sie zugleich besitzen und vernichten will.
Welche Rolle spielt die Sprache im Drama?
Sprache dient nicht nur der Verständigung, sondern wird als Waffe eingesetzt. Das Scheitern der Kommunikation zwischen den Kulturen führt letztlich zur Selbstzerstörung der Protagonistin.
Wie wird Penthesileas Identität durch Blicke geprägt?
Die Identität der Charaktere konstituiert sich über die Spiegelung im Blick des anderen. Der Blick des Achilles wird für Penthesilea zum fixierenden Moment ihres Begehrens und ihres Untergangs.
- Quote paper
- Heike Barkawitz (Author), 2008, Heinrich von Kleists „Penthesilea“ im Spiegel von Jacques Lacan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112791