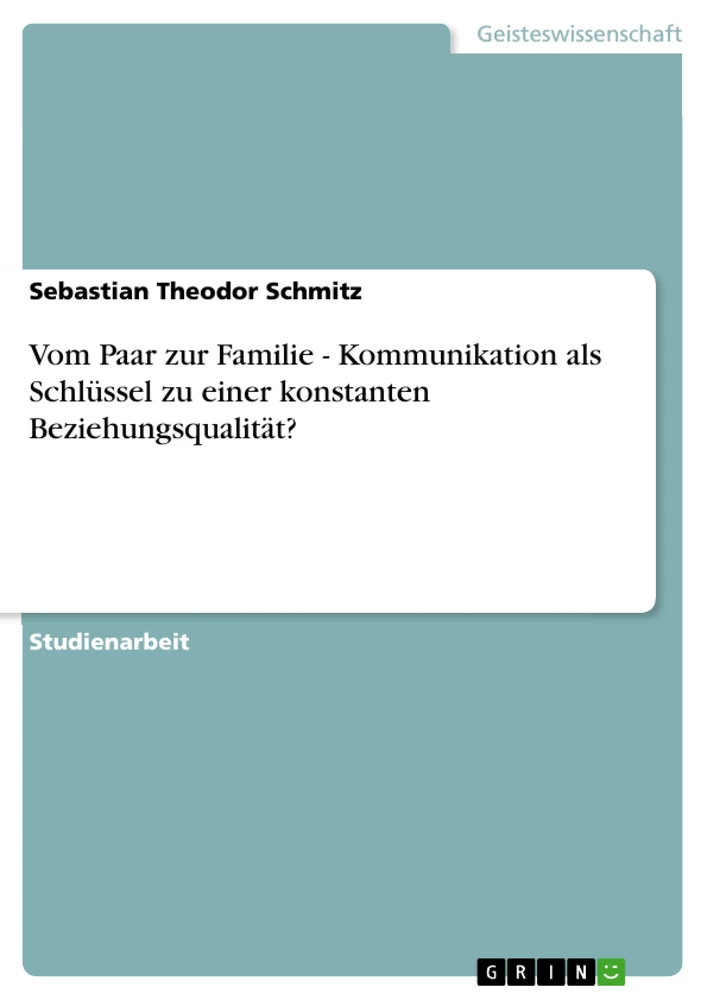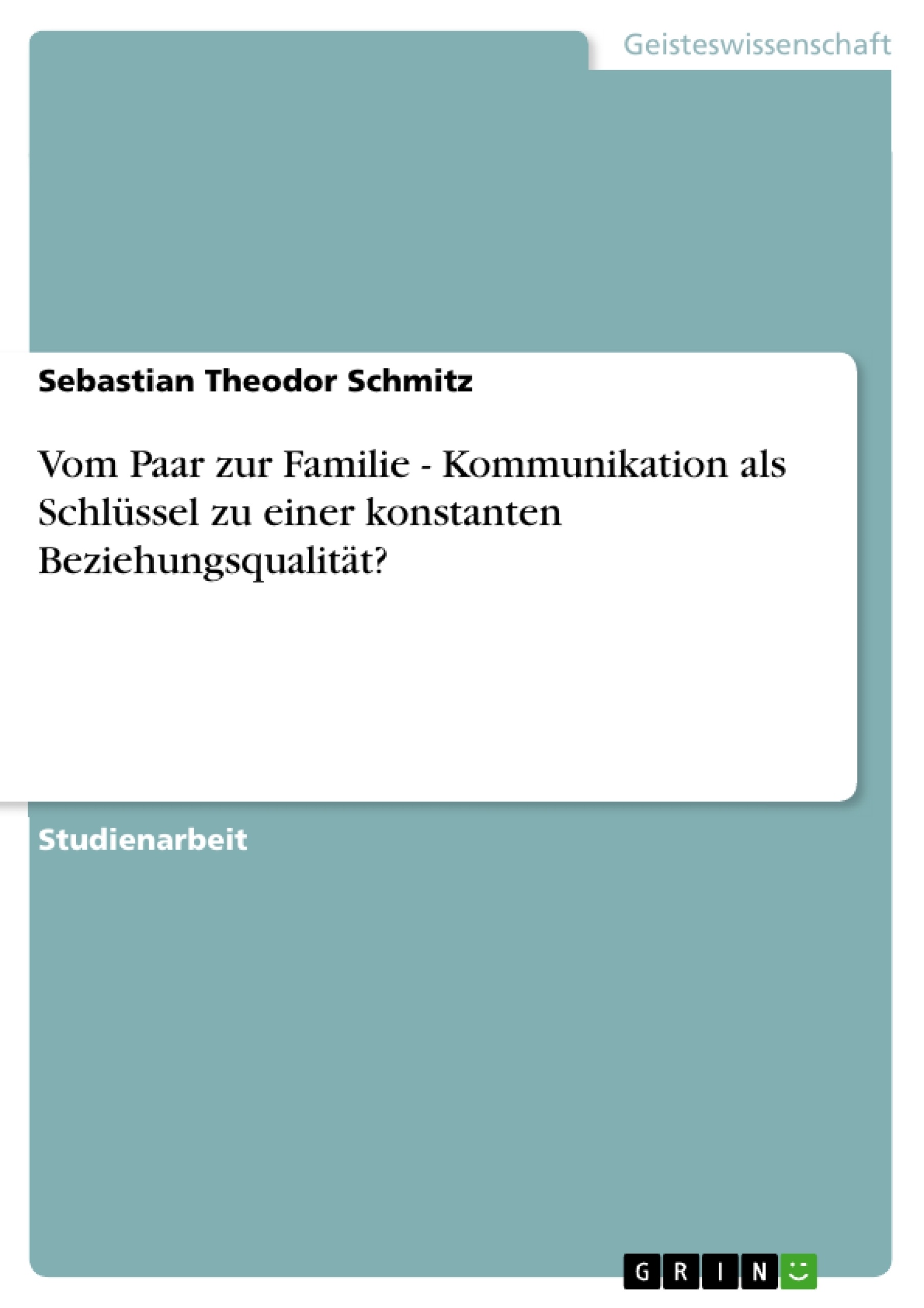Der Übergang zur Elternschaft ist in der Biographie von Paaren ein besonders einschneidendes Ereignis. Routinen, die sich in der Dyade bewährt haben mögen, greifen in der Triade nicht mehr. Das Kind, das als neuer, dritter Faktor auftritt, zwingt die Eltern zu einer stärkeren Zusammenarbeit. Der Raum, der den Eltern vormals zur freien Gestaltung eigenen Handelns zur Verfügung steht, wird nun enger. Die Betreuung des Kindes erfordert einen hohen Aufwand an die Ressourcen beider Elternteile (vgl. Fthenakis et al. 1998: 2). Um eigene Bedürfnisse, die Partnerschaft und die Pflege des Kindes gleichermaßen wahrzunehmen und zu balancieren, ist insbe-sondere die Konfliktfähigkeit der Partner von entscheidender Bedeutung, da in vielen Fällen von divergierenden Interessen ausgegangen werden kann (vgl. Arránz Becker und Rüssmann 2003: 186). Die kommunikative Fähigkeit Probleme so zu thematisieren und zu lösen, dass die Beziehungsqualität nicht darunter leidet, erscheint als entscheidender Faktor, der den Übergang zur Elternschaft und schließlich das Zusammenleben als Triade, prägt (vgl. Engl und Thurmaier 2003: 264). Die vorliegende Arbeit unterstreicht die These, dass die partnerschaftlichen Kommunikationsstile eine Schlüsselfunktion für die Beziehungsqualität darstellen, was für die Phase des Übergangs zur Elternschaft in noch stärkerem Maß gilt (vgl. Arránz Becker und Rüssmann 2003: 191). Die Leitfrage lautet: Wie kann den besonderen Anforderungen der Elternschaft begegnet werden, so dass die Beziehungsqualität positiv beeinflusst wird? Zunächst wird im ersten Kapitel in den Problemhorizont eingeführt. Hierbei interessiert besonders die Frage, inwiefern der Eintritt in die Elternschaft die Konflikthäufigkeit und die Zufriedenheit mit dem Partner beeinflusst. Darauf aufbauend soll näher erläutert werden, welche neuen Einflussfaktoren nach dem Übergang zur Triade auf die Partnerschaftszufriedenheit einwirken. Der Übergang zur Triade führt neue geschlechtsspezifische Rollenmuster ein, die oft einen tiefen Eingriff in die partnerschaftliche Interaktion vornehmen. Diesen wird ein zweites Kapitel gewidmet. Eine weitere für die Beziehungsqualität von jungen Eltern wichtige Bedeutung fällt der Veridikalität des Partnerkonzeptes zu, die in einem dritten Kapitel behandelt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1 Problemstellung
- 1.1 Soziologische Ansätze
- 1.2 Psychologische Ansätze
- 1.3 Partnerschaftsentwicklung nach Fthenakis
- 1.4 Zwischenfazit
- 2 Traditionalisierung der Geschlechtsrollen
- 3 Veridikalität des Partnerkonzepts
- 4 Trainingsprogramme für die Partnerschaftskommunikation
- 4.1 Konzeptionen
- 4.2 Zehn wichtige Kommunikationsregeln
- 4.2.1 Fertigkeiten der Sprecherrolle
- 4.2.2 Fertigkeiten der Zuhörerrolle
- 4.3 EPL - Ein Partnerschaftliches Lernprogramm
- 4.3.1 Inhalte und Ziele des EPL
- 4.4 KEK - Konstruktive Ehe und Kommunikation
- 4.4.1 Inhalte und Ziele von KEK
- 5 Fazit
- 6 Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Kommunikation für den Beziehungserfolg im Übergang vom Paar zur Familie. Sie untersucht, wie die kommunikativen Fähigkeiten von Paaren die Beziehungsqualität im Kontext der Elternschaft beeinflussen und welche Herausforderungen und Chancen sich in dieser Phase ergeben.
- Einfluss des Übergangs zur Elternschaft auf die Beziehungsqualität
- Soziologische und psychologische Ansätze zur Erklärung der Beziehungsentwicklung
- Rolle von Geschlechtsrollen und Partnerkonzepten in der Partnerschaftsdynamik
- Kommunikationsstrategien und -trainings zur Steigerung der Beziehungsqualität
- Bedeutung von Konfliktfähigkeit und Ressourcenmanagement für die Bewältigung der Elternschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik des Übergangs zur Elternschaft und der damit verbundenen Veränderungen in der Beziehungsqualität. Es wird auf empirische Befunde der LBS-Familienstudie verwiesen, die einen signifikanten Rückgang der Partnerschaftszufriedenheit nach der Geburt des ersten Kindes belegen.
Im ersten Kapitel werden soziologische und psychologische Ansätze zur Erklärung dieser Entwicklung vorgestellt. Soziologische Theorien wie der Familienzyklus und Belastungstheorien betrachten die Elternschaft als eine Phase mit spezifischen Belastungen und Herausforderungen, die die Beziehungsqualität beeinflussen können. Psychologische Ansätze fokussieren auf die Bedeutung von Kommunikation, Konfliktlösung und Ressourcenmanagement für die Bewältigung der neuen Situation.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Traditionalisierung von Geschlechtsrollen im Kontext der Elternschaft. Es wird diskutiert, wie die neuen Rollenverteilungen die partnerschaftliche Interaktion beeinflussen und zu Konflikten führen können.
Im dritten Kapitel wird die Bedeutung der Veridikalität des Partnerkonzepts für die Beziehungsqualität von jungen Eltern untersucht. Es wird argumentiert, dass eine gemeinsame Vorstellung von der Partnerschaft und den Erwartungen an die Elternschaft die Bewältigung der Herausforderungen erleichtern kann.
Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über Konzepte und Trainings zur Steigerung der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit von Paaren. Es werden verschiedene Programme wie EPL (Ein Partnerschaftliches Lernprogramm) und KEK (Konstruktive Ehe und Kommunikation) vorgestellt, die Paaren helfen können, ihre kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern und die Herausforderungen der Elternschaft besser zu bewältigen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Partnerschaftsqualität, den Übergang zur Elternschaft, die Kommunikation, die Konfliktfähigkeit, die Geschlechtsrollen, das Partnerkonzept, die LBS-Familienstudie, die Beziehungsentwicklung, die Familienkommunikation, die Elternschaft, die Partnerschaftszufriedenheit, die Kommunikationsstrategien, die Konfliktlösung und die Ressourcenmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Warum sinkt die Partnerschaftszufriedenheit oft nach der Geburt des ersten Kindes?
Der Übergang zur Triade bringt neue Belastungen, Schlafmangel und eine notwendige Neuorganisation des Alltags mit sich, was oft zu mehr Konflikten führt.
Was bedeutet „Traditionalisierung der Geschlechtsrollen“ bei jungen Eltern?
Oft fallen Paare nach der Geburt in traditionelle Muster zurück (Mutter Haushalt/Kind, Vater Erwerbsarbeit), selbst wenn sie vorher eine gleichberechtigte Aufteilung geplant hatten.
Wie kann Kommunikation die Beziehungsqualität retten?
Die Fähigkeit, Probleme konstruktiv zu thematisieren und zu lösen, ohne den Partner anzugreifen, gilt als Schlüsselfaktor für eine konstante Beziehungsqualität.
Was sind EPL und KEK?
Das sind spezielle Lernprogramme (EPL: Ein Partnerschaftliches Lernprogramm, KEK: Konstruktive Ehe und Kommunikation), die Paaren helfen, ihre Kommunikationsfertigkeiten zu verbessern.
Was ist die „Veridikalität des Partnerkonzepts“?
Es beschreibt die Übereinstimmung zwischen der Wahrnehmung eines Partners und der tatsächlichen Realität bzw. den Erwartungen des anderen Partners.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Theodor Schmitz (Autor:in), 2008, Vom Paar zur Familie - Kommunikation als Schlüssel zu einer konstanten Beziehungsqualität?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112792