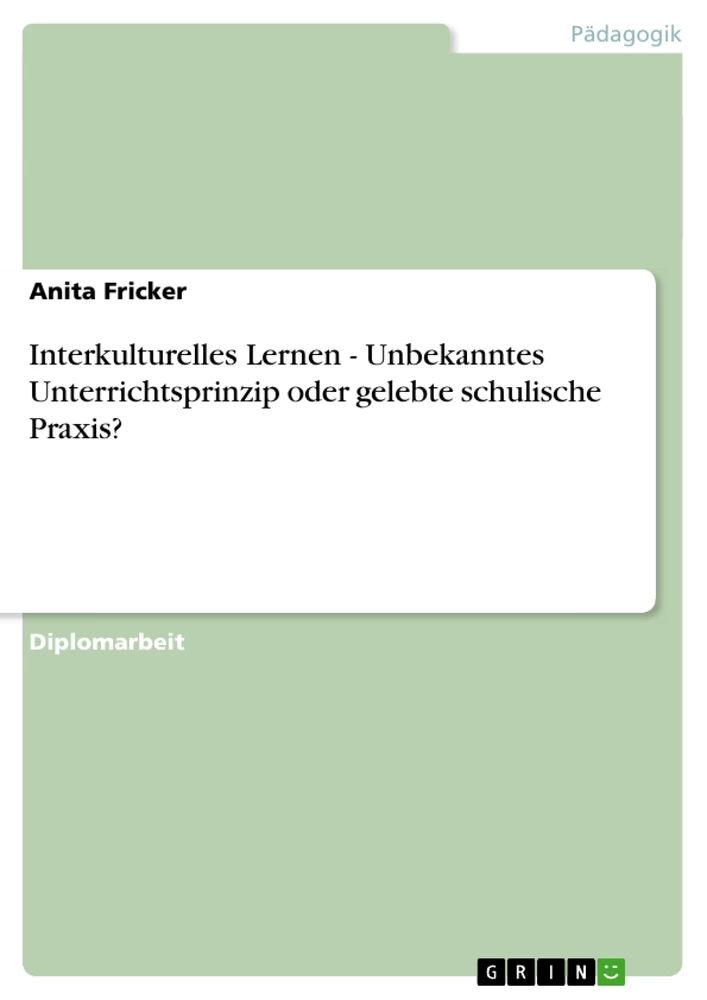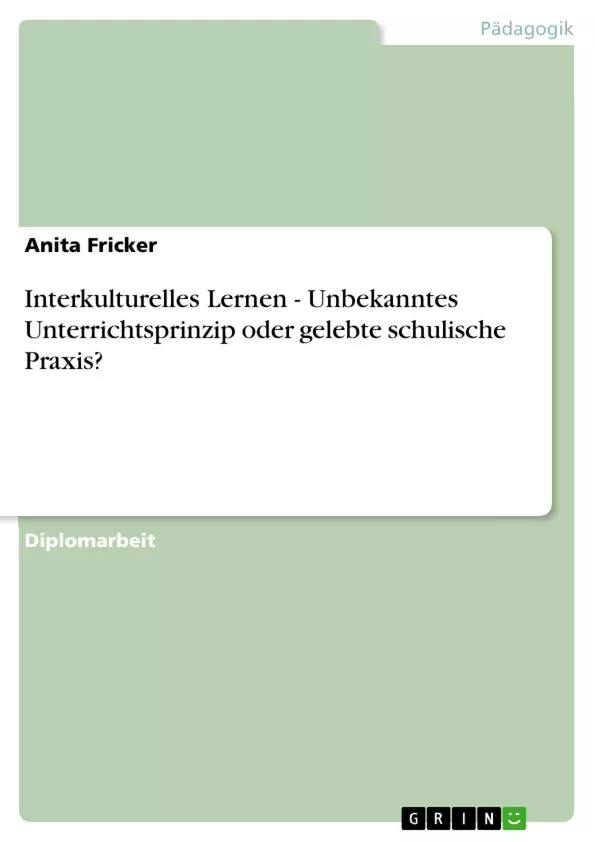Zur Zeit des größten wirtschaftlichen Wachstums in Österreich in den 1960er und
1970er Jahren entstand ein Mangel an Arbeitskräften. Durch die Rekrutierung von
Gastarbeitern aus der Türkei und Jugoslawien versuchte man dieses Problem zu lösen.
Ursprünglich sollten diese Arbeiter für einige Jahre in Österreich arbeiten und
anschließend wieder in ihre Heimat zurückkehren und durch neue ersetzt werden
(Fleck, 2002). Mit der Zeit holten immer mehr Gastarbeiter ihre Familien zu sich
nach Österreich, um sich hier eine neue Existenz aufzubauen. Neben der Zuwanderung der Gastarbeiter führte auch Anfang der 1990er Jahre der Krieg im ehemaligen Jugoslawien dazu, dass Flüchtlinge aus diesem Kriegsgebiet nach Österreich kamen. Daher stellen ZuwanderInnen bzw. Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei die größten Immigrantengruppen in Österreich dar. Die Veränderung des Bevölkerungsbildes in Österreich machte sich auch im Schulalltag bemerkbar. Seit Beginn der 1970er Jahre steigt die Zahl der SchülerInnen mit nicht deutscher Muttersprache, vorallem in Wien, stetig an (Fleck, 2002). Im Schuljahr 2004/2005 (bm:bwk, 2006) hatten 16,7% aller SchülerInnen der allgemein bildenden Pflichtschulen und 10,2% aller SchülerInnen allgemein bildender höherer Schulen in Österreich eine andere Erstsprache als Deutsch. In Wien, wo der Großteil der MigrantInnen lebt, haben 45,9% aller SchülerInnen der allgemein bildenden Pflichtschule eine andere Erstsprache als Deutsch. In den Hauptschulen und Polytechnischen Lehrgängen sind dies die Hälfte aller SchülerInnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Migrationsgeschichte Österreichs und derzeitige Situation
- Welche schulpolitischen Maßnahmen wurden zur Integration gesetzt?
- Überblick über den Aufbau der vorliegenden Arbeit
- 1 Theoretischer Hintergrund
- 1.1 Warum ist Interkulturelles Lernen notwendig?
- 1.1.1 Soziale Beziehungen in multikulturellen Schulklassen
- 1.1.2 Gründe für negative Beziehungen zwischen SchülerInnen unterschiedlicher Kulturen
- 1.1.3 Wie können interkulturelle Freundschaften gefördert werden?
- 1.2 Die Rolle der Lehrkräfte
- 1.2.1 Einfluss der Lehrkräfte
- 1.2.2 Verbesserung von Einstellungen und Verhalten der Lehrkräfte
- 1.3 Interkulturelles Lernen
- 1.3.1 Amerikanische Sicht
- 1.3.2 Die europäische Sicht
- 1.3.3 Die österreichische Sicht
- 1.4 Verankerung des Interkulturellen Lernens im österreichischen Lehrplan
- 1.4.1 Empirische Untersuchung zum Unterrichtsprinzip IKL
- 2 Empirischer Teil
- 2.1 Zielsetzung und Fragestellungen
- 2.2 Untersuchungsdesign
- 2.3 Erhebungsinstrumente
- 2.3.1 SchülerInnenfragebogen
- 2.3.2 LehrerInnenfragebogen
- 2.3.3 Direktoreninterview
- 2.4 Untersuchungsdurchführung
- 2.5 Rahmenbedingungen der beiden Schulen
- 2.5.1 Kooperative Mittelschule A
- 2.5.2 Kooperative Mittelschule B
- 2.6 Stichprobenbeschreibung
- 2.6.1 SchülerInnenstichprobe
- 2.6.2 Stichprobenbeschreibung: LehrerInnen
- 2.7 Itemanalyse und Testgütekriterien
- 2.7.1 Schwierigkeitsindizes und Reliabilitäten
- 2.7.2 Kategorienbildung für den Lehrerfragebogen
- 2.8 Inhaltliche Ergebnisse der Untersuchung
- 2.8.1 Ergebnisse des Wissenstests
- 2.8.2 Zielerreichung in beiden Schulen
- 2.8.3 Ergebnisse des Schulvergleiches
- 2.8.4 Ergebnisse des LehrerInnenfragebogens
- 2.8.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 2.9 Diskussion
- 2.9.1 Diskussion der Ergebnisse der Untersuchung
- 2.9.2 Maßnahmen zur Verbesserung des Interkulturellen Lernens
- Literatur
- A Erhebungsinstrumente
- A.1 SchülerInnenfragebogen
- A.2 LehrerInnenfragebogen
- A.3 Interviewleitfaden
- Zusammenfassung
- Die Bedeutung von IKL in multikulturellen Schulklassen
- Die Rolle der Lehrkräfte bei der Förderung von IKL
- Die Verankerung von IKL im österreichischen Lehrplan
- Die empirische Untersuchung der Umsetzung von IKL in zwei Wiener Schulen
- Die Analyse der Einstellungen und des Wissens von SchülerInnen und LehrerInnen zum Thema IKL
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob Interkulturelles Lernen (IKL) in österreichischen Schulen ein unbekanntes Unterrichtsprinzip oder eine gelebte schulische Praxis ist. Die Arbeit untersucht die Umsetzung von IKL in zwei kooperativen Mittelschulen in Wien und analysiert die Einstellungen und das Wissen von SchülerInnen und LehrerInnen zum Thema.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Interkulturelles Lernen (IKL) in Österreich vor und beleuchtet die aktuelle Situation der Migration und Integration. Sie gibt einen Überblick über die schulpolitischen Maßnahmen zur Integration und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Der theoretische Teil beleuchtet die Notwendigkeit von IKL in multikulturellen Schulklassen. Er analysiert die Ursachen für negative Beziehungen zwischen SchülerInnen unterschiedlicher Kulturen und zeigt Wege auf, wie interkulturelle Freundschaften gefördert werden können. Der Einfluss der Lehrkräfte auf die Umsetzung von IKL wird ebenfalls untersucht, und es werden Maßnahmen zur Verbesserung von Einstellungen und Verhalten der Lehrkräfte vorgestellt.
Der empirische Teil der Arbeit beschreibt die Zielsetzung und Fragestellungen der Untersuchung. Das Untersuchungsdesign, die Erhebungsinstrumente (SchülerInnenfragebogen, LehrerInnenfragebogen, Direktoreninterview) und die Untersuchungsdurchführung werden detailliert dargestellt.
Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Bezug auf den Wissenstest, die Zielerreichung in beiden Schulen, den Schulvergleich, den LehrerInnenfragebogen und die Zusammenfassung der Ergebnisse präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Interkulturelles Lernen, Migration, Integration, multikulturelle Schulklassen, Lehrerrolle, Unterrichtsprinzipien, empirische Untersuchung, Einstellungen, Wissen, SchülerInnen, LehrerInnen, Österreich.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Interkulturelles Lernen (IKL) in Schulen notwendig?
Aufgrund der Migrationsgeschichte Österreichs sind multikulturelle Klassen heute Alltag. IKL soll Vorurteile abbauen und soziale Beziehungen zwischen Schülern unterschiedlicher Herkunft fördern.
Wie ist IKL im österreichischen Lehrplan verankert?
IKL ist als fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip festgeschrieben, das in allen Gegenständen berücksichtigt werden soll.
Welche Rolle spielen die Lehrkräfte beim IKL?
Lehrkräfte haben einen großen Einfluss auf das Klassenklima; ihre Einstellungen und ihr Wissen sind entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung des Prinzips.
Was ergab die empirische Untersuchung in Wiener Schulen?
Die Arbeit analysiert Wissen und Einstellungen von Schülern und Lehrern in zwei kooperativen Mittelschulen, um festzustellen, ob IKL tatsächlich gelebte Praxis ist.
Wie können interkulturelle Freundschaften gefördert werden?
Durch kooperative Lernformen, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen im Unterricht und die Förderung von Empathie und Kommunikation.
- Arbeit zitieren
- Mag. Anita Fricker (Autor:in), 2006, Interkulturelles Lernen - Unbekanntes Unterrichtsprinzip oder gelebte schulische Praxis?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112810