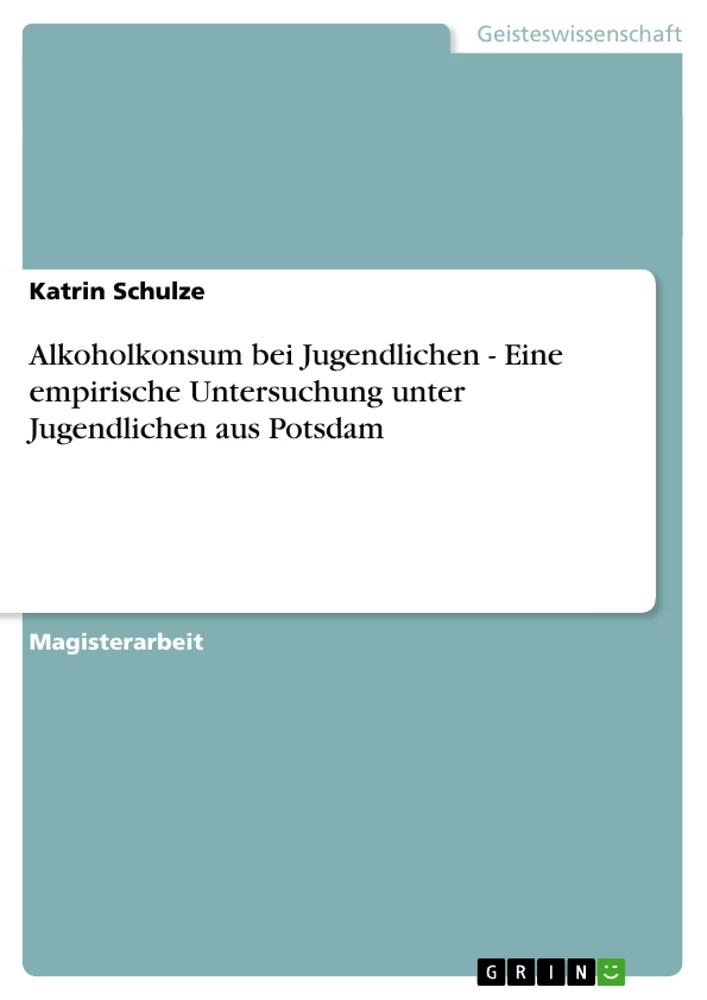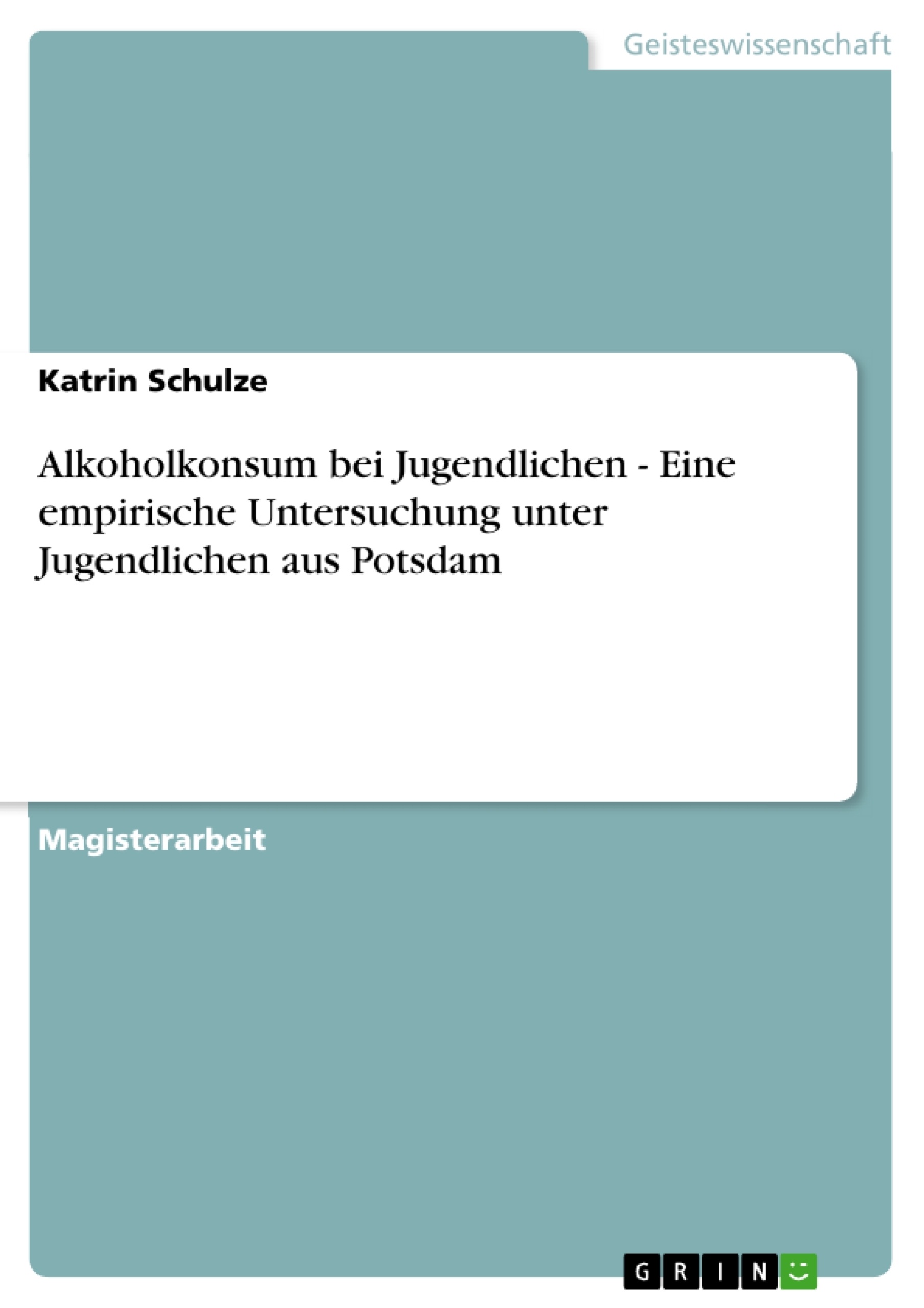Alkohol steht in unserer Gesellschaft zum einen für Geselligkeit, zum anderen für einen ungesunden Lebensstil und zwar dann, wenn er im Übermaß getrunken wird. Übermaß ist in den verschiedenen nationalen Kulturen unterschiedlich definiert. Auffällig, aber noch am ehesten als Grenzerfahrung toleriert, ist der Alkoholkonsum vor allem bei Jugendlichen. Die Relevanz des Themas ist ungebrochen und erweckt mit vermeintlich neuen extremen Erscheinungsformen jugendlichen Trinkverhaltens, wie den „Flatrate- Partys“ oder dem „binge-drinking“, immer wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.
Was scheinbar nicht an die Öffentlichkeit gelangt, ist, dass die Bundesrepublik
Deutschland insgesamt ein Alkoholproblem zu haben scheint. Das bedeutet nicht, dass die gesamte Bevölkerung zuviel Alkohol konsumiert, sondern dass der Umgang mit der Substanz kaum hinterfragt wird. Alkohol hat zu fast jeder Zeit und an fast jedem Ort seine Berechtigung. Das „Feierabendbier“ oder das „Sektfrühstück“ sind feste Bestandteile der Alltagssprache. Der Reichstag besitzt ein eigenes parlamentarisches Weinforum. Alkoholkonsum wird in unserer Gesellschaft nahezu vollkommen akzeptiert und reproduziert sich über Verhalten und Normen. Ein sensibler Umgang mit dem sogenannten „normalen“ Alkoholkonsum fehlt fast völlig. Der Verzicht auf das „Feierabendbier“ fördert eher Verlustängste als ein Überdenken der eigenen Risikoverhaltensweisen. Obwohl das alle Teile der Gesellschaft gleichermaßen betrifft, ruht der Blick dieser Arbeit auf den Jugendlichen, da sie durch die Normen und Werte ihrer sozialen
Umgebung geprägt und in ihrer Entwicklung beeinflusst werden. Der gesellschaftliche Umgang mit Alkohol spiegelt sich unter anderem im Trinkverhalten Jugendlicher wider, was sich durch kurze Ausblicke in andere Länder belegen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodische Vorgehensweise
- 3. Begriffsdefinitionen
- 3.1 Jugend
- 3.2 Alkohol – Substanz und Konsummengen
- 3.3 Alkoholkonsum, -missbrauch, -abhängigkeit
- 4. Alkoholkonsum in Deutschland – Entwicklung und Bestandsaufnahme
- 4.1 Alkoholkonsum bei Erwachsenen
- 4.2 Alkoholkonsum bei Jugendlichen
- 5. Alkoholkonsum versus gesundheitsbewusstes Verhalten
- 5.1 Gesundheitsverhalten
- 5.2 Soziale Ungleichheiten und Gesundheit
- 5.3 Der „normale“ Alkoholkonsum und seine gesundheitlichen Folgen
- 5.4 Gesundheitliche Folgekosten für die Gesellschaft
- 6. Die Einflüsse des sozialen Umfelds auf das Konsumverhalten Jugendlicher
- 6.1 Der Einfluss von Gesellschaft und Werbung
- 6.2 Der Einfluss der Familie – biologische und soziale Faktoren
- 6.3 Der Einfluss der Peergroups
- 6.4 Schlussfolgerungen
- 7. Jugendlicher Alkoholkonsum im Alltag - Expertengespräche
- 7.1 Vertreter der Polizei – Gespräch mit dem Leiter der Führungsstelle des Schutzbereichs Potsdam
- 7.2 Das Klinikum Ernst von Bergmann – Gespräch mit dem Leiter der Rettungsstelle und einem Oberarzt der Kinderstation
- 7.3 Sozialarbeiter – Gespräch mit einem Mitarbeiter des Chill out Vereins
- 7.4 Gespräch mit zwei Sozialpädagogen des Jugendclubs „Alpha“
- 8. Präventionsmaßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Alkoholkonsum bei Jugendlichen in Potsdam. Ziel ist es, soziologische Aspekte des jugendlichen Trinkverhaltens zu beleuchten und gängige Annahmen zu hinterfragen. Die Arbeit analysiert die Einflüsse des sozialen Umfelds, den Zusammenhang zwischen Gesundheitsbewusstsein und tatsächlichem Verhalten sowie die Rolle des sozioökonomischen Status.
- Der „normale“ Alkoholkonsum in der Gesellschaft und seine Akzeptanz
- Der Einfluss des sozialen Umfelds (Familie, Peergroups, Werbung) auf das Trinkverhalten Jugendlicher
- Der Widerspruch zwischen Gesundheitsbewusstsein und tatsächlichem Alkoholkonsum bei Jugendlichen
- Der Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Alkoholkonsum
- Präventionsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des jugendlichen Alkoholkonsums ein und stellt die Relevanz der Thematik heraus. Sie beleuchtet die gesellschaftliche Akzeptanz von Alkohol und den Mangel an kritischer Auseinandersetzung mit dem „normalen“ Konsum. Die Arbeit fokussiert auf soziologische Aspekte und hinterfragt bestehende Studien, die sich primär auf die Quantifizierung des Alkoholkonsums konzentrieren. Die Arbeit formuliert drei zentrale Thesen: Alkohol ist ein unreflektiertes latentes Problem in der Gesellschaft; ein Widerspruch besteht zwischen Gesundheitsbewusstsein und realem Gesundheitsverhalten; der individuelle Alkoholkonsum im Jugendalter ist unabhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern.
4. Alkoholkonsum in Deutschland – Entwicklung und Bestandsaufnahme: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Alkoholkonsum in Deutschland, differenziert nach Erwachsenen und Jugendlichen. Es analysiert die Entwicklung des Alkoholkonsums im Laufe der Zeit und die aktuellen Gegebenheiten. Es werden Daten und Statistiken vorgestellt, die das Ausmaß des Problems beleuchten und den Kontext für die Untersuchung des jugendlichen Alkoholkonsums schaffen. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen jugendlicher Alkoholkonsum stattfindet.
5. Alkoholkonsum versus gesundheitsbewusstes Verhalten: Dieses Kapitel setzt sich mit dem Widerspruch zwischen dem Gesundheitsbewusstsein und dem tatsächlichen Gesundheitsverhalten auseinander, insbesondere im Hinblick auf den Alkoholkonsum bei Jugendlichen. Es analysiert die gesundheitlichen Folgen von Alkoholkonsum und diskutiert die Diskrepanz zwischen Wissen über die Risiken und dem dennoch häufigen übermäßigen Konsum. Soziale Ungleichheiten im Bezug auf Gesundheit und Zugang zu Gesundheitsversorgung werden ebenfalls thematisiert, um den Kontext des Alkoholkonsums zu erweitern.
6. Die Einflüsse des sozialen Umfelds auf das Konsumverhalten Jugendlicher: Dieses Kapitel untersucht detailliert die Einflüsse des sozialen Umfelds auf das Trinkverhalten Jugendlicher. Es betrachtet den Einfluss von Gesellschaft und Werbung, die Rolle der Familie (biologische und soziale Faktoren) und den Einfluss von Peergroups. Die Zusammenhänge werden analysiert und die Bedeutung des sozialen Kontextes für das Verständnis des Alkoholkonsums hervorgehoben. Die Kapitel-Schlussfolgerungen integrieren die Erkenntnisse der einzelnen Unterkapitel zu einem umfassenden Bild der sozialen Einflüsse.
Schlüsselwörter
Alkoholkonsum, Jugendliche, Potsdam, Soziologie, Soziales Umfeld, Familie, Peergroups, Werbung, Gesundheitsverhalten, Soziale Ungleichheit, Prävention, Risikoverhalten.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Jugendlicher Alkoholkonsum in Potsdam
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Alkoholkonsum bei Jugendlichen in Potsdam. Der Fokus liegt auf soziologischen Aspekten des jugendlichen Trinkverhaltens, den Einflüssen des sozialen Umfelds, dem Zusammenhang zwischen Gesundheitsbewusstsein und tatsächlichem Verhalten sowie der Rolle des sozioökonomischen Status. Die Arbeit hinterfragt gängige Annahmen und konzentriert sich weniger auf die reine Quantifizierung des Konsums.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, methodische Vorgehensweise, Begriffsdefinitionen, Alkoholkonsum in Deutschland, Alkoholkonsum versus gesundheitsbewusstes Verhalten, Einfluss des sozialen Umfelds, jugendlicher Alkoholkonsum im Alltag (Expertengespräche) und Präventionsmaßnahmen. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeschlüsselt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, soziologische Aspekte des jugendlichen Trinkverhaltens zu beleuchten und gängige Annahmen zu hinterfragen. Es werden der Einfluss des sozialen Umfelds (Familie, Peergroups, Werbung), der Widerspruch zwischen Gesundheitsbewusstsein und tatsächlichem Verhalten sowie der Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Alkoholkonsum analysiert. Die Arbeit formuliert drei zentrale Thesen.
Welche zentralen Thesen werden in der Arbeit aufgestellt?
Die Arbeit formuliert folgende Thesen: Alkohol ist ein unreflektiertes latentes Problem in der Gesellschaft; ein Widerspruch besteht zwischen Gesundheitsbewusstsein und realem Gesundheitsverhalten; der individuelle Alkoholkonsum im Jugendalter ist unabhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Der „normale“ Alkoholkonsum in der Gesellschaft und seine Akzeptanz; Der Einfluss des sozialen Umfelds (Familie, Peergroups, Werbung) auf das Trinkverhalten Jugendlicher; Der Widerspruch zwischen Gesundheitsbewusstsein und tatsächlichem Alkoholkonsum bei Jugendlichen; Der Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Alkoholkonsum; Präventionsmöglichkeiten.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Magisterarbeit beschreibt die methodische Vorgehensweise im zweiten Kapitel. Nähere Details zur Methodik sind dem Text selbst zu entnehmen.
Werden Expertenmeinungen berücksichtigt?
Ja, Kapitel 7 beinhaltet Expertengespräche mit Vertretern der Polizei, des Klinikums Ernst von Bergmann, Sozialarbeitern und Sozialpädagogen. Diese Interviews liefern Einblicke in den jugendlichen Alkoholkonsum aus verschiedenen Perspektiven.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind dem Text selbst zu entnehmen. Das Kapitel zu den Einflüssen des sozialen Umfelds zieht beispielsweise Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen der einzelnen Unterkapitel zu Familie, Peergroups und Werbung. Die Einleitung deutet bereits einige zentrale Argumentationslinien an.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alkoholkonsum, Jugendliche, Potsdam, Soziologie, Soziales Umfeld, Familie, Peergroups, Werbung, Gesundheitsverhalten, Soziale Ungleichheit, Prävention, Risikoverhalten.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Detaillierte Zusammenfassungen der Kapitel 1, 4, 5 und 6 finden sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der bereitgestellten HTML-Datei.
- Quote paper
- Katrin Schulze (Author), 2008, Alkoholkonsum bei Jugendlichen - Eine empirische Untersuchung unter Jugendlichen aus Potsdam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112820