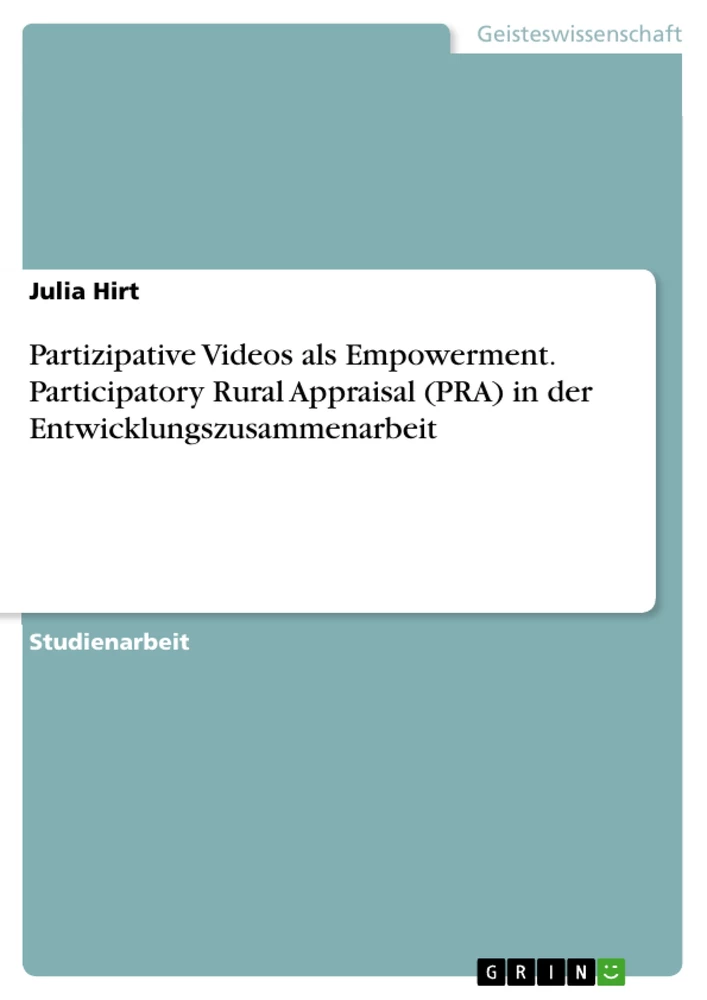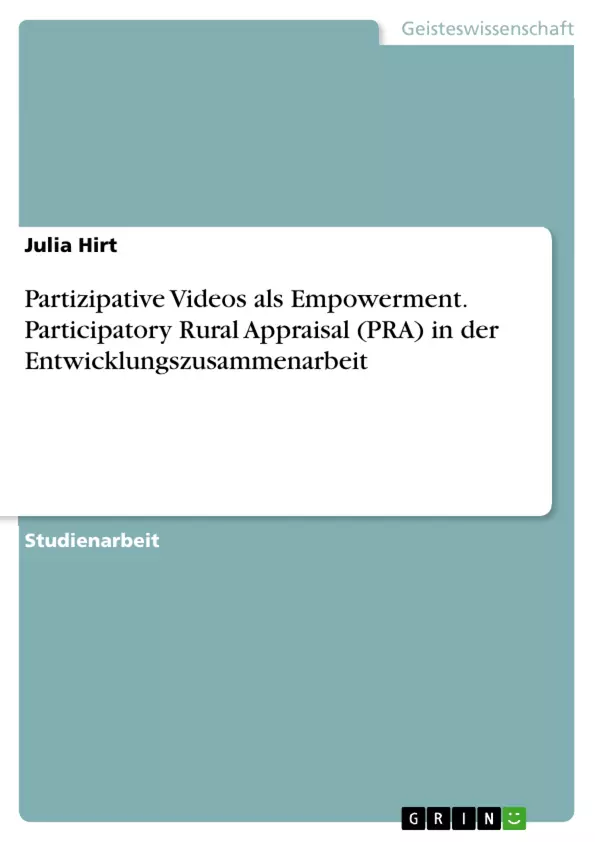In den 1980er Jahren hat sich in der Entwicklungshilfe eine neuartige Arbeitsphilosophie ausgebildet, mit dem Ansatz, durch nicht standardisierte Methoden unter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung innerhalb kurzer Zeit handlungsrelevante Informationen über lokale Lebensverhältnisse und Ressourcen zu sammeln und auszuwerten. Die einheimischen Betroffenen übernehmen dabei selbst die aktive Rolle, während das multidisziplinäre Forscherteam an Außenstehenden lediglich eine unterstützende Rolle als Facilitator einnehmen soll. Der Expertenstatus wird dabei an die Lokalbevölkerung abgegeben, welche sich als Besitzer der erzielten Ergebnisse fühlen und in der Lage sein soll, die daraus abgeleiteten Aktivitäten selbst in die Hand zu nehmen. Diese als Participatory Rural Appraisal (PRA) bekannte Vorgehensweise will Betroffene also zur Selbstaktion ermächtigen und besteht mittlerweile aus einem Repertoire verschiedenster Lernansätze, welchen allesamt eine gemeinsame partizipative Beratungsphilosophie zugrunde liegt. Die Partizipative Video-Methode ist eine dieser Instrumente. Diese Arbeit untersucht, inwieweit sie ihrer Aufgabe nachkommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellendiskussion und Recherchestrategie
- Theoretischer Hintergrund (Begriffsklärung Empowerment)
- Die Partizipative Video - Methode
- Prozess
- Anwendungsgebiete und Ziele
- Projektanalyse eines ausgewählten Beispiels
- Vorgehensweise
- Projekt ,,Solar Power in Turkmenistan”
- Planungsphase
- Umsetzungsphase
- Evaluation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der Analyse einer ausgewählten Fallstudie zu untersuchen, ob und inwieweit Partizipative Videos ihrem Versuch, zu Empowerment zu verhelfen, nachkommen.
- Die Rolle von Partizipativen Videos im Empowerment-Kontext
- Die Partizipative Video-Methode und ihre Anwendung in der Entwicklungshilfe
- Analyse eines konkreten Projekts: ,,Solar Power in Turkmenistan"
- Planungs-, Umsetzungs- und Evaluationsphasen des Projekts
- Bewertung der Wirksamkeit von Partizipativen Videos in Bezug auf Empowerment
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Entstehung und Bedeutung des Participatory Rural Appraisal (PRA) im Kontext der Entwicklungshilfe und stellt die Partizipative Video-Methode als ein wichtiges Instrument innerhalb dieses Ansatzes vor. Die Arbeit zielt darauf ab, anhand einer Fallstudie zu überprüfen, inwieweit die Partizipative Video-Methode zum Empowerment der lokalen Bevölkerung beiträgt.
- Quellendiskussion und Recherchestrategie: Dieser Abschnitt beschreibt die Auswahl des Projekts ,,Solar Power in Turkmenistan" als Fallstudie aufgrund seiner Langjährigkeit, der Erfahrung des Projektleiters Chris Lunch und der Verfügbarkeit umfangreichen Informationsmaterials auf der Webseite der verantwortlichen Organisation InsightShare. Es wird zudem ein Einblick in die Geschichte und das Schaffen der Organisation InsightShare gegeben, die sich als Vorreiter auf dem Gebiet der Partizipativen Video-Methode etabliert hat.
- Theoretischer Hintergrund (Begriffsklärung Empowerment): Dieses Kapitel erläutert den Begriff Empowerment im Kontext der Entwicklungshilfe und definiert ihn als Strategien und Maßnahmen, die Menschen und Gemeinschaften mehr Autonomie und Selbstbestimmung ermöglichen. Der Fokus liegt dabei auf der Überwindung von Macht- und Einflusslosigkeit und der Nutzung von Gestaltungsspielräumen und Ressourcen.
- Die Partizipative Video - Methode: Dieser Abschnitt behandelt die Partizipative Video-Methode in ihrer Ganzheit. Er beschreibt den Prozess der Videoerstellung, die verschiedenen Anwendungsgebiete und Ziele der Methode und beleuchtet ihre Potenziale in Bezug auf Empowerment.
- Projektanalyse eines ausgewählten Beispiels: Dieses Kapitel analysiert das Projekt ,,Solar Power in Turkmenistan" anhand verschiedener Leitkriterien. Es untersucht die Planungsphase, die Umsetzungsphase und die Evaluationsphase des Projekts und beleuchtet dabei, inwieweit Partizipative Videos die lokale Bevölkerung in den Prozess der Problemdefinition und Lösungsfindung miteinbezogen und zu Empowerment geführt haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Thematik des Empowerment mithilfe der Partizipativen Video-Methode. Sie analysiert die Anwendung dieser Methode in der Entwicklungshilfe, insbesondere im Projekt ,,Solar Power in Turkmenistan". Daher stehen folgende Schlüsselwörter im Vordergrund: Partizipative Video-Methode, Empowerment, Entwicklungshilfe, Fallstudie, Projektanalyse, Participatory Rural Appraisal (PRA), InsightShare, Solar Power, Turkmenistan.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Participatory Rural Appraisal (PRA)?
PRA ist ein Ansatz in der Entwicklungshilfe, bei dem die lokale Bevölkerung aktiv einbezogen wird, um Informationen über ihre Lebensverhältnisse selbst zu sammeln und auszuwerten.
Wie funktioniert die Partizipative Video-Methode?
Betroffene erstellen unter Anleitung von "Facilitatoren" eigene Videos, um ihre Probleme zu definieren, Lösungen zu finden und ihre Perspektiven nach außen zu kommunizieren.
Was bedeutet "Empowerment" in diesem Zusammenhang?
Empowerment bezeichnet den Prozess, durch den Menschen mehr Autonomie und Selbstbestimmung erlangen, um ihre Lebensumstände aktiv zu gestalten.
Worum geht es im Projekt „Solar Power in Turkmenistan“?
Es ist eine Fallstudie, die analysiert, wie Partizipative Videos eingesetzt wurden, um die Einführung von Solarenergie in Turkmenistan durch die lokale Bevölkerung zu unterstützen.
Welche Rolle spielt die Organisation InsightShare?
InsightShare gilt als Vorreiter der Partizipativen Video-Methode und stellt umfangreiche Methoden und Erfahrungen für Empowerment-Projekte weltweit bereit.
- Quote paper
- Julia Hirt (Author), 2015, Partizipative Videos als Empowerment. Participatory Rural Appraisal (PRA) in der Entwicklungszusammenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128266