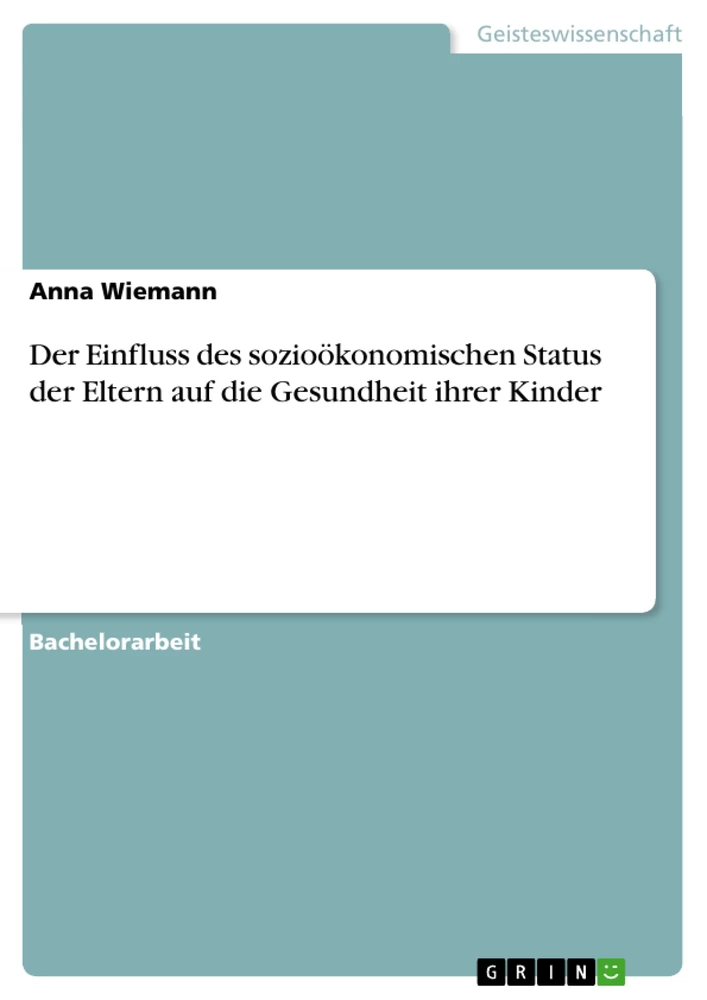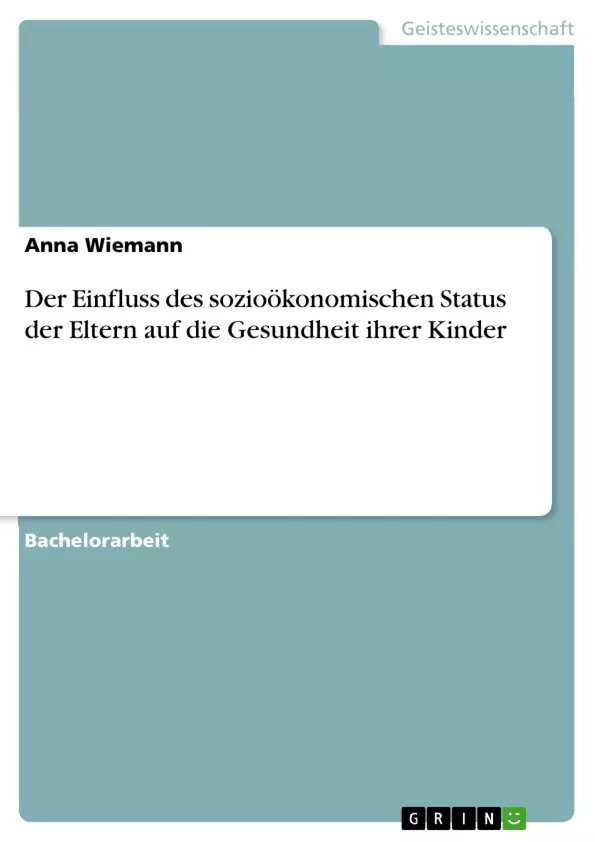"Die Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Ländern der Erde unterscheiden sich immens". Aber nicht nur zwischen den Ländern herrscht eine gesundheitliche Ungleichheit, auch in Deutschland lassen sich schichtspezifische Unterschiede in der Gesundheit feststellen. Da die gesundheitliche Ungleichheit sich im Themenkontext der sozialen Ungleichheit bewegt, welche als gesellschaftliche Vor- und Nachteile von Individuen definiert werden, drängt sich die Frage nach Gerechtigkeit auf. Blickt man zusätzlich darauf, dass Kinder von den sozialen Verhältnissen der Eltern abhängig sind, und dadurch in ihrem Gesundheitsverhalten und ihrer Gesundheit durch den sozioökonomischen Status der Eltern beeinflusst werden, wird die Frage nach sozialer Gerechtigkeit verstärkt. Denn wie kann es gerecht sein, dass Kinder in ihrem Gesundheitsstatus von den sozioökonomischen Verhältnissen der Eltern abhängig sind? Und wie kann diese Ungerechtigkeit beeinflusst oder sogar verhindert werden? Um jedoch die Frage nach Gerechtigkeit und Lösung der Ungerechtigkeit überhaupt stellen zu können, müssen die ursächlichen Mechanismen des Einflusses des sozioökonomischen Status der Eltern auf das Gesundheitsverhalten und die Gesundheit ihrer Kinder erarbeitet und der Einfluss des sozioökonomischen Status der Eltern empirisch belegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Konzeptspezifikation des sozioökonomischen Status
- 2.2. Erklärungsansätze: Einfluss des sozioökonomischen Status der Eltern auf das Gesundheitsverhalten und die Gesundheit ihrer Kinder
- 2.2.1 Schichtspezifisches Gesundheitsverhalten
- 2.2.2 Materielle und strukturelle Faktoren
- 2.2.3 Psychosoziale Faktoren
- 2.2.4 Kulturelles Verhalten
- 2.3. Zusammenfassung der erwartbaren Unterschiede im Gesundheitsverhalten und des Gesundheitsstatus
- 3. Empirische Ergebnisse: Einfluss des sozioökonomischen Status der Eltern auf das Gesundheitsverhalten und die Gesundheit ihrer Kinder
- 3.1. Datengrundlage und Methode
- 3.1.1. Forschungsdesign, Stichprobenauswahl und Studiendurchführung
- 3.1.2. Operationalisierung des sozioökonomischen Status
- 3.1.3. Operationalisierung des Gesundheitsverhaltens und des Gesundheitsstatus
- 3.2. Ergebnisse
- 3.2.1. Gesundheitsverhalten
- 3.2.2. Gesundheitsstatus
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des sozioökonomischen Status der Eltern auf das Gesundheitsverhalten und die Gesundheit ihrer Kinder. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen dem sozioökonomischen Hintergrund von Familien und den gesundheitlichen Outcomes ihrer Kinder zu beleuchten und zu analysieren, welche Mechanismen diesen Einfluss vermitteln. Die Arbeit leistet einen Beitrag zum Verständnis der gesundheitlichen Ungleichheit und der Bedeutung sozialer Determinanten für die Gesundheit von Kindern.
- Konzeptspezifikation des sozioökonomischen Status und dessen Einfluss auf die Gesundheit von Kindern
- Analyse von Erklärungsansätzen für den Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status der Eltern und dem Gesundheitsverhalten und der Gesundheit ihrer Kinder
- Empirische Untersuchung der Unterschiede im Gesundheitsverhalten und Gesundheitsstatus von Kindern unterschiedlicher sozioökonomischer Schichten
- Bewertung der Ergebnisse im Kontext der gesundheitlichen Ungleichheit und der Bedeutung sozialer Determinanten für die Gesundheit von Kindern
- Diskussion von Implikationen für die Gesundheitspolitik und die Förderung von Chancengleichheit im Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Thematik und die Forschungsfrage darlegt. Kapitel 2 widmet sich den theoretischen Grundlagen und beleuchtet den sozioökonomischen Status als entscheidenden Faktor für die Gesundheit von Kindern. Es werden verschiedene Erklärungsansätze für den Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status der Eltern und dem Gesundheitsverhalten und der Gesundheit ihrer Kinder vorgestellt, darunter schichtspezifisches Gesundheitsverhalten, materielle und strukturelle Faktoren, psychosoziale Faktoren und kulturelles Verhalten. Kapitel 3 präsentiert die empirischen Ergebnisse der Studie, die auf Daten der KiGGS Studie basieren. Es werden die Datengrundlage und die Methoden der Studie beschrieben sowie die Ergebnisse der Analyse des Einflusses des sozioökonomischen Status der Eltern auf das Gesundheitsverhalten und den Gesundheitsstatus ihrer Kinder dargestellt.
Schlüsselwörter
Sozioökonomischer Status, Gesundheitsverhalten, Gesundheit, Kinder, soziale Ungleichheit, gesundheitliche Ungleichheit, Erklärungsansätze, empirische Ergebnisse, KiGGS Studie, Gesundheitspolitik, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der sozioökonomische Status der Eltern die Gesundheit der Kinder?
Der Status wirkt sich über materielle Faktoren, das schichtspezifische Gesundheitsverhalten sowie psychosoziale und kulturelle Einflüsse auf die Entwicklung der Kinder aus.
Was ist die KiGGS-Studie?
Die KiGGS-Studie liefert die empirische Datengrundlage zur Analyse des Gesundheitszustands und des Gesundheitsverhaltens von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
Welche materiellen Faktoren spielen eine Rolle für die Kindergesundheit?
Hierzu zählen unter anderem die Wohnsituation, die finanzielle Absicherung und der Zugang zu gesunder Ernährung und sportlichen Aktivitäten.
Gibt es Unterschiede im Gesundheitsverhalten zwischen sozialen Schichten?
Ja, die Arbeit belegt empirisch, dass Kinder aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten oft ein risikoreicheres Gesundheitsverhalten aufweisen.
Was kann die Gesundheitspolitik gegen diese Ungleichheit tun?
Die Arbeit diskutiert Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit, um den Einfluss der elterlichen Verhältnisse auf den Gesundheitsstatus der Kinder zu minimieren.
- Arbeit zitieren
- Anna Wiemann (Autor:in), 2021, Der Einfluss des sozioökonomischen Status der Eltern auf die Gesundheit ihrer Kinder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128302