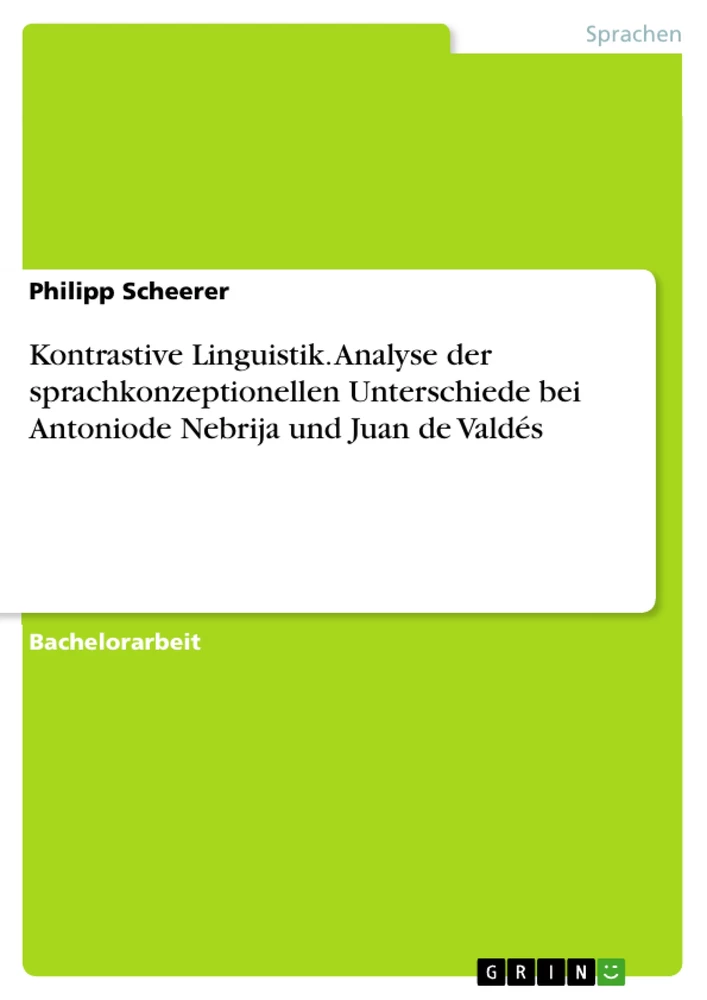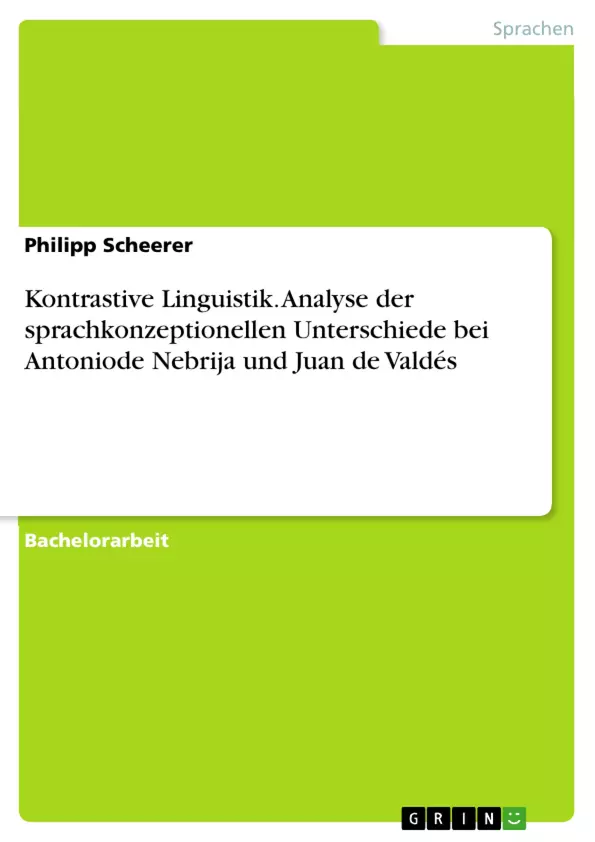Diese Arbeit hat zum Ziel, zwei historische Zeugnisse des spanischen Sprachbewusstseins im Sinne der kontrastiven Linguistik gegenüberzustellen.
Obwohl Institutionen wie die Real Academia Española (RAE) regelmäßig aktualisierte Grammatiken der spanischen Sprache publizieren, um der Sprache einen normierten Rahmen zu geben, kommt es dennoch zu Konflikten zwischen Sprechern des castellano und einer der sprachlichen Varietäten auf der Iberischen Halbinsel. Dies verdeutlicht die Aktualität des Sprachbewusstseins Spaniens sowohl in sprachlicher als auch politischer Hinsicht. Es bietet sich daher für das nähere Verständnis an, den Ursprung des spanischen Sprachbewusstseins historisch zu untersuchen.
Dieses Vorhaben ist zeitlich auf das Siglo de Oro zu begrenzen, da das spanische Reich damals einen bedeutenden machtpolitischen Wandlungsprozess erfuhr und parallel dazu auch die ersten schriftlichen Zeugnisse eines ‚spanischen‘ Sprachbewusstseins entstanden.
Die Gramática de la lengua castellana von Antonio de Nebrija, stammt aus dem Jahr 1492 und war die erste Grammatik des Kastilischen. Die Prologe der GC sollen im Folgenden hinsichtlich des Sprachbewusstseins analysiert und anschließend mit dem Diálogo de la lengua verglichen werden. Letzterer wurde im Jahr 1535 von Juan de Valdés in Neapel verfasst und stellt seine einzige literarische Auseinandersetzung mit dem Kastilischen dar. Die GC und der DL gerieten nach ihrer Veröffentlichung in Vergessenheit, avancierten aber mit ihrer Wiederentdeckung zu wichtigen sprachgeschichtlichen Zeugnissen dieser Zeit. Aus diesem Grund wurden beide Werke seit dem 20. Jahrhundert mehrfach editiert und mit diversen, teils sehr ausführlichen Einleitungen veröffentlicht. Dennoch sind Nebrija und Valdés bisher nur bezüglich bestimmter Aspekte miteinander in Verbindung gebracht worden – eine Herausarbeitung der grundlegenden sprachkonzeptionellen Unterschiede bietet sich daher an. Diese Arbeit nimmt bis auf wenige Ausnahmen Bezug auf Antonio Quilis‘ Edition der GC, weshalb Textverweise folgend mit GCQ abgekürzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung...
- 2. Der sprachgeschichtliche Kontext: Die Emanzipation der,spanischen' romance vom Lateinischen
- 3. Das spanische Sprachbewusstsein zwischen Renacimiento und Siglo de Oro.
- 4. Antonio de Nebrija und die Gramática de la lengua castellana von 1492
- 4.1 Nebrija als „,humanista completo“.
- 4.2 Die Prologe der Gramática de la lengua castellana als Ort apologetischer Sprachreflexion
- 5. Juan de Valdés: Der Diálogo de la lengua von 1535 in kontrastiver Position zu Nebrija
- 5.1 Externer Vergleich.........
- 5.2 Interner Vergleich......
- 6. Fazit.........
- 7. Bibliografie.……........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der historischen Entwicklung des spanischen Sprachbewusstseins im Siglo de Oro, indem sie die sprachkonzeptionellen Unterschiede zwischen Antonio de Nebrijas „Gramática de la lengua castellana“ und Juan de Valdés „Diálogo de la lengua“ untersucht. Die Arbeit soll dazu beitragen, ein tieferes Verständnis für die sprachliche und politische Situation Spaniens in dieser Epoche zu entwickeln.
- Die Emanzipation des Kastilischen vom Lateinischen
- Die Entstehung des spanischen Sprachbewusstseins
- Die Rolle von Nebrijas „Gramática de la lengua castellana“ als erster Grammatik des Kastilischen
- Der kontrastive Vergleich der sprachkonzeptionellen Ansätze von Nebrija und Valdés
- Die Bedeutung von apologetischen Sprachreflexionen im Siglo de Oro
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des spanischen Sprachbewusstseins im Kontext der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Anschließend wird der sprachgeschichtliche Kontext der Emanzipation des Kastilischen vom Lateinischen beleuchtet. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von zwei Schlüsselwerken des spanischen Sprachbewusstseins: Antonio de Nebrijas „Gramática de la lengua castellana“ und Juan de Valdés „Diálogo de la lengua“. In Kapitel 4 werden die Prologe von Nebrijas „Gramática“ analysiert und anschließend mit dem „Diálogo de la lengua“ von Valdés verglichen. Der Vergleich umfasst sowohl einen externen als auch einen internen Blick auf die beiden Werke.
Schlüsselwörter
Spanisches Sprachbewusstsein, Siglo de Oro, Gramática de la lengua castellana, Antonio de Nebrija, Diálogo de la lengua, Juan de Valdés, Sprachgeschichte, Kontrastive Linguistik, Apologetische Sprachreflexion, Kastilisch, Lateinisch, Romanisierung, Iberische Halbinsel, Reconquista.
Häufig gestellte Fragen
Wer verfasste die erste Grammatik der spanischen Sprache?
Antonio de Nebrija veröffentlichte im Jahr 1492 mit der „Gramática de la lengua castellana“ die erste Grammatik des Kastilischen.
Was unterscheidet Nebrija von Juan de Valdés?
Nebrija verfolgte einen normativen, fast wissenschaftlichen Ansatz, während Valdés in seinem „Diálogo de la lengua“ (1535) eine eher praxisorientierte und ästhetische Sicht auf das Spanische vertrat.
Was versteht man unter dem „Siglo de Oro“?
Es bezeichnet das „Goldene Zeitalter“ Spaniens, eine Epoche hoher kultureller Blüte und machtpolitischer Expansion im 16. und 17. Jahrhundert.
Warum ist die Emanzipation vom Lateinischen wichtig?
Die Aufwertung des Kastilischen gegenüber dem Lateinischen war ein zentraler Schritt zur nationalen Identitätsbildung Spaniens während der Renaissance.
Welche Rolle spielt das Sprachbewusstsein in der spanischen Geschichte?
Sprachbewusstsein war stets eng mit politischer Macht verknüpft, wie Nebrijas berühmter Satz zeigt: „Sprache war immer die Gefährtin des Imperiums“.
- Quote paper
- Philipp Scheerer (Author), 2018, Kontrastive Linguistik. Analyse der sprachkonzeptionellen Unterschiede bei Antoniode Nebrija und Juan de Valdés, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128670