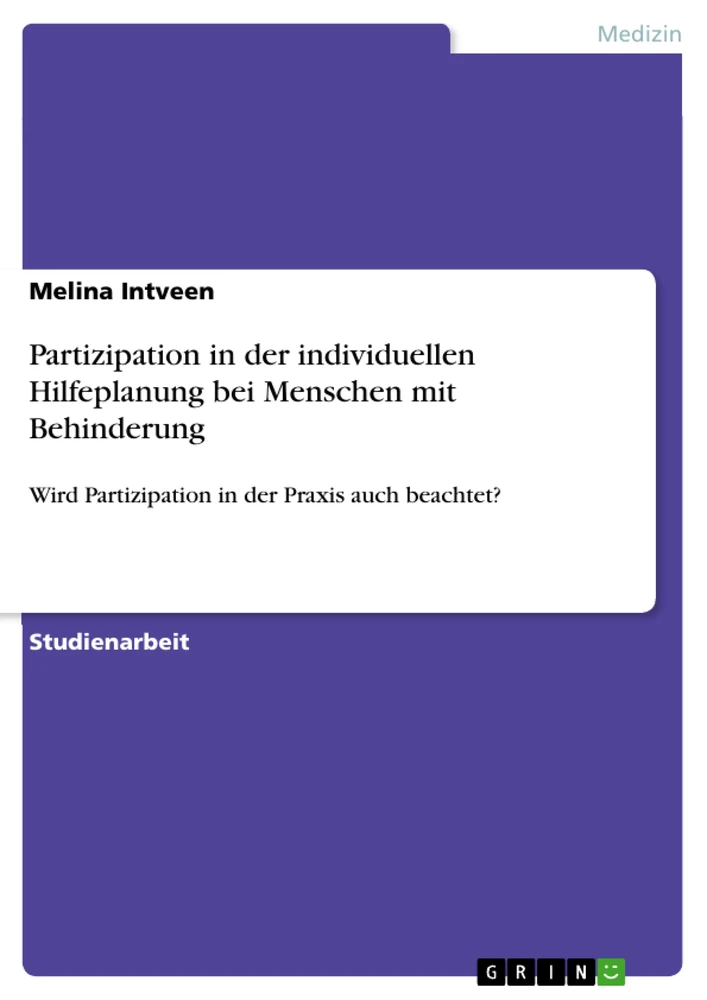Geistig behinderte Menschen mit einem hohen Hilfebedarf leben trotz vieler positiver Entwicklungen in der Behindertenhilfe in großen Einrichtungen. Die Bewohner dieser Einrichtungen haben nur sehr niedrige Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Gestaltung der Unterstützungsleistungen. Diese Arbeit geht deshalb der Frage nach, ob der Grundsatz der Partizipation in der Praxis auch tatsächlich beachtet wird.
Durch die UN-Behindertenrechtskonvention und auch dem neuen BEI – NRW soll es zu mehr Mitentscheidungen und Teilhabe kommen. Mit der UN-Behindertenrechtskonvention hat die Bundesrepublik sich verpflichtet, in sämtlichen Lebensbereichen Vorkehrungen zu treffen. Auf der anderen Seite erstellte der LVR mit dem BEI – NRW ein Instrument zur Bedarfsermittlung, um den Einbezug der Beteiligten zu ermöglichen und zu garantieren. Partizipation und Teilhabe sind aber klar zu trennen, denn Teilhabe bedeutet das Einbezogen sein in einer Lebenssituation, währenddessen Partizipation als eine Beteiligung an Entscheidungsprozessen oder als Mitgestaltung gedeutet wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Partizipation
- 2.1 Partizipative Wende in den sozialen Berufen
- 2.2 Partizipationspyramide
- 2.3 Wie Partizipation gelingen kann
- 2.4 Partizipation und Behinderung
- 3. Der Begriff der Behinderung
- 4. Gesetze
- 5. Individuelle Hilfeplanung
- 5.1 Phasen der individuellen Hilfeplanung
- 5.2 Bewertung von Hilfeplankonzepten
- 5.3 BEI NRW
- 5.4 Hilfeplanung und Schwerstbehinderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und Umsetzung von Partizipation in der individuellen Hilfeplanung für Menschen mit Behinderung. Sie analysiert die Herausforderungen und Hindernisse bei der praktischen Anwendung partizipativer Ansätze und beleuchtet den rechtlichen Rahmen sowie die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention und des BEI-NRW.
- Definition und Bedeutung von Partizipation im Kontext der Behindertenhilfe
- Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen für Partizipation
- Praktische Umsetzung von Partizipation in der individuellen Hilfeplanung
- Herausforderungen und Hindernisse bei der Partizipation
- Der Einfluss von BEI-NRW auf die Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Partizipation in der individuellen Hilfeplanung bei Menschen mit Behinderung ein. Sie beschreibt die Ausgangssituation, in der geistig behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf oft in großen Einrichtungen leben und nur geringe Wahlmöglichkeiten haben. Die Arbeit widmet sich der Klärung des Begriffs Partizipation, der im Kontext sozialer Berufe oft uneinheitlich verwendet wird, und hebt die Relevanz der UN-Behindertenrechtskonvention und des BEI-NRW hervor. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Teilhabe und Partizipation und der zentralen Rolle der Selbstbestimmung. Die Autorin begründet ihre Themenwahl mit ihrer beruflichen Erfahrung in einem Behindertenwohnheim und der Notwendigkeit, die Umsetzung partizipativer Ansätze zu analysieren.
2. Partizipation: Dieses Kapitel beleuchtet den vielschichtigen Begriff der Partizipation und seine Unterscheidung von Teilhabe. Es diskutiert die Synonymität von "Partizipation" und "Teilhabe" im Deutschen, basierend auf der Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Der Text differenziert zwischen dem "Einbezogen-Sein" (Teilhabe) und der aktiven "Mitbestimmung" (Partizipation) an Entscheidungsprozessen. Es wird die Wechselwirkung zwischen Partizipation und Selbstbestimmung herausgestellt und die Bedeutung eines grundlegenden Bedürfnisses nach Partizipation vom Beginn des Lebens an betont. Das Kapitel analysiert außerdem Partizipationshindernisse, wie widersprüchliche Ziele von Institutionen, ignorierte Interessen und zu hohe Anforderungen an die Beteiligten. Schließlich werden Punkte zur Analyse von Partizipationsprozessen vorgestellt, die die Verantwortung, den Umfang der Mitbestimmung und fördernde/hemmende Faktoren berücksichtigen.
2.1 Partizipative Wende in den sozialen Berufen: Dieses Unterkapitel (als Teil von Kapitel 2) beschreibt den Paradigmenwechsel in den sozialen Berufen hin zu einer partizipativen Perspektive. Früher wurden Probleme von Menschen als individuelle Defizite betrachtet und nicht als Folgen gesellschaftlicher Dynamiken. Der Fokus lag auf Anpassung, während nun die aktive Einbeziehung und Mitgestaltung im Vordergrund steht. Der Text deutet an, dass dieser Wandel zu einer veränderten Sichtweise auf Benachteiligung und die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Teilhabe führt.
3. Der Begriff der Behinderung: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext und muss hier ergänzt werden, basierend auf dem Gesamtkontext der Arbeit. Eine mögliche Zusammenfassung könnte den Fokus auf die Definition von Behinderung legen, unter Berücksichtigung der WHO-Klassifikation und der gesellschaftlichen Konstruktion von Behinderung. Der Text sollte den Einfluss der Definition auf die Praxis der Hilfeplanung hervorheben.)
4. Gesetze: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext und muss hier ergänzt werden. Eine mögliche Zusammenfassung könnte die relevanten Gesetze und Richtlinien im Kontext von Behinderung und Partizipation zusammenfassen, z.B. die UN-Behindertenrechtskonvention und das deutsche Recht. Der Text sollte den Einfluss dieser Gesetze auf die individuelle Hilfeplanung und die Partizipation von Menschen mit Behinderung hervorheben.)
5. Individuelle Hilfeplanung: Dieses Kapitel befasst sich mit der individuellen Hilfeplanung und ihren verschiedenen Aspekten. Es werden die Phasen der Hilfeplanung erläutert, verschiedene Hilfeplankonzepte bewertet und das BEI-NRW als Instrument zur Bedarfsermittlung vorgestellt. Der Text untersucht den Umgang mit Schwerstbehinderung in der Hilfeplanung und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen einer partizipativen Gestaltung des Prozesses. Die Zusammenfassung sollte die verschiedenen Aspekte miteinander verknüpfen und die Bedeutung der individuellen Hilfeplanung für die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung betonen.
Schlüsselwörter
Partizipation, Teilhabe, Behinderung, Individuelle Hilfeplanung, UN-Behindertenrechtskonvention, BEI-NRW, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, soziale Arbeit, Hilfeplanungsprozess.
Häufig gestellte Fragen zu "Partizipation in der individuellen Hilfeplanung für Menschen mit Behinderung"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung und Umsetzung von Partizipation in der individuellen Hilfeplanung für Menschen mit Behinderung. Sie analysiert Herausforderungen und Hindernisse bei der praktischen Anwendung partizipativer Ansätze und beleuchtet den rechtlichen Rahmen sowie die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention und des BEI-NRW.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Bedeutung von Partizipation im Kontext der Behindertenhilfe, die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen für Partizipation, die praktische Umsetzung von Partizipation in der individuellen Hilfeplanung, Herausforderungen und Hindernisse bei der Partizipation sowie den Einfluss von BEI-NRW auf die Partizipation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die sich mit der Einleitung, Partizipation (inkl. der partizipativen Wende in sozialen Berufen und Aspekten wie Partizipationshindernisse), dem Begriff der Behinderung, relevanten Gesetzen und der individuellen Hilfeplanung (inkl. Phasen, Bewertung von Konzepten, BEI-NRW und Hilfeplanung bei Schwerstbehinderung) befassen. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was ist der Unterschied zwischen Partizipation und Teilhabe?
Die Arbeit differenziert zwischen "Einbezogen-Sein" (Teilhabe) und aktiver "Mitbestimmung" (Partizipation) an Entscheidungsprozessen. Die Synonymität von "Partizipation" und "Teilhabe" im Deutschen wird im Kontext der Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention diskutiert.
Welche Herausforderungen bei der Partizipation werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Herausforderungen, darunter widersprüchliche Ziele von Institutionen, ignorierte Interessen von Betroffenen und zu hohe Anforderungen an die Beteiligten.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention und BEI-NRW?
Die Arbeit hebt die Relevanz der UN-Behindertenrechtskonvention und des BEI-NRW (Behinderten-Informations- und Beratungssystem Nordrhein-Westfalen) hervor und analysiert ihren Einfluss auf die Partizipation und die individuelle Hilfeplanung.
Was ist die individuelle Hilfeplanung und welche Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die Phasen der individuellen Hilfeplanung, bewertet verschiedene Hilfeplankonzepte und erläutert die Funktion von BEI-NRW als Instrument zur Bedarfsermittlung. Der Umgang mit Schwerstbehinderung in der Hilfeplanung und die Herausforderungen und Chancen einer partizipativen Gestaltung des Prozesses werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Partizipation, Teilhabe, Behinderung, Individuelle Hilfeplanung, UN-Behindertenrechtskonvention, BEI-NRW, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, soziale Arbeit, Hilfeplanungsprozess.
- Arbeit zitieren
- Melina Intveen (Autor:in), 2021, Partizipation in der individuellen Hilfeplanung bei Menschen mit Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128673