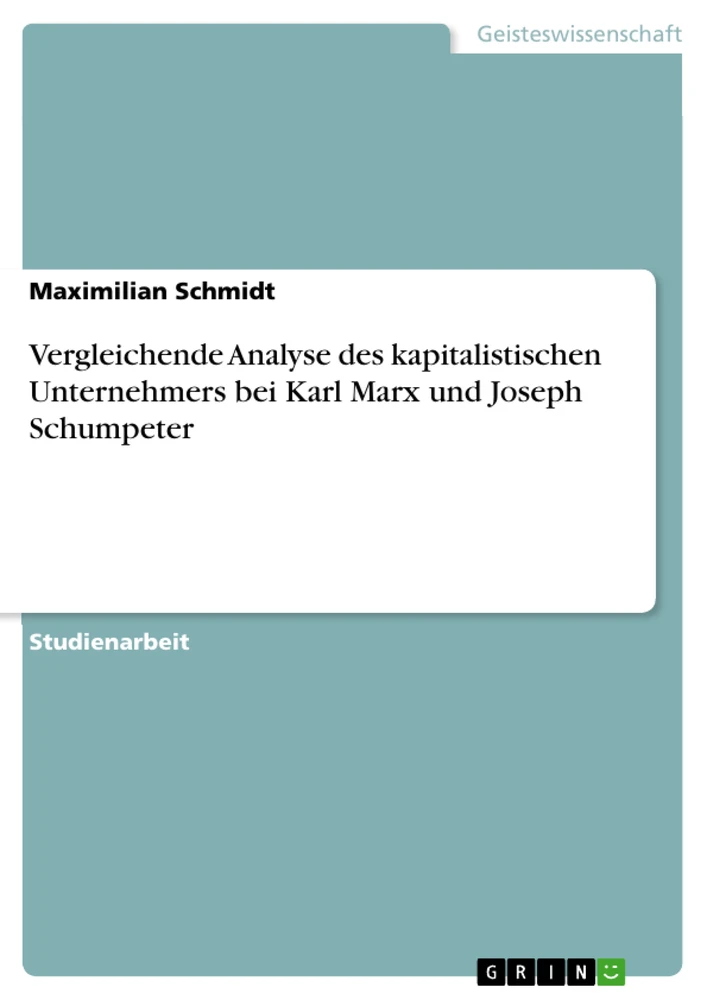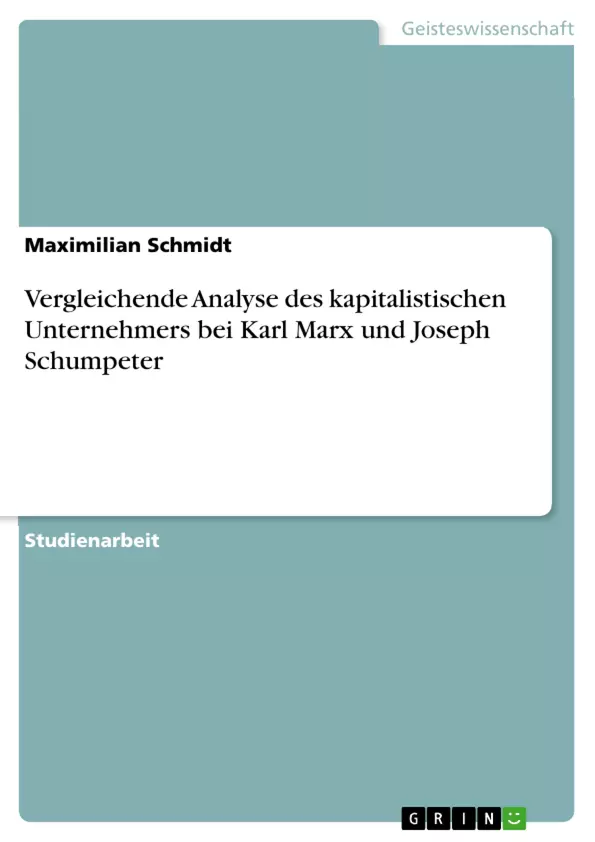Inwieweit erweisen sich die Unternehmerfiguren bei Marx und Schumpeter, trotz oberflächlich konträrer Darstellung als ähnlich, wenn diese kontextual in ihrer jeweiligen Kapitalismuskonzeption betrachtet werden?
Beginnen werde ich mit einer soziologischen Betrachtung des kapitalistischen Unternehmers, auf den Soziologen Werner Sombart rekurrierend. Daran anknüpfend werde ich eine erste Charakterisierung des Unternehmers bei Schumpeter und Marx vornehmen, die augenscheinliche Unterschiedlichkeit pointierend. Die spätere kontextuale Untersuchung des Unternehmers vorbereitend, werde ich im nächsten Schritt einige ausgewählte Grundlagen und Prinzipien der Kapitalismusentwürfe von Marx und Schumpeter, die für ein tieferes Verstehen des Unternehmers bezüglich seiner Funktion und Situation essentiell sind, darlegen. Darauf aufbauend erfolgt schließlich die vergleichende Untersuchung anhand einiger ausgewählter Kategorien. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in die Thematik
- 2 Der Unternehmer aus einer soziologischen Perspektive
- 2.1 Der Unternehmer bei Karl Marx
- 2.2 Der Unternehmer bei Joseph Schumpeter
- 3 Die Grundzüge des Kapitalismus bei Marx und Schumpeter
- 3.1 Der Kapitalismus bei Marx
- 3.2 Der Kapitalismus bei Schumpeter
- 4 Vergleichende Betrachtung des Unternehmers bei Marx und Schumpeter
- 4.1 Die Errungenschaften
- 4.2 Die Ambivalenz
- 4.3 Klassendynamik und „Schicksal“ des Unternehmers
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Unternehmerfiguren bei Karl Marx und Joseph Schumpeter vergleichend zu analysieren. Trotz oberflächlich konträrer Darstellungen soll untersucht werden, inwieweit Ähnlichkeiten bestehen, wenn die jeweiligen Kapitalismuskonzeptionen berücksichtigt werden.
- Der kapitalistische Unternehmer bei Marx und Schumpeter
- Vergleich der Kapitalismuskonzeptionen von Marx und Schumpeter
- Die Rolle des Unternehmers im jeweiligen System
- Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Darstellung des Unternehmers
- Die Bedeutung des Unternehmers für die kapitalistische Dynamik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung in die Thematik: Diese Einführung beschreibt den historischen Kontext des Aufstiegs des Kapitalismus und die damit verbundene Bedeutung des kapitalistischen Unternehmers. Sie stellt die gegensätzlichen Positionen von Marx und Schumpeter zum Kapitalismus und zum Unternehmer dar und formuliert die Forschungsfrage: Inwieweit ähneln sich die Unternehmerfiguren bei Marx und Schumpeter trotz oberflächlich konträrer Darstellung, wenn man sie im Kontext ihrer jeweiligen Kapitalismuskonzeption betrachtet? Der einführende Abschnitt skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit.
2 Der Unternehmer aus einer soziologischen Perspektive: Dieses Kapitel beginnt mit einer soziologischen Betrachtung des kapitalistischen Unternehmers basierend auf Werner Sombarts Werk "Der Moderne Kapitalismus". Sombart beschreibt den Unternehmer als zentrales Wirtschaftssubjekt, charakterisiert durch "kapitalistischen Geist", Gewinnstreben, Kalkulation und Risikobereitschaft. Der Fokus liegt auf dem disponierend-organisierenden Handeln des Unternehmers und der Verwertung seines Kapitals als Ziel der Unternehmung. Dieses Kapitel dient als Grundlage für den anschließenden Vergleich der Unternehmerkonzeptionen von Marx und Schumpeter.
2.1 Der kapitalistische Unternehmer bei Marx: Dieses Kapitel beschreibt Marx' Sicht des kapitalistischen Unternehmers als "personifiziertes Kapital". Marx charakterisiert den Unternehmer als von Gier und einem absoluten Bereicherungstrieb geleitet, der die größtmögliche Produktion von Mehrwert anstrebt, durch Ausbeutung der Lohnarbeiter. Marx sieht den Kapitalisten als eine bloße Personifikation der ökonomischen Verhältnisse des Kapitalismus, wobei die unternehmerische Handlungsweise zwischen den Zeilen gelesen werden muss.
Schlüsselwörter
Kapitalistischer Unternehmer, Karl Marx, Joseph Schumpeter, Kapitalismus, Vergleichende Analyse, Soziologie, ökonomisches Denken, Mehrwert, Gewinnstreben, Ausbeutung, Innovation, Klassendynamik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleichende Analyse des Unternehmers bei Marx und Schumpeter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert vergleichend die Unternehmerfiguren bei Karl Marx und Joseph Schumpeter. Sie untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Darstellungen des Unternehmers, unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Kapitalismuskonzeptionen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist der Vergleich der Unternehmerkonzeptionen von Marx und Schumpeter. Es soll untersucht werden, inwieweit sich die Unternehmerfiguren ähneln, obwohl sie oberflächlich gegensätzlich dargestellt werden. Die Arbeit betrachtet die Rolle des Unternehmers in den jeweiligen Systemen und analysiert Ähnlichkeiten und Unterschiede in deren Darstellung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den kapitalistischen Unternehmer bei Marx und Schumpeter, vergleicht deren Kapitalismuskonzeptionen, untersucht die Rolle des Unternehmers in beiden Systemen, analysiert Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Darstellung des Unternehmers und beleuchtet die Bedeutung des Unternehmers für die kapitalistische Dynamik.
Welche Autoren werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Unternehmerkonzeptionen von Karl Marx und Joseph Schumpeter. Zusätzlich wird Werner Sombart ("Der Moderne Kapitalismus") als Grundlage für die soziologische Betrachtung des Unternehmers herangezogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur soziologischen Perspektive des Unternehmers (inkl. Unterkapitel zu Marx und Schumpeter), ein Kapitel zum Vergleich der Kapitalismuskonzeptionen von Marx und Schumpeter, ein Kapitel zum Vergleich des Unternehmers bei Marx und Schumpeter (inkl. Unterkapitel zu Errungenschaften, Ambivalenz und Klassendynamik) und ein Fazit.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, um die Unternehmerfiguren und Kapitalismuskonzeptionen von Marx und Schumpeter zu analysieren. Sie stützt sich auf die Werke der genannten Autoren und integriert soziologische Perspektiven, insbesondere von Werner Sombart.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kapitalistischer Unternehmer, Karl Marx, Joseph Schumpeter, Kapitalismus, Vergleichende Analyse, Soziologie, ökonomisches Denken, Mehrwert, Gewinnstreben, Ausbeutung, Innovation, und Klassendynamik.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit (vorläufig)?
Die vorläufigen Ergebnisse werden in den Kapitelzusammenfassungen und dem Fazit dargestellt. Die Arbeit zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Darstellungen des Unternehmers bei Marx und Schumpeter aufzuzeigen, obwohl diese oberflächlich gegensätzlich erscheinen.
- Quote paper
- Maximilian Schmidt (Author), 2019, Vergleichende Analyse des kapitalistischen Unternehmers bei Karl Marx und Joseph Schumpeter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128711